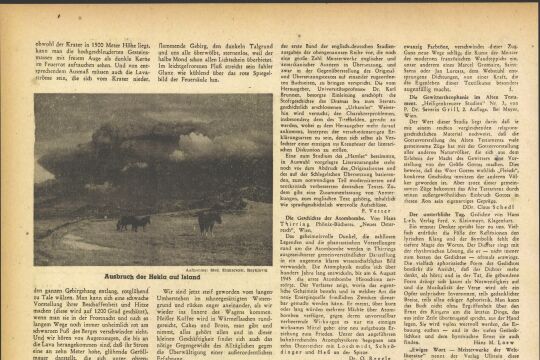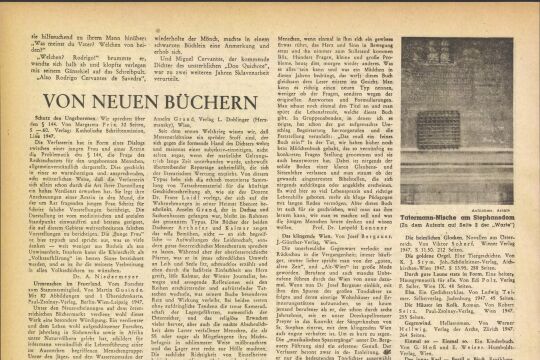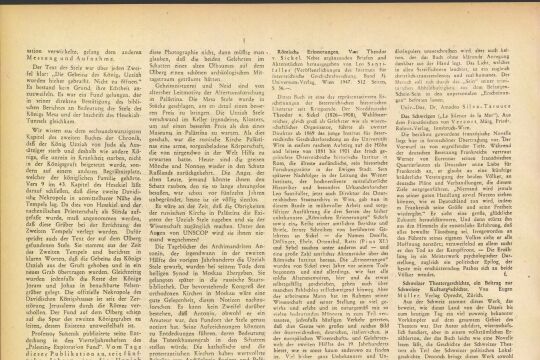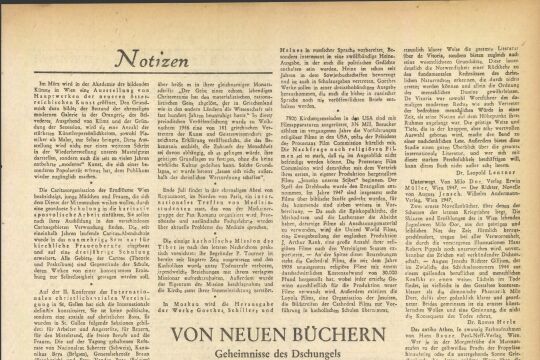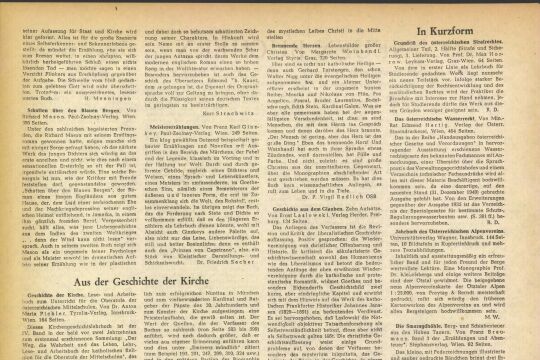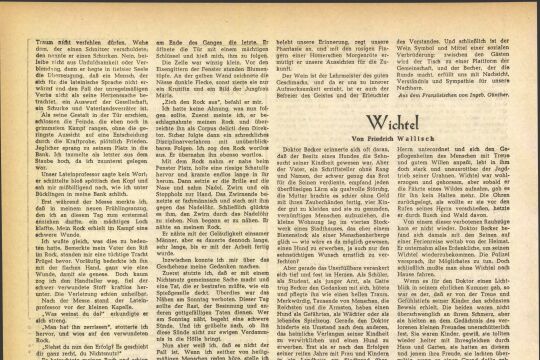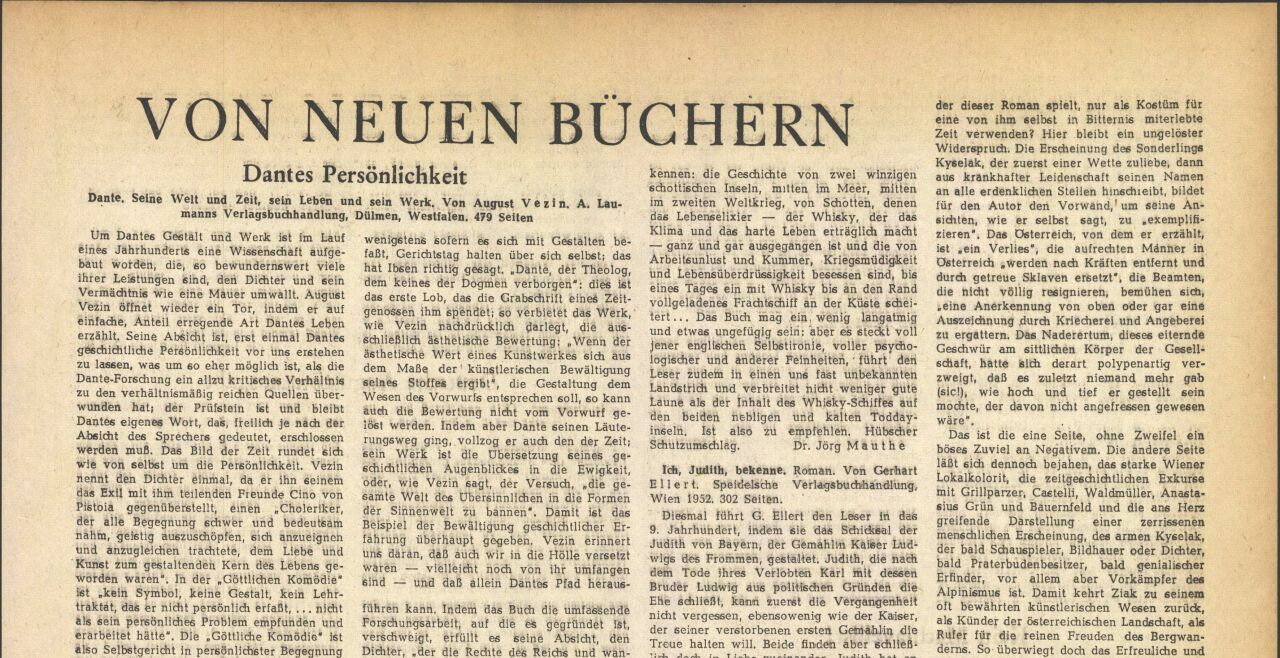
Um Dantes Gestalt und Werk ist im Lauf eines Jahrhunderts eine Wissenschaft aufgebaut worden, die, so bewundernswert viele ihrer Leistungen sind, den Dichter und sein Vermächtnis wie eine Mauer umwallt. August Vezin öffnet wieder ein Tor, indem er auf einfache, Anteil erregende Art Dantes Leben erzählt. Seine Absicht ist, erst einmal Dantes geschichtliche Persönlichkeit vor uns erstehen zu lassen, wa6 um 60 eher möglich ist, als die Dante-Forschung ein allzu kritisches Verhältnis zu den verhältnismäßig reichen Quellen überwunden hat; der Prüfstein ist und bleibt Dantes eigene« Wort, das, freilich je nach der Absicht de6 Sprechers gedeutet, erschlossen werden muß. Das Bild der Zeit rundet 6ich wie von selbst um die Persönlichkeit. Vezin nennt den Dichter einmal, da er ihn 6einem das Exil mit ihm teilenden Freunde Cino von Pistoia gegenüberstellt, einen „Choleriker, der alle Begegnung ßchwer und bedeutsam nahm, geistig auszuschöpfen, 6ich anzueignen und anzugleichen trachtete, dem Liebe und Kunst zum gestaltenden Kern des Lebens geworden waren“. In der „Göttlichen Komödie“ ist „kein Symbol, keine Gestalt, kein Lehrtraktat, da6 er nicht persönlich erfaßt, ... nicht als sein persönliches Problem empfunden und erarbeitet hätte“. Die „Göttliche Komödie“ ist also Selbstgericht in persönlichster Begegnung mit der Sünde, Beichte, Buße, Läuterung und Vollendung unter der Gewalt der sich herabneigenden Liebe. Dichten heißt überhaupt wenigstens 6ofern es sich mit Gestalten befaßt, Gerichtstag halten über sich selbst; das hat Ib6en richtig gesagt. „Dante, der Theolog, dem keines der Dogmen verborgen“: dies ist das erste Lob, das die Grabschrift eines Zeitgenossen ihm spendet; so verbietet das Werk, wie Vezin nachdrücklich darlegt, die ausschließlich ästhetische Bewertung: „Wenn der ästhetische Wert eines Kunstwerkes sich aus dem Maße der künstlerischen Bewältigung seines Stoffes ergibt“, die Gestaltung dem Wesen de6 Vorwurfs entsprechen 6oll, so kann aueh die Bewertung nicht vom Vorwurf gelöst werden. Indem aber Dante seinen Läuterungsweg ging, vollzog er auch den der Zeit; sein Werk ist die Übersetzung seines geschichtlichen Augenblickes in die Ewigkeit, oder, wie Vezin sagt, der Versuch, „die gesamte Welt des übersinnlichen in die Formen der Sinnenwelt zu bannen“. Damit ist das Beispiel der Bewältigung geschichtlicher Erfahrung überhaupt gegeben. Vezin erinnert uns daran, daß auch wir in die Hölle versetzt waren — vielleicht noch von ihr umfangen sind — und daß allein Dantes Pfad herausführen kann. Indem das Buch die umfassende Forschungsarbeit, auf die es gegründet ist, verschweigt, erfüllt es seine Absicht, den Dichter, „der die Redtte des Reichs und wandernd die Himmel beschrieben“, in die Zeit zu rufen, die seiner bedarf.
Paul Claudel — Andr6 Gide: Briefwechsel 1899—1926. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart. XXXXVI und 260 Seiten. Ubersetzt von Yvonne Gräfin Kanitz.
Die „Correspondence 1899—1926“ sind 1949 bei Gallimard in Paris erschienen, als die beiden Dichter noch lebten. Aber seit nahezu 25 Jahren hatten sie die Beziehungen zueinander abgebrochen. Claudel, stürmisch und apostolisch wie immer, wollte Gide, den Protestanten, zum Katholizismus bekehren. Es ging ihm darum, einem Dichter, dessen Einfluß wie ein Geheimnis groß war, die letzte Verantwortung zu vermitteln. „Die Protestanten“, schreibt Claudel, „berufen sidi aufs Evangelium, und wir berufen uns auf Jesus Christus, dessen Zeugnis das Evangelium, dessen Wohnstatt aber die Kirche ist.“ Dem vorsichtigen und stets für seine Freiheit bangenden Gide war aber gerade diese Wohnstatt verdächtig. In seinem Tagebuch (aus dem Auszüge diesem Briefwechsel zeitgerecht eingestreut sind) schreibt Gide: „Das ist vielleicht das Protestantischste, was ich in mir habe: das Grauen vor dem Behagen.“ So kreisen diese beiden Dichter und Denker einer um den anderen: Claudel laut und heftig, Gide abwartend und skeptisch. Bis eines Tages Claudel den Briefwechsel abbricht, den Freund aufgibt und nur noch zum Gegner des Werkes wird, das die Jugend Frankreichs allzusehr beeinflußt. Claudel fordert Heldentum, Gide aber „eine Moral, die den Menschen nicht überfordert“. Beide beharren auf ihrem Weg und Ziel: der eine als katolischer Christ, der andere als goethischer Heide. — Diese Briefe geben Einblick in den Charakter der beiden Sdireiber, und daneben erfährt man vieles über Zeitgenossen und Mühen der Publizistik. Es ist interessant zu sehen, wie ein Dichter Verständnis hat für die Werke des anderen, aber sich beide menschlich nicht finden können. Die „sanfte Gewalt der Gnade ist für den einen eine Verwöhnung durch Gott, für den anderen eine Ungehcrigkeit Gottes.
DDr. Diego Hanns G o e t z O. P.
Adalbert Stifter. Von Wilhelm K o s c h. Verlag Josef Habbel, Regensburg 1952. 163 Seiten.
Das vorliegende Stifter-Buch bietet eine kurze Biographie des Dichters (15 Seiten) und gibt dn den Abschnitten „Charakter“, „Weltanschauung“, „Novellen“, „Romane“, „Essais“, „Kunstanschauung und Malerei“, „Schule und Kirche“, „Staat und Vaterland“, „Nachleben“ eine gute, übersichtliche und anregende Einführung in das Werk des Dichters. Diese propädeutische Grundhaltung des Buches bestimmt es zu starker Verbreitung, zumal die neuerdings wieder aufgelegte große Stifter-Biographie von A. R. Hein (Verlag W. Krieg) ihres Unifanges wegen immer nur einer kleineren Gemeinde zugänglich sein wird. Die eigentlichen Probleme der Stifter-Forschung hat der Verfasser, wo es nötig war, kurz angedeutet, ohne dadurch die flüssige Schreibart und den leicht verständlichen Gedankengang zu durdi-brechen. Jedenfalls ist dieses sauber und zuverlässig geschriebene Bekenntnis zu Stifter, nicht zuletzt zu dem in katholischem Geiste schaffenden Dichter, zur ersten Einführung vortrefflich geeignet, zumal ja die kleine Stifter-Biographie von Hein bei Reclam seit langem vergriffen ist.
Univ.-Doz. Dr. Robert Mühlher
„Ev und Chiistophei“. Roman 237 Seiten. Honigraub. Oder: Der Hügel von St. Joseph. Roman. 255 Seiten. Beide: Von Josef Friedrieh Perkon ig, Paul-Neff-Verlag, Wien-Berlin-Stuttgart 1952.
„Ev und Christopher“, eine neuere Erzählung Perkor.ig6, gewinnt dem ewigen Thema Liebe eine Seite ab, die im Schrifttum unserer Tage, dem vielstimmigen amoralischen Lob von Rausch und Fatum, selten geworden ist. Zwei Menschen, in naiver Triebhaftigkeit zueinander drängend, leben eine Zeitlang in keuscher, schuldlos-schuldiger Gemeinschaft und beugen sich schließlich —■ nicht der Dorffeme, sondern ihrer eigenen Einsicht und Bescheidung, dem höheren, höchsten Gesetz des Lebens. — Aus dem älteren Oeuvre Perkonigs ist jetzt wieder der „Honigraub“ zugänglich, diese wundereame Geschichte eines Franziskus auf dem Dorfe, des „Evangelist Lukas“, dessen kleine Sünde aus Barmherzigkeit, der notgedrungen arrangierte Honigraub seiner halbverhungerten Bienen, ihm die schwer'getragene Verachtung des ganzen Dorfes einträgt; er aber ist besser als seine Richter und sammelt durdi tätige Liebe feurige Kohlen auf das Haupt der Harten. Hier ist alles groß und letzte Erfüllung. Eine schier unerschöpfliche Fülle individueller und typischer Eaucrngestalten, prall von heftig bewegtem Leben, macht dieses Buch so unendlich reich. „Honigraub“ ist ein weithin sichtbarer vorläufiger Schlußstein in der jahrhundetalten Entwicklung der deutschen Dorfgeschichte.
Dr. Roman Herle
Das Whisky-Schiff. Von Complon Mac-k e n z i e. Benziger-Verlag, Einsiedeln-Zürich-Köln. 351 Seiten.
Mancher wird sie vielleicht au6 dem Film kennen: die Geschichte von zwei winzigen schottischen Inseln, mitten im Meer, mitten im zweiten Weltkrieg, von Schotten, denen da6 Lebenselixier — der Whisky, der das Klima und da6 harte Leben erträglich macht — ganz und gar ausgegangen ist und die von Arbeitsunlust und Kummer, Kriegsmüdigkeit und Lebensüberdrüssigkeit besessen sind, bis eines Tages ein mit Whisky bi6 an den Rand vollgeladenes Frachtschiff an der Küste scheitert ... Das Buch mag ein. wenig langatmig und etwas ungefügig sein: aber eis steckt voll jener englischen Selbstironie, voller psychologischer und anderer Feinheiten,' führt den Leser zudem in einen uns fast unbekannten Landstrich und verbreitet nicht weniger gute Laune al6 der Inhalt des Whisky-Schiffes auf den beiden nebligen und kalten Todday-inseln. Ist also zu empfehlen. Hübscher Schutzumschlag. Dr. Jörg M a u t h e
Ich, Judith, bekenne. Roman. Von Gerhart Ellert. Speidelsche Verlagsbuchhandlung, Wien 1952. 302 Seiten.
Diesmal führt G, Ellert den Leser in das 9. Jahrhundert, indem sie das Schicksal der Judith von Bayern, der Gemahlin Kaiser Ludwigs des Frommen, gestaltet. Judith, die nach dem Tode ihres Verlobten Karl mit dessen Bruder Ludwig aus politischen Gründen die Ehe schließt, kann zuerst die Vergangenheit nidit vergessen, ebensowenig wie der Kaiser, der seiner verstorbenen ersten Gemahlin die Treue halten will. Beide finden aber schließlich doch in Liebe zueinander. Judith hat an der Seite ihres Gemahls, der ein tief gläubiger, aber sdiwacher, immer an 6ich 6elbst zweifelnder Mann list, vieles zu erdulden. Man verdächtigt sie, daß ihr Sohn nicht von Ludwig sei und der Kaiser selbst zweifelt an ihrer Treue. Die Söhne Ludwigs aus der ersten Ehe empören sich gegen den Vater und zwingen ihn zur Abdankung. Jadith wird in einem Kloster gefangengesetzt, flieht aber zu Ludwig. Die unaufhörlichen Streitigkeiten mit und zwischen den Söhnen führen schließlich zur Zerreißung des Reiches. In allen diesen Bedrängniesen wädist aber Judiths Liebe zu Ludwig immer mehr und wird zur restlosen autopfernden Hingabe. Ellert kleidete den Roman in die Form einer eigenen Aufzeichnung Judiths. Als Witwe schreibt sie in der Stille eines Klosters diese Erinnerungen. Dadurch erhält die Darstellung die Wärme des persönlidien Erlebens. Der historische Hintergrund wird ohne umständliche Beschreibungen deutlich gemacht. Die sichere Beherrschung der Erzähllechnik, die psychologische Vertiefung, die gut aufgebauten Dialege und der klare, geformte Stil sind die Vorzüge, die dieser neue Roman Ellerts mit den früheren Werken gemeinsam hat.
Dr. Theo Trümmer
Kyselak. Ein Roman des Wiener Biedermeier. Von Karl Z i a k. Danubia-Verlag, Wien. , 228 Seiten.
Zu seinem eigenen diditeri6chen Werk 6oll der Autor weder ein Vorwort noch ein Nachwort schreiben. Er beweist 6onst, daß er 6ein Werk als zu sdrwach erachtet, für sieh selbst zu sprechen. Immerhin, das Nadiwort, das Ziak seinem „Kyselak“ anfügt, ist aufschlußreich. Aus Angst, mißverstanden zu werden, berichtet er, daß das Buch in einer für ihn politisch unerfreulichen Zeit entstanden ist. Will Ziak also den Vormärz, die Epoche, in der dieser Roman spielt, nur al6 Kostüm für eine von ihm selbst in Bitternis miterlebte Zeit verwenden? Hier bleibt ein ungelöster Widerspruch. Die Erscheinung des Sonderlings Kyselak, der zuerst einer Wette zuliebe, dann aus krankhafter Leidenschaft seinen Namen an alle erdenklichen Stellen hinschieibt, bildet für den Autor den Vorwand,'um seine Ansichten, wie er selbst 6agt, zu »exemplifizieren“. Das Österreich, von dem er erzählt, ist „ein Verlies“, die aufrechten Manner in Osterreich .werden nach Kräften entfernt und durch getreue Sklaven ersetzt“, die Beamten, die nicht völlig resignieren, bemühen sich, .eine Anerkennung von oben oder gar eine Auszeichnung durch Kriecherei und Angeberei zu ergattern. Das Naderertum, dieses eiternde Geschwür am sittlichen Körper der Gesellschaft, hatte sich derart polypenartig verzweigt, daß es zuletzt niemand mehr gab (sie!), wie hoch und tief er gestellt sein mochte, der davon nicht angefressen gewesen wäre“.
Das ist die eine Seite, ohne Zweifel ein böses Zuviel an Negativem. Die andere Seite läßt 6ich dennoch bejahen, das starke Wiener Lokalkolorit, die zeitgeschichtlichen Exkurse mit Grillparzer, Castelli, Waldmüller, Anastasius Grün und Bauernfeld und die ans Herz greifende Darstellung einer zerrissenen menschlichen Erscheinung, des armen Kyselak, der bald Schauspieler, Bildhauer oder Dichter, bald Praterbudenbesitzer, bald genialischer Erfinder, vor allem aber Vorkämpfer des Alpinismus ist. Damit kehrt Ziak zu seinem oft bewährten künstlerischen We6en zurück, als Künder der österreichischen Landschaft, als Rufer für die reinen Freuden des Bergwandems. So überwiegt doch das Erfreuliche und wir können — mit dem ernsten Vorbehalt, den uns der Autor in seinem Nachwort selbst an die Hand gibt — seinen .Kyselak“ als lesenswertes Buch bezeichnen.
Prof. Dr. Friedrich Wal lisch
Die Reise nach Hallstatt. Erzählung. Von August Karl Stöger. Oberösterreichischer Landesverlag, Linz 1952. 285 Seiten.
Den Roman einer bestimmten Landschaft zu schreiben, bedeutet ein Wagnis. Gewagt, wenn vom Menschen allein oder von der Natur ausgegangen wird. Stöger aber bildet die Menschen aus der Natur und diese in die Menschen. Ansicht und In6icbt verschmelzen sich. Man darf — wie bei Stifter, der oft genannt wird (das Buch erhielt übrigens den Stifter-Preis für Literatur des Landes Oberösterreicb, 1951) — die Spannung nicht von oben greifen wollen, vielmehr die Dinge begreifen und sich untätig e r greifen lassen. So wirkt das Stiftersche „sanfte Gesetz“. Stöger gibt Zeitnähe und Zeitferne nebeneinander und die Vielschichtigkeit verleiht dem Buche einen seltsamen Reiz. Hanns S a 1 a s c h e k
Bibliotheque Internationale de Musicologie
(Presses Universitäres de France). Gisele Brelet: L'Interpretation Creatrice, I. l'exe-cution et l'oeuvre, II. l'execution et l'expres-6ion (ä 600 frs). Walter Howard (trad. par A. Golea): La Musique et l'Enfant (400 frs).
Das Werk von G. Brelet ist aus persönlicher Künstlererfahrung gewachsene Wissenschaft, lebensnah und kunstwahr. (Ist sie selbst ja Pianistin mit Gestaltungskraft.) Sie beweist ihre Bücher durch ihre Kunst und ihre Kunst durch ihre Bücher. Nicht umsonst wird der Vorkämpfer für eine „Musikwissenschaft, durch vollwertige Künstler betrieben“, unter 125 zitierten Autoren am häufigsten herangezogen und im II. Band ausführlich besprochen; in dem kleinen Büdilein „La Musique et l'Enfant“ wird ihm Gelegenheit gegeben, auch selbst zu Wort zu kommen. Howard beweist darin, wie gut 6eine Kun6tlehre fundiert ist. Uberraschend ist 6ein Einfühlungsvermögen in die Kinderpsyche und seine Kun6t, uns bewußt zu machen, was man fühlt.
J. M. H. Auias
Die Dritte Walpurgisnacht. Von Karl
Kraus. Köselverlag, München 1952. 309 Seiten.
Echte Zei'tisatire wird um so schwerer verständlich, je länger die Zeit vergangen ist, auf die sie sich bezieht; denn der Satiriker meint, daß seine Zeitgenossen das Zeitgeschehen zwar kennen, aber nicht erkennen, und der Zweck seines Werkes ist es geradezu, solche brachliegende Vorkenntnisse zu Erkenntnissen zu ordnen. Es ist immerhin schon 19 Jahre her, seit KarlKraus die „Hitler-Fackel“, wie sie in der mündlichen Uberlieferung seiner Gemeinde heißt, geschrieben, aber nicht veröffentlicht hat. Und es ist verständlich, wenn es auch ein wenig betrüblich sein mag, daß die Urheberrechtsinhaber das Werk nunmehr in einem reichsdeutschen Verlag erscheinen lassen: Es betrachtet jenen politischen und moralischen Umsturz 1933 nicht nur aus der speziellen Wiener Perspektive, sondern quasi sub specie aeternitas, wenn auch nach wie vor mit allem möglichen pikanten Details.
„Wort und Wesen — das ist die einzige Verbindung, die ich je im Leben angestrebt habe.“ Das war einer der Leitsätze für das Schaffen von Karl Kraus. Das nachgelassene Wc-k „Die Dritte Walpurgisnacht“ ist der umfangreiche Ausdruck seiner Sprachlosigkeit darüber, daß das Unwesen schlechthin zu Wort kommen, daß die Sprach- und-Sinnesverwirrung sich zu einer pathologischen Norm vollenden konnte, einem Idiom der Idiotie gleichsam, das sogar Denkoperationen zuließ, sofern die notwendigen Syllogismen der neuen Kategorie der Sinnwidrigkeit genügten. Bezüglich der Dauer des „Irr-Nationalis-mus“ ist Kraus auch am Ende seines Buches optimistisch: „Wie lange noch! — Nicht so lange, als der Gedanke aller währen wird, die das Unbeschreibliche, das hier getan war, gelitten haben.“ Aber da ist noch ein anderes Problem, weitläufiger und beängstigender als jene Katastrophe, vor das wir uns, genau betrachtet, heute noch gestellt sehen und für dessen allmähliche Bewältigung diese Schrift von Karl Kraus einen geistigen Behelf bieten könnte. Er deutet es in banger Voraussicht mit einem einzigen Satz an: „Es wird vorübergehen wie eine Marschkolonne; aber die Frage ist, was zurückbleibt.“
Edwin Hartl
Denkmäler der Tonkunst in Österreich: Nicolaus Zangius, Geistliche und weltliche Gesänge. Bearbeitet von Hans Sachs, Textrevision von Anton Pfalz. Österreichischer Bundesverlag, Wien 1951.
Die Denkmäler der Tonkunst in Österreich legen unter der Leitung von Erich Schenk nun den dritten Band der Nachkriegszeit vor, eine Leistung, der bei den großen Zeitschwierigkeiten alle Anerkennung gebührt. Hans Sachs hat in diesem Bande die geistlichen und weltlichen Gesänge Zanges veröffentlicht die 1611 und 1612 im Erstdruck in Wien erschienen. Zangius war kein Österreicher. Gebürtig aus der Mark Brandenburg, wurde er Kapellmeister an St. Marien in Danzig. Er gewann dann aber Beziehungen zum Kaiserhof in Prag und übernahm s— zunächst unter Beibehalt seiner Danziger Stellung — hier den Kapellmeisterdien6t. Doch, ein unruhiger Geist, ist er bald in Venedig, in Danzig, wo er die Stelle verliert, in Stettin und schließlich 1611 in Wien, wo er die im vorliegenden Bande neu veröffentlichten Werke „Ander Theil Deutsche Lieder mit drey Stimmen“ und „Cantiones sacrae (quas vulgo motetas vocant)“ bei Bonnoberger herausgab. 1610 scheint er noch im kaiserlichen Anstellungsverhältnis gestanden zu 6ein. 1612 wird er als kurfürstlich brandenburgischer Kapellmeister nach Berlin berufen. Das weitere Leben liegt im Dunkel. Jedenfalls 6tarb der Künstler vor 1620.
In der polyphon-homophonen Stilmischung, die in den deutschen Liedern betonterweise französischen, also protestantisch bedingten Einfluß erkennen läßt, iet des Zangius Werk typisch für die Übergangszeit um 1600, wie sein Leben und Wirken im Norden wie im Süden charakteristisch für die Zeit vor der einbrechenden Ferdinandeischen Gegenreformation ist. Sachs legt alles stilistisch Wissenswerte neben der historischen Dokumentation in der klar geschriebenen Einleitung dar. „Ein Künstler mittlerer' Kategorie“, wie ihn der Verfasser bezeichnet, ist die Gestalt Zangiu6 nicht nur durch seine Berührung mit Österreich interessant, sondern auch als Brennspiegel der vielfältigen Strömungen der Zeit, deren Einwirkungen an mittleren Meistern oftmals deutlicher abzulesen 6ind als an den überragenden großen. Dr. Andreas Ließ