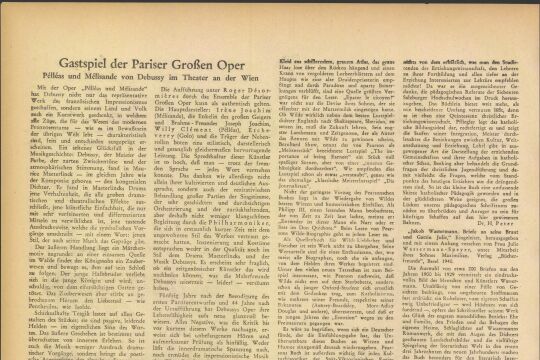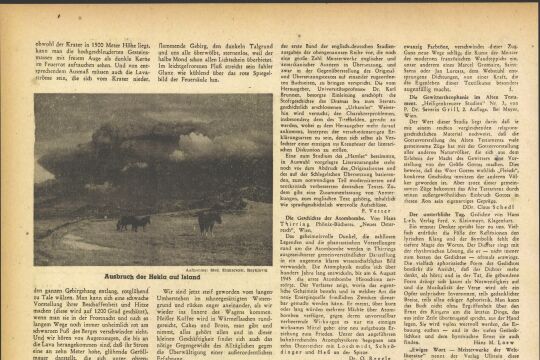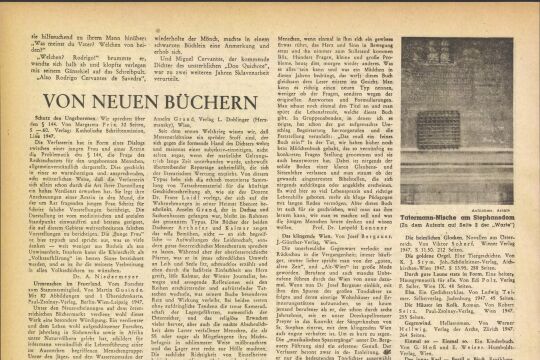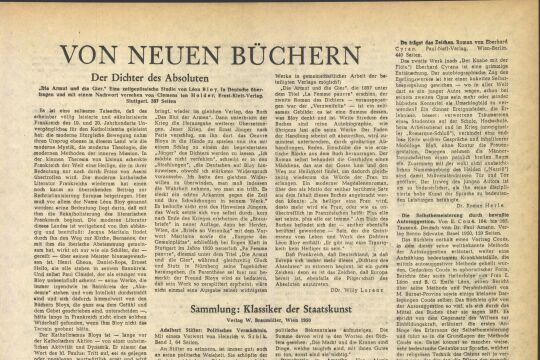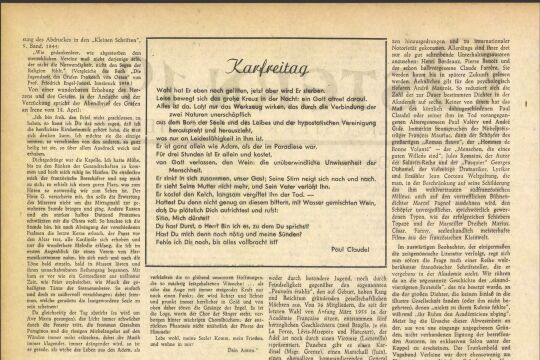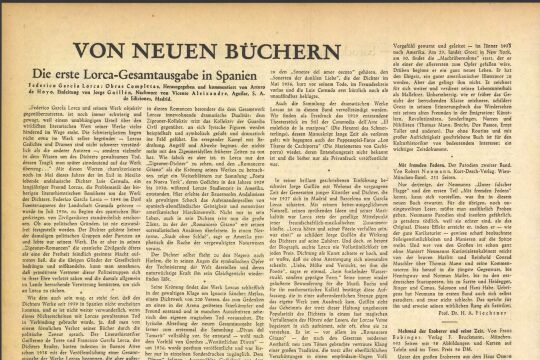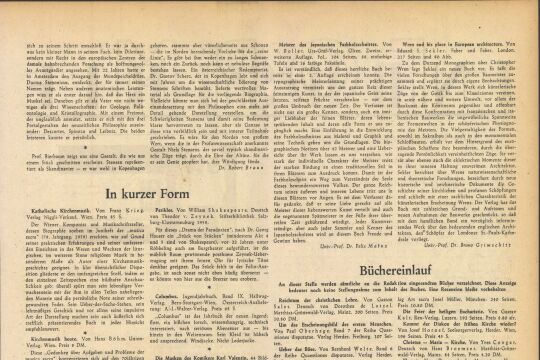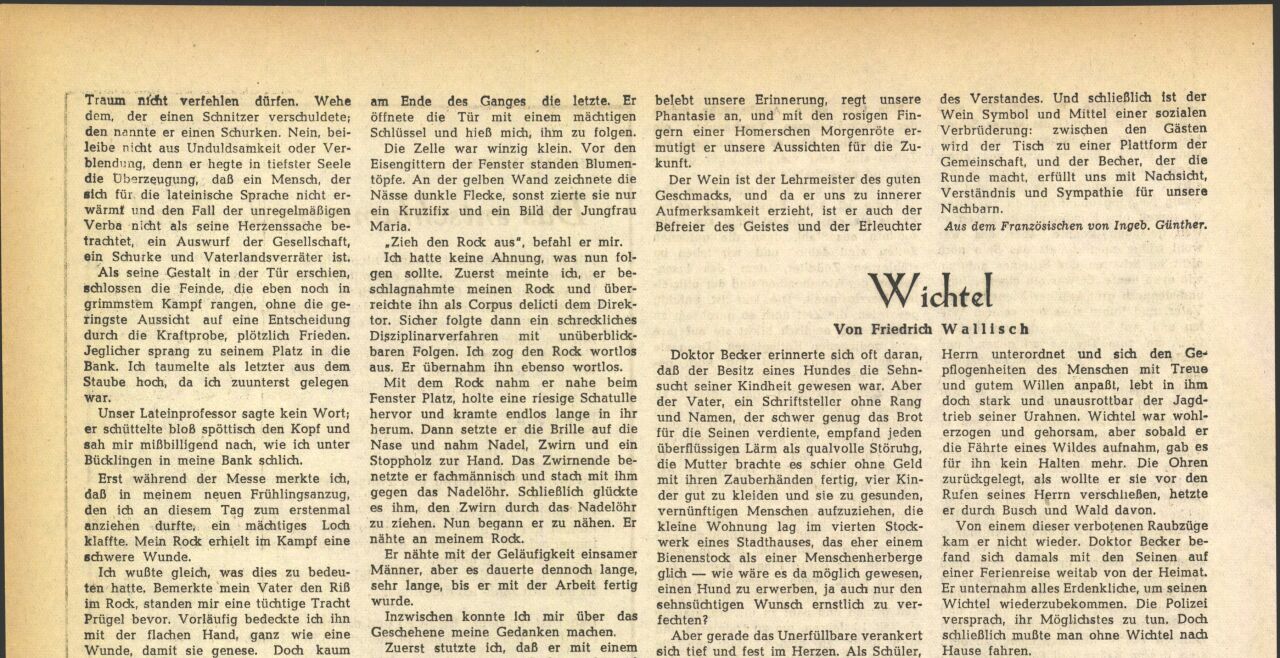
Frankreich ist das Land der literarischen Preise. Alljährlich treten dort berufene oder unberufene Richter zusammen, um über Bücher und Schriftsteller zu urteilen. Aus einer Menge von Wettbewerbern sollen die jeweils rühmlichsten auserkoren werden. Und der bildliche Lorbeerkranz samt dem zumeist auch nur sinnbildlichen und entwerteten Geldpreis bringen dem Gekrönten außer der Notorietät. die fortan seinem Namen anhaftet, noch einen buchhändlerischen Erfolg, der in die Zehntausende, mitunter in die Hunderttausende von Bänden geht, was mit Tausenden, beziehungsweise Zehntausenden Schweizeriranken gleichbedeutend ist. Was gibt es nicht alles für Preise! Den der Goncourts, als den angesehensten Und überzeugendsten (denn die zehn Mitglieder dieses Konkurrenzunternehmens zur Academie Francaise haben eine große Anzahl überragender Begabungen entdeckt oder ihnen zum Durchbruch verholten: Marcel Proust, Bernanos, Chateaubriant, Duhamel, Barbusse), den der Femina, den der Renaissance, den des Abenteuerromans, ganz abzusehen von den Preisen, die durch die Academie Franchise verteilt werden. Allerdings versinken die meisten Laureaten in jenes Meer der Vergessenheit, das auch einen erschreckenden Prozentsatz der vierzig angeblich Unsterblichen überflutet. Wer entsinnt sich noch der Adrien Bertrand, der Henry Malherbe und Thierry Sandre, die vor knapp einem Vierteljahrhundert den Gon-courtpreis bekamen?
Im letzten Jahre, das den Franzosen Anstoß zu den mannigfachsten Rückblicken bot, wurde nun eine Jury eingesetzt, die aus der Perspektive von 1950 die besten Romane des verflossenen halben Säkulums bezeichnete. Derlei Urteile i n Paris sind begreiflicherweise so umstritten wie die des Paris. Politische, literarische und persönliche Meinungen der Richter spielen eine wichtige Rolle. Da aber die Urteiler in diesem Falle mit besonderer Sorgfalt bestellt wurden, verkörpern sie zum mindesten die Ansichten der höchstgebildeten Schicht Frankreichs, des künstlerisch und literarisch, interessierten Bürgertums. Das Ergebnis des nach langwierigen Erörterungen zustande gebrachten Wahrspruchs ist in jeder Hinsicht lehrreich und in vielem Belang überraschend.
Als die zwölf besten Werke erzählender Prosa wurden genannt: „Eine Liebe Swanns“ (der Anfangsband von .Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“) von Marcel Proust, .Die Götter dürsten“ von Anatole France,Der verzauberte Hügel* von Maurice Barrls, .Die Falschmünzer“ von Andre Gide, ferner „Das Tagebuch eines Landpfarrers“ von Georges Bernanos, „Therese Desqueyroux“ von Francois M a u r i a c, „Das menschliche Verhängnis“ von Andre Malraux, Duha-mels .Mitternachtsbeichte“, Lacretelles .Silbermann“, Larbauds .Ferroina Mar-quez“, JulesRomains „Süße des Daseins“ und „Der Ekel“ von Sartre. Diesen Büchern gesellte die Jury als dreizehntes ein Werk ihrer Vorsitzenden, Madame C o 1 e 11 e, hinzu: „Die Vagabundin“. Französische Leser vermissen in dieser Liste sofort einmal die einstigen Lieblinge des Publikums, wie Paul B o u r-g e t, Louis H e m o n und vor allem Pierre L o t i, dann die künstlerisch ohne Zweifel hochstehenden Erzähler, denen die republikanisch-bürgerlichen Männer vom Juste Milieu sei es Rechtsabweichungen, sei es extreme Linksgesinnung vorwerfen. So sind Montherlant, Chauteaubriant, dann wieder Barbusse, Vercors ausgeschieden. Völlig unbegreiflich aber ist sowohl für die französischen als auch für die ausländischen Literaturfreunde das Fehlen der Nobelpreisträger Romain Rolland und Martin d u G a r d, dann das des unvergleichlichen Jean Giraudoux.
Am Entscheid der Preisrichter zeigt sich wieder einmal, wie verschieden die eigenen Landsleute und die auswärtigen Beurteiler die französische Literatur sehen. Werke, wie „Das Feuer“ Barbusses, der „Jean Christophe“ Romain Rollands oder die „Thibaults“, Roger Martin du Gards haben ringsum in der Welt hundertmal mehr Beachtung und Anerkennung gefunden als etwa Valery Larbauds nur wenigen Feinschmeckern erinnerliche „Fer-mina Marquez“ oder Lacretelles feine rassenpsychologische Studie „Silbermann“. Zum Zweiten, wie rasch verfliegt auch der offizielle mit der akademischen Unsterblichkeit bedachte Ruhm, etwa eines Paul Bourget oder Pierre Löti! Drittens, politische Extratouren nach rechts oder links werden in Frankreich den Autoren nicht verziehen. Barbusse, Vercors, wie übrigens auch Aragon und Eluard haben nur bei ihren kommunistischen Gesinnungsgenossen volle Geltung. Montherlant, Chateaubriant und alle, die sich einst zum Weimarer Dichtertreffen ins Dritte Reich begaben, sind dafür mit dem literarischen Bann belegt, soweit die offizielle und die Kritik des bürgerlichen Durchschnittslesers in Betracht kommen. Malraux und Sartre werden der einstige Kommunismus und der anarchische Atheismus nicht angekreidet, weil sie sonst für die bürgerliche Demokratie willkommene Bundesgenossen sind. Innerhalb der Grenzen aber, die durch Bolschewismus links und Nazismus rechts gezogen werden, herrscht bei den Preisrichtern weitherzige Freiheit des Urteils Sie anerkennen ironische Weltbürger wie Anatole France und leidenschaftliche Nationalisten wie Maurice Barres, Ungläubige wie Gide und glühende Katholiken wie Bernanos oder Mauriac, Männer der abenteuerlichen Tat wie Malraux und vom Weltekel erfüllte Existentialisten wie Sartre.
Olivia. Von Oll via. Paul Zsolnay-Verlag, Wien 1950, 205 Seiten.
Die Autorin — nach Mitteilung des Verlages verbirgt sich unter dem Pseudonym Olivia die Engländerin Dorothy Simon Bussy — erzählt in diesem Buch, wohl aus Selbsterlebten schöpfend, von der leidenschaftlichen Liebe eines sechzehnjährigen Mädchens zu einer Pensionatslehrerin von starker persönlicher Anziehungskraft. Dieser Liebe, in der sich das erwachende körperliche Verlangen mit schwärmerischer Verehrung für alles Schöne seltsam mischt, ist nach mannigfachen Wirrungen eine schwere Enttäuschung durch das abweisende Verhalten der Lehrerin beschieden. Erst viel später wird der wahre Sinn dieses Verhaltens enthüllt. Während man von dem Mädchen Olivia einen deutlichen Eindruck gewinnt, ist die Gestalt der Lehrerin nur in flüchtigen Umrissen gezeichnet und wirkt blaß. Dem Leser von heute kann es nicht leicht fallen, sich in die Mentalität einer Pensionatsschülerin der Viktorianischen Zeit einzufühlen. Manches ist psychologisch fein beobachtet, und die Grenzen des guten Geschmacks werden immer eingehalten. Allerdings wird man das auf dem Umschlag des Buches zitierte Urteil eines Kritikers, der den Roman gleich den besten Liebeserzählungen der Weltliteratur an die Seite stellt, übertrieben finden.
Die Mappe meines Urgroßvaters. (Letzte Fassung) Von Adalbert Stifter. Schriftenreihe der Adalbert-Stifter-Gesellschaft, München. Band I. Verlag Karl Alber, Freiburg. 375 Seiten.
Die Entstehung dieses letzten, unvollendeten Stifter-Werkes sowie die Editionsgeschichte schildert der Herausgeber Dr. Franz Hüller ausführlich im Nachwort. Halten wir daraus nur fest, daß — nachdem Aprent im Jahr 1870 im ersten Band der „Vermischten Schriften* zusammenhanglose Bruchstücke mitgeteilt hatte — die ganze Handschrift der „letzten Mappe“ zum erstenmal 1939 gedruckt wurde, und zwar als zwölfter Band der sogenannten .Prager Gesamtausgabe“. Die vorliegende Edition wurde nach dem aus der Originalhandschrift hergestellten Text gedruckt; sie bringt Stifters originale Zeichensetzung, verzichtet aber leider auf Stifters Schreibgebrauch, der den Stifter-Leser nicht nur nicht gestört, sondern für den er ein Reiz mehr gewesen wäre. Uber die moralische Absicht und den Wert seines Werkes hat Stifter seihst Treffendes und Hochbedeutsames gesagt. Er, dem die Weltgeschichte nur das entfärbte Gesamtbild der Familiengeschichte war, „in welchem man die Liebe ausgelassen und das Blutvergießen aufgezeichnet hat“, spricht einmal — im „Nachsommer“ — den Wunsch aus, „daß durch Öffnung der Briefgewölbe in allen Ländern auch Einzelgeschichten von Familien und Gegenden verfaßt würden, die unser Herz oft näher berühren und uns greiflicher sind als die großen Geschichten der großen Reiche“.
Ein solcher Versuch — der übrigens während der letzten 50 Jahre von deutschen, französischen und englischen Schriftstellern wiederholt unternommen wurde, freilich nicht im Geiste Stifters — ist „Die Mappe meines Urgroßvaters“. Prof. Dr. H. A. F i e c h t n e r
Harfe im Dämmern. Gedichte. Von Gertrud Anger. Donau-Verlag, Wien 1950. 92 Seiten.
Diese Dichterin wurde geprägt durch ihre Begegnung mit Hellas und durch die Art und Weise, wie sie das Göttliche erlebt. Es mag Selbstbeschränkung sein, daß sie nicht zur Tragödie griff. Jedenfalls eignen ihr tiefe Einsichten in das Wesen des Tragischen. Artgemäß und folgerichtig wandte sie sich also der ernsten, strengen Ode zu und der Elegie im antiken Vers (mit einigen wenigen, kaum vermeidbaren Parallelen zu Weinheber). Hier erklimmt ihre Lyrik, eins mit sich, die Höhe. Doch verfügt die Dichterin auch über viel-Anmut, und so versucht sie es unter anderem auch mit dem deutschen Vierzeiler und zum Beispiel auch mit dem mitunter tänzelnden vierfüßigen Trochäus (Goethe: Kleine Blumen, kleine Blätter...), aber das gerät dann nicht ganz zum eigenen, wesentlichen Ton. Auch ist sie, vom Stofflichen her gesehen, im Idyll und formal im Sonett weniger glücklich. Doch den heimischen Walzertakt verwendet sie wieder beachtlich souverän. Immer dann aber, wenn sie zum griechischen Vers zurück-, so richtig heimkehrt, ob im Dienst der Größe oder der Anmut, der Trauer oder des Spiels, immer dann gelingen ihr Stücke, die bestehen bleiben werden, wie „Ver sacrum“, „An der Friedhofmauer“, Gedichte voll von der Süße und Holdheit einer hauchzarten Kantilene, wie sie so vollendet bei uns zuletzt nur Franz Staude zur Verfügung stand.