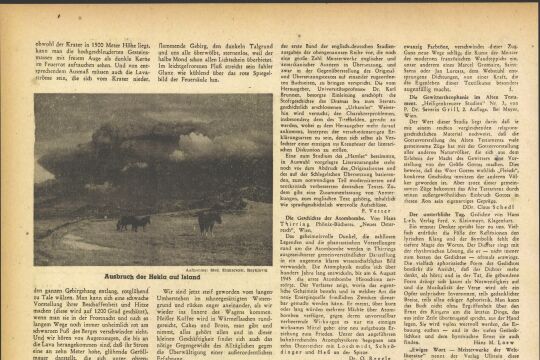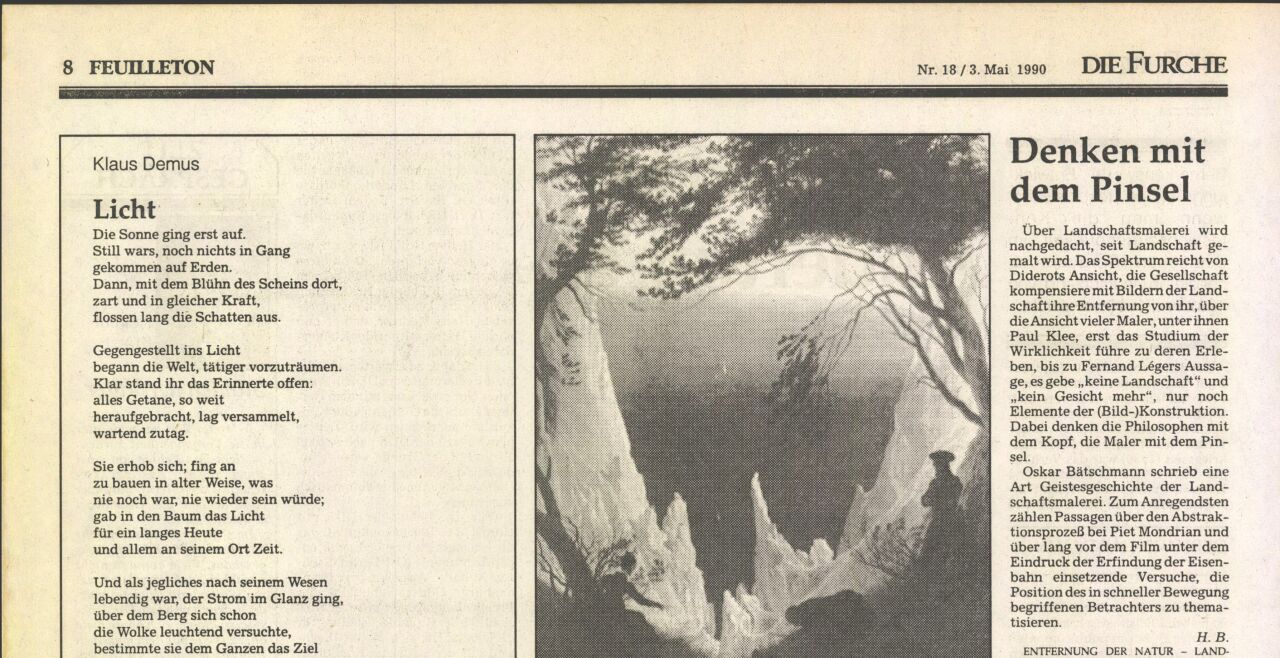
Ist die deutsche Literatur dazu verdammt, tiefgründige Aussa- gen zu machen, moralische Stand- orte der idealistischen Philosophie in belletristischer Form vorzufüh- ren (oder anzugreifen), selbst um den Preis krampfhaften Würgens, unbedingt etwas gänzlich Neues hervorzubringen, und dabei den Sinn dafür verloren zu haben, die Möglichkeit eines erfreulichen Ne- beneinander mehrerer gleicherma- ßen erfreulicher Experimente, Stil- richtungen und Geisteshaltungen in Erwägung zu ziehen?
Wirkt der schwer verständliche Mythos einer absurden Götterdäm- merung auf die deutschen Maße und Kriterien in der Literatur zurück, oder entspringt solche blinde „Berserkerwut" - das Wort wurde gerne von Heinrich Heine aufge- griffen - einer kulturhistorischen Eigenheit?
Die Frage stellt sich nach der Lektüre eines Buches, das weder in letzter Zeit, noch in deutscher Spra- che geschrieben worden ist, son- dern das Leben in einer alten pro- vencalischen Mühle schildert, mit vielen Abweichungen zur Schön- heit des Sternenhimmels, zu den wundersamen oder sehr menschli- chen Gepflogenheiten von Schä- fern, Bäckern, Scherenschleifern und ähnlichen Existenzen des (provencalischen) Voralpenlandes, auch zu der volksverbundenen, far- benfrohen, aber gerade dadurch auch geistig wirksamen Frömmig- keit tatendurstiger Dorfpfarrer und listenreicher Mönche.
Man hielt das Buch übrigens noch in den dreißiger Jahren für geeig- net, es als ersten belletristischen Behelf des französischen Sprach- unterrichtes zu verwenden; man meinte, es wäre einfach und inter- essant genug, um die Fantasie des Schülers in didaktischer Hinsicht auf die Probe zu stellen und zu- gleich zu fesseln.
Nun sind also die längst berühmt gewordenen „Briefe aus meiner Mühle" von Alphonse Daudet (1840-1897) in der jede feine Schat- tierung über die Sprachgrenze herüberrettenden neuen deutschen Übersetzung von Liselotte Ronte erschienen, von Andre E. Marty im Stil des späten, melancholisch gewordenen Jugendstils einfühlsam und anmutig mit Illustrationen und Buchschmuck versehen.
Die neuerliche Lektüre wird, wie so oft, zur Neuentdeckung. Der Leser, nicht nur älter geworden, sondern seit der ersten Begegnung mit dem Buche in mannigfaltiger Art verändert, mag empfindsamer oder schroffer geworden sein - er befindet sich jedenfalls nicht in der Gemütsverfassung des einstigen Schülers. Er hat vielleicht auch über die übrigen Arbeiten Alphonse Daudets vermutlich einiges erfah- ren. Und er nimmt sich - freilich nicht als Kunstrichter, der seinen Standort in aller Öffentlichkeit vertreten müßte, sondern als Pri- vatmann - das Recht, nach Lust und Laune auszuwählen und zu qualifizieren, das eine über das andere zu stellen und sich jener Arbeiten besonders zu erfreuen, in denen Daudets Geist die kürzeste Verbindung zwischen Imagination und Sprache gefunden hat. Ein Beispiel zeigt den Volltreffer. Eine hungrige Jagdgesellschaft versam- melt sich in einer Hütte der Ca- margue, „der Tisch ist gedeckt, und beim Dampf einer guten Aalsuppe tritt Ruhe ein, die große Stille des kräftigen Hungers, und so weiter."
Das willkürliche Urteil, das erst nachträglich - mehr aus intellektueller Gewohnheit als ei- nem ästhetischen Bedürfnis ent- sprechend - nach gedanklich faß- baren Ursachen sucht, um die eige- ne Verzückung oder Ablehnung auch noch mit Gedanklichem zu garnieren (um Daudets kulinari- sche Disposition nicht vorzeitig zu verlassen), gerät nun, wohl zufäl- lig, zu einem Versuch Arthur Scho- penhauers, für solche Verbindun- gen eine Erklärung zu bieten. Un- ter dem Titel „Zur Ästhetik der Dichtkunst" schreibt der Philo- soph: „Als die einfachste und rich- tigste Definition der Poesie möch- te ich diese aufstellen, daß sie die Kunst ist, durch Worte die Ein- bildungskraft ins Spiel zu verset- zen."
Wo es Alphonse Daudet am be- sten gelingt, „durch Worte die Einbildungskraft ins Spiel zu ver- setzen" , stellt sich jenes Gefühl der Verzückung ein, das jedem Litera- turfreund vertraut ist. Sogar zur Entstehung jener seelischen Leich- tigkeit, die den Autor in die Lage bringen mag, „die Einbildungskraft ins Spiel zu versetzen", bietet Scho- penhauer einen Hinweis, indem er an anderer Stelle betont, es wäre diese Art von Arbeit erleichtert dadurch, daß der Autor „für alles, was er sagt, nur halb verantwort- lich" sei.
In diesen beiden Meinungen Schopenhauers liegt übrigens - so scheint es - ein Gutteil der Erklä- rung für den Erfolg vieler Gedichte von Ernst Jandl, dessen ästhetische und weltanschauliche Motivationen sicherlich durch viele andere wohl- begründete Theorien gestützt sind, durch Schopenhauers blitzartige Erkenntnis allerdings - wer weiß?!
- vielleicht noch weiter begründet werden können.In gerade jenen Pro- sastücken, die verzücken, erweist sich Alphonse Daudet als Vorläu- fer von Autoren wie - in Österreich
- Peter Rosegger und Paula Grog- ger, vielleicht auch Karl Heinrich Waggerl. Theodor Fontane als Autor der „Wanderungen durch die Mark Brandenburg" (1862-82) ist ebenso Mitglied dieser illustren Gesellschaft wie Iwan Sergeje- witsch Turgenjew mit seinen „Auf- zeichnungen eines Jägers" (1847).
Schwärmerische Geister, die ihr gestörtes Verhältnis zur Natur - nach dem Beispiel von Jean Jacques Rousseau - durch wohl- meinende Theorien, gekünstelte Ge- mütsaufwallungen und eine Lebensform der theatralischen Einfalt wieder verbessert wissen wollen, sind freilich ebensowenig Nachfolger Daudets, wie die stili- stisch oft wirkungsvollen Natur- mystiker, unter denen wohl der Norweger Knut Hamsun mehr Bal- ladenhaftes schöpfte als der Fran- zose Jean Giono und unser Richard Billinger.
Bei Daudet ist Naturbe- trachtung etwas Natürliches; er findet den Menschen in den kos- mischen Kreislauf und in den rö- misch-katholischen Glauben der Provence eingebettet; er scheut sich nicht, Imagination - und diese, nicht die einfache Beobachtung der so- genannten Wirklichkeit ist seine Energiequelle - auch an den Punk- ten zur Sprache werden zu lassen, an denen das Ergebnis „schön", „berührend", ja in höchstem Maße harmonisch erscheint.
Das Ideal eines solchen Gleich- klangs wurde durch den Aufbruch der Moderne nicht nur weitgehend verdrängt, spndern als Ausgangs- punkt genau entgegengesetzt wir- kender Theorien verwendet. Paul Cezanne machte es, in seiner traum- verloren-erdgebundenen Art, den Malern verständlich, daß der be- rühmte Mont Saint Victoire auf der Leinwand mit besonderer Kraft nur erscheinen kann, wenn keine Ab- bildung des wirklichen Berges, son- dern ein besonderes Schweben von Farben - und in diesen die Imagina- tion des Berges - entstehen könne. Dadurch war ein neuer Standort gewonnen auch für die Literatur und die Musik. Die Folgen sind bekannt.
Es verschwindet aber nichts spurlos, vielmehr besitzt alles, was jemals geschaffen wurde, eine weite, oft unterirdische Existenz. Vielleicht verhilft selbst das flüch- tigste Blinken eines Auges weiter über alle Zeiten hinweg: durch die kurze Wahrnehmung, die etwas zu deuten geholfen, oder bloß als Spiel des Lichts, das jemanden erfreut.
So kann auch die Verzückung angesichts jener Prosatexte von Alphonse Daudet nicht aus dem Kosmos gleiten - ebensowenig wie die platonische Idee der Schönheit, wie sie in den Büchern seiner öster- reichischen Nachfolger Peter Ro- segger und Paula Grogger (Wag- gerl nicht ganz zu vergessen) in Erscheinung tritt. Diese Entdek- kung schleudert das Denken aller- dings zur ursprünglichen Frage zurück: Warum verbietet sich die deutsche Literatur das Vergnügen, sich an einem Nebeneinander un- terschiedlicher Stilrichtungen zu erfreuen?
In Frankreich bleibt Daudet unangetastet. Das hindert nieman- den, seinen gänzlich anders gearte- ten Zeitgenossen Charles Baude- laire zu verehren. Hätten Rosegger und Paula Grogger auf französisch geschrieben: sie würden immer wie- der ins Deutsche übersetzt und in wunderbar ausgestatteten Ausga- ben der Leserschaft immer wieder zugänglich gemacht. Denn franzö- sische, englische, russische und spanische Prosa darf auch schön sein - ja, schön im Sinne Daudets und seiner Harmonien -, allein in der deutschen Literatur muß bei jedem Wechsel der Stile gleichsam Blut fließen. „Was vor dem Expres- sionismus war, gilt nicht länger" oder „mit Thomas Mann stirbt der bürgerliche Roman" oder „Brechts episches Theater hat den Realis- mus zerstört", so lauten die Paro- len, als ließe sich Gottes Natur und die Vielfalt wirklicher Kultur durch das heisere Geschrei der Unteroffi- ziere der Genie-Truppe lenken. Die Vorhut zeigt den einzuschlagenden Weg; sie heißt Avantgarde und ist offenbar ebenfalls nach militäri- schem Vorbild gestaltet; leider läßt sich ihr verdienstvolles Tun dort vorn im Neuland nicht mit dem entsprechenden Preis ewiger Ju- gendlichkeit, Kampfeslust und Berserkerwut lohnen. Aus Neuland wird Altland, und es könnte wohl geschehen, daß man aus dem Kamp- fe mit einer Trophäe heimkehrte, die sich, bei genauerer Betrachtung als schön erwiese. Ist's eine Katze aus Gold oder bloß Katzengold oder vielleicht das wiederzugelassene Schönheitsideal des deutschen Malers Caspar David Friedrich?
Vielleicht ist der unbändige V Wille zum Sieg, der in der deut- schen Literatur das ruhige Neben- einander unterschiedlicher Stil- richtungen zunichte macht, bloß ein Ausdruck des jämmerlichen, pro- vinziellen und umso keuchender würgenden Strebens nach Erfolg. In diesem Falle wäre das Wüten der Kunstberserker verständlich. Al- phonse Daudet macht - freilich im schönen mediterranen Licht alther- gebrachter Heiterkeit - das Wesent- liche der Frage begreifbar, indem er anläßlich eines Besuches bei dem provencalischen Poeten Frederic Mistral im Dorf Maillane eine Er- kenntnis von Montaigne wiedergibt: „Erinnert euch doch stets des Mannes, der gefragt wurde, wozu er sich sosehr in einer Kunst abmü- he, deren doch nur ganz wenige kundig seien. Wenige sind genug, war die Antwort. Einer ist genug. Keiner ist genug.
BRIEFE AUS MEINER MÜHLE. Von Al- phonse Daudet. Verlag Artemis & Winkler, München 1990. 256 Seiten, öS 374,40.