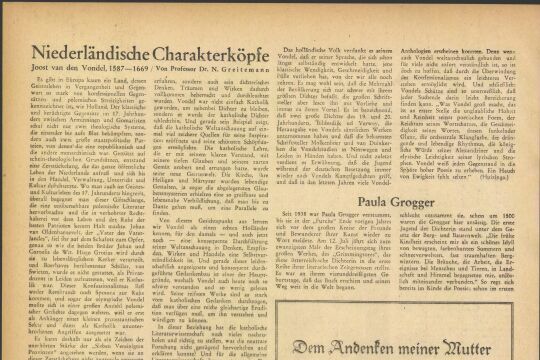Es geht eine Welle Ungeists durch die Welt, und Stimmen melden sich, die sich zu der Meinung bekennen, man habe dieses Tief als das Vorauswehen des Sturmes hinzunehmen, der sich als ein dritter Weltkrieg vorbereite. War der zweite Krieg schlimmer als der erste, so werde der dritte der wüsteste aller sein, die bisher Erde und Menschheit heimsuchten, desgleichen die Umbrüche vorher und nachher darin wir ja einige Praxis und Erfahrung haben und so weiter und so weiter ohne Ende.
Ich bin ein Mann der Feder und habe im Leben viele Blumen gepflanzt; wie vermöchte ich zu solchen Schildereien etwas zu sagen, zumal die Natur selber die Geschichte doch immer anders beschließt, als die Menschen raten?
Nein, ein anderes läßt mich an die Bahnen denken, die dieser Ungeist zieht: es ist der Verfall der Maßstäbe da und dort, hüben und drüben. Aber Maßstäbe sind ein Wesentliches, denn ohne Maß und Stab läßt sich nicht durch das Leben wandern, aus dem wir Repräsentanten des 20. Jahrhunderts zu zwei Dritteln eine Wüstenei gemacht haben. Und ich spreche von der Zunft, zu der das Schicksal einst — Gott sei’s geklagt — auch meine Wege gelenkt hat: der Dichtung und vom Volk der Leser. Die beiden liegen sich nämlich sanft in den Haaren und reißen sie sich unter humansten Formeln gegenseitig aus.
Sie haben — bewußt oder unbewußt — Stellung bezogen zu beiden Seiten des Abgrunds der Zeit, der Sachlichkeit, Roheit, Entzauberung, mit Pfiffigkeit gewürzter Dummheit und sehr viel Lüge. All dies begibt sich unter der Marke „Realität“. Der Dichter — und ich spreche hier nicht vom Schreiberling oder intellektuellen Konstrukteur — beklagt sich über mangelnden Absatz seiner Werke und schilt das Volk, weil es in der Mehrheit gesehen zum Schilling- Romanheft greift, über das kein Wort zu verlieren ist. Diese Leser aber erheben den Einwand, daß der Dichter der Gegenwart ihnen die Kost meist zu schwer zubereite. Er verklausuliere seine Darstellung, schürze Knöpfe aus pathologischen Elementen, die nie zum Erlebnis werden können, bewege sich doch hinsichtlich der „Komplexe“ die Wissenschaft selber in einem Veitstanz zwischen Synthese und Analyse. Wie vermöchte der Dichter hier schlüssige Formeln finden? Er gebärde sich so geistig, daß es schon nach Hochstapelei rieche und dem einfachen Mann Unbehagen schaffe.
Oho, wirft der Dichter ein, schreibe ich nur für den einfachen Mann? Gewiß, mein Freund, wenn wir so weit sind, zu verstehen, daß alles Große einfach ist, schaffen wir nur für einfache Herzen. „Faust“ ist das erhabenste Beispiel einer solchen Diktion.
Es wird mir die Gunst vieler meiner Arbeitskameraden und auch die manches Literaturbeflissenen kosten, wenn ich zu sagen wage, daß die Hauptschuld an dem Mißverhältnis zwischen Dichter und Leser wahrscheinlich in vielem beim Dichter liegt. Hier aber spießt sich schon die Feder: Ist’s noch der Dichter, dessen ich so ungeneigt gedenke, oder ist es der Konstrukteur? Das entscheide die Zeit.
Ich sehe, daß es einem solchen Dichter immer mehr Mühe macht, das Gerüst einer Handlung in die Welt zu setzen. Er bohrt immer neue Schächte in die Welt der Seele, um ihre Dunkelheit zu finden. ihm schwer: er hat kein Licht, dieses Dunkel zu erhellen, zum andern aber öffnen sich die Schächte der Seele nur dem wirklichen Dichter, niemals aber dem Schnüffler, der nicht begreifen will, daß Neurasthenie eine Sache der Nerven und nicht der Seele ist. Darum auch sind für den Seelenkenner all diese erdachten Spannungen so unsäglich leer, langweilig und fern dem wirkenden Leben..
Er ahnt, daß seinem Willen versagt ist, was dem Dichter von Gnaden geschenkt wurde: das Sanfte und Rührende auf würdige Weise darzustellen. Er malt mit den Farben der Ironie, wo er Gefahr läuft, mangels solcher Gaben sentimental und lächerlich zu werden; er knallt mit Spott, wo sein Wort Hauch sein müßte oder im Ungesagten das Tiefste gesagt erschiene. Aber Spott ist nicht Humor, sondern die Nachgeburt des Hohns.
Das schlimmste aber ist, daß er die Spannungen dort sucht, wo sie am anfälligsten zeitgebunden sind: im Affekt, in der Neurose, die eine zur Krankheit gemästete Unart der Empfindungsebene, also potenzierte Unart ist. Es sind Ausgeburten einer Epoche, die mit ihr versinken. Wir brauchen nicht daran zu denken, daß Ibsen schon sehr des Staubwedels bedarf, wogegen Stifter sich unverbrauchter Frische erfreut: die anderthalb Jahrzehnte zwischen den beiden letzten Kriegen haben uns die Entstehung und den Verfall konstruierter Welten gezeigt. Warum macht der Dichter unserer Zeit Experimente? Ist es das Fieber nach dem Erfolg? Zumeist wohl. Vergessen wir nicht, daß der Affekt stets den Effekt gebiert. Aus solcher Gestaltung ermöglicht sich eine Art literarischer Schocktherapie: das Poem reißt an den Nerven. Der Reißer ist geboren.
Und da erhebt sich nun die große Frage: Will das Volk der Leser den Reißer? Ich wage zu sagen: nein. Der Verleger wird mir recht geben. Derlei Unternehmungen gelingen immer seltener, die „General-Absatzkrise“ droht. Ein Erlebnis yar mir vor wenigen Wochen lehrreich. Ich besuchte eine Bücherauktion; ich war ohne besonderes Kaufinteresse gekommen, zumal auch mir das berühmte Echo des Künstlers klingt: „Honorar — rar“, doch erwies sich der Weg als Gewinn. Die Auktion war gut besucht, zumeist von einfachen Menschen. Gekauft wurde viel, keineswegs aber wahllos, obschon man die Ausrufpreise mäßig nennen durfte. Was erstand der einfache, kaum sonderlich „geschulte“ Leser? Aktuelles? Erregendes? Verbotenes? Nichts von alledem, obschon es auch ausgeboten wurde. Am stürmischesten umworben waren — die Klassiker. Nicht „Paneuropa“, aber Schiller, nicht „Der Reiter in deutscher Nacht“, aber Goethe; die Ebner-Eschenbach schlug Cooper-Powys „Wolf Solent“ an Interesse, E. T. A. Hoffmanns „Kater Murr“ erzielte weit mehr als eine vor nicht allzu langer Zeit erschienene Literaturgeschichte, Gottfried Kellers sämtliche Werke aber erreichten den Rekordpreis. Ganghofer und Zola ein Spagat hatte die beiden verheiratet gingen höher als Upton Sinclair Romane, nur Fontane wunderlicherweise und Rabindranath Tagore blieben, nebst einigen anderen Bänden, unverkauft.
Gewiß, man müßte solche Auktionen öfter besuchen, um ein bündiges Urteil fällen zu können. Der Zünftler freilich wird wissen, daß die Neigung des einfachen Publikums so beschaffen ist. Und gestehen wir doch ehrlich, Kameraden vom Schreibtisch: gerade dieses Publikum brauchen wir, die Aussprache mit ihm ist die tiefste Bestätigung unseres Schaffens, zeigt sie uns doch als Bildner der Volksseele. Alle Kunst ist im tiefsten Element Volkserziehung aus Beispiel und Bildung.
Es ist beglückend, zu erfahren, wie auch in tristesten Zeitläufen das Interesse am Buch ungebrochen lebendig bleibt. Es gibt Absatzkrisen — wir erleben gegenwärtig eine solche —, aber immer ist die Welt des Buches, schöpferisch und geschäftlich gesehen, eine große Welt. Wie schön, im breiteren Volk das Bemühen zu erkennen, das jeder Kunst das klingendste Echo ist. Es sind nicht die letzten, sondern die höchstzuschätzenden Leser, die nicht schlüssig zu sagen wissen, was ihnen an „Hamlet“, an Goethes „Märchen“, an Grillparzers „König Ottokar“, Balzacs „Eugenie Grandet“, den Novellen Mörikes oder J. V. Widmanns „Maikäferkomödie“ so gut gefallen hat und die dennoch gerne wieder zu solchen Begegnungen zurückkehren, weil sie ihr Unbewußtes im Wort des Dichters geborgen fühlen. Kunst ist unerklärbar, ihr Medium bleibt Geheimnis. Der Analytiker eines Kunstwerkes, sofern seine Arbeit nicht, wie es sich gehörte, vertieft und Tiefen susleudi- tet, erweckt ein fatales Gedenken an den weisen Arzt Virchow, der doch unweise genug war, zu sagen, er habe tausende Leichen seziert und nirgends eine Seele gefunden.
Neben dieser gültigen Dichtung gab es zu allen Zeiten die etwas vitalere Flut der primitiven Macher — die halbwegs besseren, etwa in der Front von Clauren — Heun bis Eduard Breier —, und sie waren phantasievoller als unsere heutigen Federfuchser. Ihre Namen sind kaum mehr bekannt, ihre Produkte längst durch die Papiermühlen gewandert. Daneben aber bezeugte sich noch ein weites und wichtiges Schaffen: das des Volksschriftstellers, und dieser Volkschriftsteller ist anscheinend ein aussterbender Typ. Was geht da vor?
Ist das Lesevolk schon so intellektuell, daß es an verwirrend geschürzten Seelenkapriolen sein Genüge findet, oder schrumpft sein Instinkt zum Primitiven zurück? Natürlich siegt hier, wie überall im Plan der Natur, die gesunde Mitte. Der „vergeistigte“ Dichter und der um geschriebenen Kohl bemühte einfache Mann, sie leben auseinander und gehörten im tiefsten Grunde doch zusammen wie Pech und Schwefel. Sie sind Narren ihres Extrems, was der eine zu viel will, bleibt dem andern ein Zuwenig.
Uebertreibe ich? Kamerad von der Feder, ein Wort an dich: Wozu diese erklügelte Problematik, die eigentlich gar keine ist? Hat man bei deinen Romanfiguren nicht den Eindruck, es seien handelnde Schemen, Themata, die der Haut davongelaufen sind, und die Gestalt selbst hinkt erst hintennach? Typen, die man mit Ohrfeigen und Pillen reparieren kann, sind nicht Träger von Lebensproblemen, sondern zeitraubende Belästigung. Und ich meine nun, daß der gesunde Verstand des bescheidenen kleinen Lesers viel treffsicherer urteilt. Zwar schweigt er vor Waschzetteltiraden, weil er nicht Gefahr laufen will, sich zu blamieren, denn er glaubt nicht zu wissen, was minder ist und was beträchtlich. Aber kaufen und lesen? Kaufen wird er das Buch, in dem die Wirklichkeit des Lebens sich irgendwie mit seinen Träumen zu jener versöhnlichen Einheit fand, wie sie in den Märchen aus Kindheitstagen so unvergessen lebt. Aber so etwas kann man nicht erfinden, wenn man nicht ein wirklicher Dichter ist. Wie anders erklärt sich sonst der ungebrochene Erfolg eines Karl May? Man hat ihm charakterliche und schriftstellerische Defekte in Menge nachgewiesen, doch in den Buchläden ist er, was den Verkauf anbetrifft, ungeschlagener Olympionike. Es gibt Reiseschriftsteller, die ihr Handwerk wertmäßig zehnmal besser verstehen; er hat sie alle überlebt, weil er, nehmt alles in allem, ein echter Poet, ein Märchenerzähler gewesen ist. Vor einem Jahrhundert prägte sich, über die Zeiten hinaus, der Name eines großen Dichters der Menschheit ein, der das Glück aller Volksschichten gewörden ist: Charles Dickens. Ihm zu begegnen ist heute noch unverlierbarer Gewinn. Ich war elf Jahre alt, als mir, recht zufällig, sein Roman „David Copperfield“ in die Hände kam. Noch entsinne ich mich der beiden braunen Bändchen Meyers Volksbibliothek, die ein altes Weiblein am Mittfastenmarkt feilgehalten hatte, und nie im Traum hätte ich gedacht, daß mir aus ihnen Glück für ein ganzes Leben geschenkt würde. Zur Zeit, da diese Schriften erstmals die Welt beglückten und sie haben sie für jeden heller gemacht, erkundigte sich Königin Victoria ebenso erwartungsvoll wie der Londoner Bäckerjunge, wann die nächste Fortsetzung des Dickenssehen Romans erscheinen werde. Und nicht anders war es in der übrigen zivilisierten Welt.
Damit soll nun nicht gesagt sein, es müsse jeder Dichter Dickens gleichen, doch ich denke an die unverlierbare Substanz, die in seinem Werk lebt, träume von der wundervollen Macht, mit der er sich in alle Herzen geschwungen hat und sehe in seiner Dichtung die ganze Welt gespiegelt. Da finden sich keine Mätzchen oder Geistreicheleien die meist nicht geistreich, sondern geistarm sind, wohl aber das Leben in Weite, Mitte und Tiefe, gepackt in einer Farbigkeit der geschilderten Charaktere, daß jeder darin sein Ich und seine Schmerzen heiteren und tränenden Auges erkennen kann. Gewiß war Dickens eine besondere Göttergabe geschenkt: er hatte Humor. Nicht Zynismus oder Ironie, sondern den volltönenden Humor, der immer, auch in aller Kritik, ein Stück Sonne bleibt und so eindeutig Gnade der Begabung ist. Wie die Welt der Lyrik. Und er hatte noch etwas: ein übervolles Herz und den Mut, die Kräfte des Gemütes walten zu lassen. So tragen seine Romane neben der Wucht der sozialen Anklage und wie hat sie genützt! gleichgewichtig das Licht der Heiterkeit; ich glaube, in den vielen tausend Druckseiten seines Werks findet sich keine, die eines lußeren Effekts willen geschrieben worden ist. Er war weise aus schöner Lebensgläubigkeit und doch auch aus tiefer Lebensnot.
Die Dichtung unserer Zeit aber leidet an der Gegenwartskrankheit, an Liebesarmut. Diese Empfindungsebene ist steril geworden, das Gemüt träge verschlackt. Die weitere Folge führt, kausal völlig richtig, über die Neurose im Extrem bis zur Brutalität und zum Verbrechen. Ohne Liebe keine Freude. Das Leid bereitet sich der Mensch selber, warum nicht auch die Freude? Ach, das ist auch so ein Geheimnis des Lebens, daß das Leid wie eine Sintflut kommt; Freudebringer aber sind wenige. Die Freude als Erlösung aber ist Aufgabe der Kunst.
Dichter sind dünn gesät, mögen die i Namenslisten im Börsenblatt auch band- i wurmlang werden. Es ist soviel Reportage aus alter und neuer Zeit: Hausbesorgertratsch, literaturfähig gemacht. Brannte dem und jenem das Thema wirklich auf dem Herzen? Glaube es wer kann. Man besehe sich doch die Schaufenster: je hastiger die Zeit eilt, desto dicker werden die Romane. Da stimmt etwas nicht! Es ist wie Schaumschlägerei, der Leser wird eingeseift noch und noch, bis er feierlich schwört, von der Qualität der Quantität überzeugt zu sein. Im Grunde genommen, haben so wenige etwas zu sagen, doch gerade jene, die nichts zu sagen haben, schmücken sich mit den meisten Worten. Hat auch die Dichter schon der Marasmus der Politik ergriffen, die sich den Teufel darum kümmert, ob sie im zukünftigen Geschichtsbild mit Heiligenschein oder Teufelskralle dargestellt wird? Unter dem Merkspruch, man lebe nur einmal, heute ist heute, gibt es kein künstlerisches Bekenntnis von mehr als Augenblickswert. Was sollen wir Iso tun?
Fontane läßt in einem Meisterroman „Effi Briest den alten, klugen Geheimrat Wüllersdorf sagen, daß ohne „Hilfskonstruktionen“, ohne Zwischenlösungen im Leben nichts zu machen sei. Ein Kompromiß also, ein Separatfrieden.
Nun, dann müßte doch wohl jeder von seiner hartnäckig verfolgten Laune lassen: der Dichter von der Jagd nach dem Erfolg mit dem unwürdigen Rüstzeug des Effekts und der Originalitätshascherei. Grillparzer hat derlei Schöpfungswut ins Herz getroffen:
Es will jetzt neu sein jeder Tropf Und kann nichts finden trotz allen Geschreies, Da stellt et das Alte auf den Kopf, Und hat so was Neues.
Das Volk? Vom Sportfieber müßten etliche Grade gesenkt werden. Dies mag auch im Interesse der Volksbildung vonnöten sein und auf diese kommt es doch wohl vor allem an, wo Menschen zusammen leben wollen.
Es muß noch einmal erwähnt sein: dies schreibt ein Mann der Feder, dem es versagt blieb, ein Großes daran zu finden, wenn einer dem andern im Boxring die Zähne ausschlägt, und der die Meinung vertritt, eine Lebensleistung beginne erst im Alltagsbemühen; doch mag sein Ich in diesem Punkt mit Scheuklappen versehen sein; zugegeben. Allein wir müssen uns alle darauf besinnen, daß es die schwerste Prüfung des Daseins ist, ein Leben der Mitte zu leben. Wir alle sind wie Züge, die aus dem Geleise springen wollen, in das Nichts, das Abenteuer, in die Gefahr hinein, in der Heldentum, Ruhm und die antflammten Sinne locken. Das ist die nackte, farbige, doch unsäglich flüchtige Seite des Lebens. Die andere heißt: sich bescheiden, über der Zeit wirken, und sei es im Unscheinbaren, Namenlosen. Denn alle Tiefe ist einfach. Aber in dieser Einfachheit ruht die Größe des Menschen und der Welt und das Geheimnis der Kunst, die an alle Seelen rührt. Sie Ist dem wirklichen Dichter gemäß.