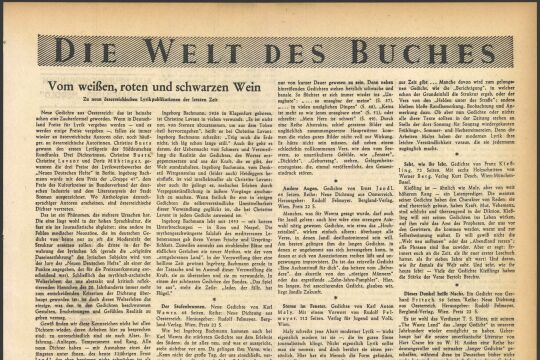Eine Dichtung über die Dichtung
„Mit ausgebreiteten Armen liegt er auf der Luft“. Daß es einmal so kommen mußte, war vorauszusehen; daß es jetzt so kompromißlos und ungeschminkt kommt, überrascht nun doch. Die Frage: wozu Dichter, wozu Dichtung, wie ein roter Faden zieht sich diese Frage durch Pionteks Werke. In seinem neuesten Roman „Dichterleben“ bohrt er sich in sie ein, quälend und faszinierend zugleich. Heinz Piontek ist Träger des angesehensten Literaturpreises Deutschlands, des Büchner-Preises, der ihm heuer verliehen wurde, gerade auch nach Kenntnisnahme dieses seines eben erschienenen Romans. Er hat es sich nie leicht gemacht. So kann man sich aufrichtig über die Preisverleihung freuen. Kein Links-um, kein Rechts-um machte er mit, seine Dichtung ließ sich auch nicht an die Kette des Erfolges legen. „Die Wahrheit finden. Das hatte schon immer eine Schwierigkeit nach der anderen hervorgerufen“, gesteht sich der „Held“ des Romans dort, wo es um die Wahrheit der Dichtung geht.
„Mit ausgebreiteten Armen liegt er auf der Luft“. Daß es einmal so kommen mußte, war vorauszusehen; daß es jetzt so kompromißlos und ungeschminkt kommt, überrascht nun doch. Die Frage: wozu Dichter, wozu Dichtung, wie ein roter Faden zieht sich diese Frage durch Pionteks Werke. In seinem neuesten Roman „Dichterleben“ bohrt er sich in sie ein, quälend und faszinierend zugleich. Heinz Piontek ist Träger des angesehensten Literaturpreises Deutschlands, des Büchner-Preises, der ihm heuer verliehen wurde, gerade auch nach Kenntnisnahme dieses seines eben erschienenen Romans. Er hat es sich nie leicht gemacht. So kann man sich aufrichtig über die Preisverleihung freuen. Kein Links-um, kein Rechts-um machte er mit, seine Dichtung ließ sich auch nicht an die Kette des Erfolges legen. „Die Wahrheit finden. Das hatte schon immer eine Schwierigkeit nach der anderen hervorgerufen“, gesteht sich der „Held“ des Romans dort, wo es um die Wahrheit der Dichtung geht.
Wozu Dichtung? Ist sie ein „Hauch um nichts“ (Rilke), „Unendlichspre-chung von lauter Vergeblichkeit und Umsonst“ (Celan)? Gottfried Benn ist sie Zeichen letzter, aber einsamer Größe des Menschen, Bert Brecht will mit ihr die Gesellschaft verändern. Robert Musil sucht mit Elementen der Dichtung (Intuition, Instinkt, Ekstase) über die Grenzen des Verstandes hinaus Handlungsfähigkeit des Menschen zu begründen, für Kafka heißt Dichten ,4ns Dunkel hineinschreiben wie in einen Tunnel, Schreiben als Form des Gebetes“. Piontek sieht in einem seiner schönsten Gedichte, „Schreiben“: „Möglichkeiten, die Häfen zu erreichen. Man setzt sein Leben aufs Spiel.“ „Klartext“ und „Tot oder lebendig“ sind die bezeichnenden Titel seiner beiden letzten Gedichtbände. Und im Roman tauchen nahezu wörtliche Zitate dieser seiner früheren Nachdenklichkeit auf, besonders aus dem „Selbstverhör“ und dem großen „Riederauer Gedicht“, das man in der Fortsetzung der lyrischen Reflexionen Von Rilkes „Dui-neser Elegien“ sehen möchte. Alle diese Themen und Namen, und noch andere, werden im Roman genannt (Goethe, Hölderlin und Ingeborg Bachmann, Peter Handke, Melodien alter Kirchenlieder und moderne Schlager, Luther und Bonhoeffer, Minnesänger, Barocklyrik, Enzensberger, Grass, Heissenbüttel, Adorno; Piontek ist ein ausgezeichneter Kenner der deutschen Literatur und würde sicher einen namhaften Germanisten abgeben).
Sich selbst ironisierend, führt er sich mit eigenen Titeln und Zitaten früherer literarischer Produktionen in den Roman ein. Seine Meisterschaft bewährt sich darin, daß das Ganze trotzdem ein Roman bleibt und nie zum Essay ausufert. Man würde auch fehlgehen, wollte man alles autobiographisch interpretieren, und doch sind wieder viele von den ihn bewegenden Grundproblemen vorhanden. Und noch eines wird man sagen müssen, um Mißverständnisse zu vermeiden, vor allem, wenn man sich im Tiefsten vom Romangeschehen ergreifen läßt, etwas, was Rilke seinem „Malte“ mitgab: „Ich muß streng davor warnen, in den Aufzeichnungen Analogien für das zu finden, was sie durchmachen; wer der Verlockung nachgibt und in diesem Buche parallel geht, muß notwendig abwärts kommen; erfreulich wird es wesentlich nur denen werden, die es gewissermaßen gegen den Strom zu lesen unternehmen.“
Zwei Hauptprobleme charakterisieren die Reflexionen im Roman: die Unausweichlichkeit des Todes, und wie Dichtung eine Antwort darauf zu „finden“ (nicht: zu „geben“) vermag. „Denn jedes Herz zerhackt zuletzt ein Spaten“, dieser nach August von Platen im Roman zitierte Vers steht für zentrale Gedankengänge, die in immer neuen Variationen das Thema der Kontingenz umkreisen. Wir kennen sie von Rilke, Trakl, Benn, aus Pionteks eigenem „Riederauer Gedicht“ (das hier wohl unter den „Wiepoldsteiner“ Strophen gemeint ist): was bleibt, wenn ich heute schon wegfiele; wer behält einen wirklichen Eindruck von mir zurück; was bedeuten meine Produktionen — alles leicht ersetzbare Namen. „Alles Nachlassen ist
am Ende ein Loslassen... Der Begriff des Älterwerdens ist eine Hypothese. Wir nehmen nur immer neue, dem Tod genehmere Formen an.“ Die Menschen: „wie ins Genick geschlagene Hasen“ (Biederauer Gedicht).
Was bedeutet angesichts dieser Tatsache Gedichte schreiben, ausgerechnet Gedichte? Die Starken meistern wenigstens „realistisch“ die paar Lebensjahre, die Schwachen setzen sich hin und schreiben melancholische Verse. Auf so einfache Formeln läßt sich jedoch die Dichtung nicht bringen, wenn sie sich auch gern so anbieten. Die Beschäftigung mit der Sprache ist keine Freizeitbeschäftigung für den Dichter, sondern „legitimiert“ ihn „vor allen, die vor ihm geschrieben haben oder mit ihm zugleich schreiben“, und „wenn er in dem, was er macht, ganz aufrichtig er selbst ist, kann ihn niemand einholen ... Nur eine Sprache kann uns noch helfen, die mit keinen Interessen verquickt ist, uns nicht isoliert oder verkauft.“ Nicht die Sprache der bequemen Staatsbürger, der liteari-schen Marktschreier, der Profitgeier, nur „hartumrandete Wörter, für die man sich Zeit nehmen könnte, um langsam über die Zeit hinauszuge-langen“, eben „Lebenszeitwörter“. Nur in der Sprache besitzt der Mensch sich selbst, seinen Nächsten und die Welt. Und zwar nicht in allgemeinen von Gesellschaft und Religion angebotenen Redensarten, hinter die man sich vor allen Problemen flüchtet, sondern in der eigenen, ganz verantworteten, authentischen Sprache. „Alles müssen wir übersetzen, alles, was wir sehen, schmecken, fühlen, hören, alles kann uns nur über das eigene Bewußtsein erreichen, das in keiner anderen Sprache aufgeht als der eigenen.“
Das klingt sehr schön, aber was hilft es? Was ist Sprache? Hauch um nichts? Oder Unendlichkeitspre-chung? Mit welchem Recht das eine oder das andere? Lebt in der Sprache etwas, was uns hilft, die Zeit überbrücken, dem Tod zu begegnen?
Achim Reichsfelder, Dichter und Zentralfigur des Romans, quält sich ab mit solchen Fragen: Wozu Dichter, ja wozu das ganze Menschenleben. „Bist du wirklich überzeugt, daß man mit dem Schreiben von Gedichten noch etwas ausrichten kann?“ Im jugendlichen Aufschwung war er berühmt geworden, hatte „glücklich“ geheiratet. Nun liegt er krank darnieder, geschieden (sogar zweimal), an sich selbst und seiner Wortsetzerei zweifelnd. Soll er. weiter — oder lieber Schluß machen? Auch seine erste Frau hatte die tödliche Eintönigkeit, Inhaltslosigkeit des bürgerlichen Lebens, dem Ersticken nahe, umfangen, sobald man einmal in den erwachsenen Hafen geordneter Verhältnisse gelandet war: wozu das tägliche Aufräumen, Kinder waschen, Geld verdienen? Ein junger Student, der Achim nachspürt, den Lethargischen in einer Dachkammer aufstöbert, an ihn noch glaubt, versucht ihn aufzurichten; doch Achim nennt es nur „Verführen“ zu etwas, was doch keinen Sinn mehr hat. Ihre Gespräche, die sich bei Bekannten, Literaten und Praktikern fortsetzen, in Selbstreflexio-
nen vertieft werden, gehen unerbittlich um das Thema der Sprache und ihres Sinnes. Dahinter die gleichen Fragen, die gleiche Nachdenklichkeit, vor die sich der Mensch in alten wie neuen Zeiten gestellt sieht, mit denen er sich, will er die Zeit nicht bloß totschlagen, konfrontiert weiß. Besonders der Dichter, der so „Nutzloses“ treibt, der Künstler überhaupt. Don Quijoterie das ganze? Don Quijote ist es dann auch, der die künstlerische, ja menschliche Existenz exemplifiziert. Hier „liegt der verkappte Triumph der Poesie, denn indem sie zugibt, daß ihre Un-
ternehmungen fehlschlagen, sie scheitern muß, überlebt sie in den Sätzen, die sie dafür zur Hand hat. Poesie der Poesie.., Von Zeit zu Zeit tauchen irgendwelche Quijadas in seinem Buch unter und setzen als frischgetaufte Quijotes ihre traurige Gestalt aufs Spiel. Abgewogene Worte stehen ihnen bei.“
Da mögen Zeiten kommen und gehen. Profit ist ihnen ein Fremdwort. Poesie kommt nicht aus dem Ungefähren. Poesie: ein anderes Bewußtsein. Was es mit der Welt auf sich hat, leuchtet auf neue Weise ein. Poesie als eine Wahrheit für sich. Er wird durch sein Verhalten klarstellen: Lanze um Lanze für sie brechen. Mit den nach innen gerichteten Augen umfängt er etwas, das ihn überleben wird. Und wenn es nur Worte sein sollten, der Mann auf dem heruntergekommenen Pferd ist bereit, sie zu erhärten, sein Leben zu riskieren. Keiner nimmt ihn für voll. Er gilt als hirnverbrannt. Was sollen die Regeln der Kunst, wenn doch im Leben andere Gesetze herrschen! Nur der Wahn unternimmt es, die Dinge umzudichten: „Das ist offenbar alles, was geboten wird. Poesie als Form des Widerwärtigen, Widerhaarigen. Freilich nicht denkbar ohne Lauterkeit, Grazie der Gedanken oder eine Haltung, mit der Schläge hingenommen werden, an Mißgeschicken nicht verzweifelt wird. Auch darf man nicht vergessen, daß Poesie hier nichts Selbstherrliches sein möchte. Worauf sie sich auch einläßt, immer geschieht es jemandem zuliebe. Jemandem mit dem Kosenamen Dulcinea. Wir wissen schon, es ist eine Umschreibung, ein Wort für ein anderes.“
Deutlicher wird Piontek nicht, Gott sei Dank. Im „Riederauer Gedicht“ spricht er davon, daß etwas von „Glauben“ in der Dichtung steckt. Hier heißt es: „Poesie ist nicht etwas, das sich nur in Büchern abspielt, sondern geradeso gut in der Welt namhaft gemacht werden kann, ja auch muß.“ Dahinter ist man wirklich auf einen „letzten Grund“ aus, muß die Hoffnung gestanden sein, mit diesem Schritt eine andere Distanz zu Menschen und Dingen zu erreichen. Oder so: „Jeder bewußte Autor verzichtet auf die naheliegende Sicht. Dafür nimmt er Unsicherheit, Einsamkeit, Verachtung in Kauf. Muß noch erwähnt werden, daß er weder Fanatiker noch Asket ist?“ Läßt sich mehr sagen vom Menschen? Wenn er sich nicht einfach den Bauch vollschlägt, wenn er etwas „glaubt“, ob als politisch
oder religiös Engagierter, als Sinnsuchender oder als Liebender, ein Don Quijote wird er sein, als Dichter die exemplarische pars pro toto. Ist er es nicht, kann er nur zum „Totschläger“ (Kafka) werden, der die Zeit totschlägt oder den Menschen in sich selbst und in den anderen. „Die Starken hatten alles und konnten auf alles pochen — nur nicht auf die Verheißungen. Das Schöne war die Stärke der Machtlosen.“ Poesie hat keine Macht, ihre Lanze ist die zerbrochene Don Quijotes. Solche Einsichten sind für Achim kurze Augenblicke, „Aufhebung des Unvereinbaren für Augenblicke“.
Die Misere zweifelnder und verzweifelnder Vergewisserung geht weiter. An einem Wintermorgen beginnt der Roman, an einem Winterabend endet er: Achim wird nach einem Abendspaziergang im Nebel („Nebelland hab ich gesehen und Nebelherz gegessen“, Ingeborg Bachmann) von Burschen, die ihn irrtümlich für einen anderen halten, mit Stahlruten, Fahrradketten, Fußtritten zusammenschlagen. „Die Ärzte glaubten, sie würden ihn durchbringen.“ Vorher hatte er sich noch in „Tagen des Lesens“ — „ganze Tage hinter den Büchern“ — große Dichtung, „die er bevorzugte“, vorgenommen. „In der Literatur gibt es keine eindeutigen Siege“, nur „Möglichkeiten, die Häfen zu erreichen, man setzt sein Leben aufs Spiel.“ • :■ y&'<“■-.v ' :->fi--' >■
Das Thema dieses Dichterlebens, mit dem Ton auf Leben, ist faszinierend, aber auch der Erzählstil des Romans. Weder Sprachexperiment noch tendenziöse Parole, weder geometrisches Fliesenlegen noch assoziatives Aneinanderreihen. Das Wort bleibt im Wort. Wahrheit der Poesie geht über den Begriff hinaus. Was hier herausgeschält wurde, ist eingebettet in das epische Geschehen eines Lebensberichtes. Moderne Erzähltechnik mit Ein- und Rücksendungen, mit ganz kurzen Absätzen zwischen seitenlangem Erzählen. „Alte Klarheit auf eine neue Weise.“ Kein Wort bleibt auf dem anderen. Alte gängige Klischees werden zerstört, neue Konstellationen bauen sich auf, von Wort zu Wort, von Satz zu Satz. Man wird gezwungen, auch vom Satzbau und' der Satzfolge her, immer wieder anzuhalten und nachzusinnen. Obwohl man schnell liest, kann man sie nicht, geistlos nur dem Ablauf der Handlung folgend, verschlingen. Man liest in gedrosselter Fahrt, mit Spannung durch Zeitlupe intensiviert. Die innere Intensität des Geschilderten geht auf den Leser über. Einzelne Worte, einzelne Sätze sind mit einer Fracht beladen, die man nur auskosten kann: „Einverständnis mit dem Konkreten“; „Diese Finsternis in der Herzhöhle“; „Deutsche Wintertage“; „Was zuletzt Schweigen heiße, sei nur unser Fallen aus einer Sprache in eine andere“. Es gibt eine Schwerkraft der Sätze, der man sich nicht entziehen kann, sagte einmal Kafka. Ungemein konzentriert beobachtete Naturvorgänge oder Situationsschilderungen, wie man sie aus den „Erzählungen“ kennt, mit ganz eigenen Wortprägungen, ohne gekonnt oder gewollt zu wirken, machen den Atem anhalten, lassen bei ihrer eigenwilligen Schönheit verweilen.
Keine leichte, auch keine erheiternde Lektüre, gewiß. Aber reinigend und befreiend zugleich. Was Rilke seinem „Malte“ mitgab, noch ergänzt wurde.
„Diese Aufzeichnungen, indem sie ein Maß an sehr angewachsene Leiden legen, deuten an, bis zu welcher Höhe die Seligkeit steigen könnte, die mit der Fülle dieser selben Kräfte zu leisten wäre.“ — Piontek sagt es in seinem Roman bescheidener: „Auf einer Kugel wie der Erde gebe es keine Endpunkte, die nicht zugleich auch Anfangspunkte sein könnten.“
DICHTERLEBEN, Roman von Heinz Piontek. Hoffmann und Campe, Hamburg, 318 Seiten, öS 215,60.—.