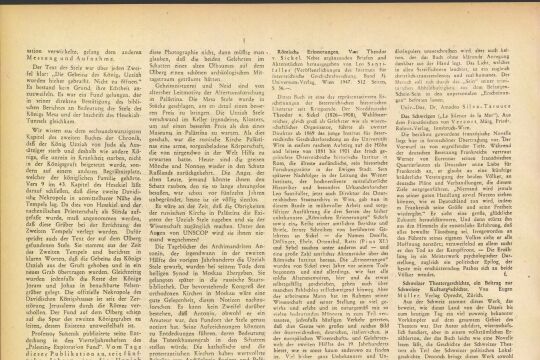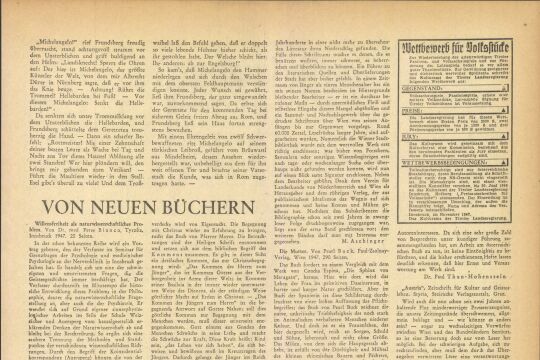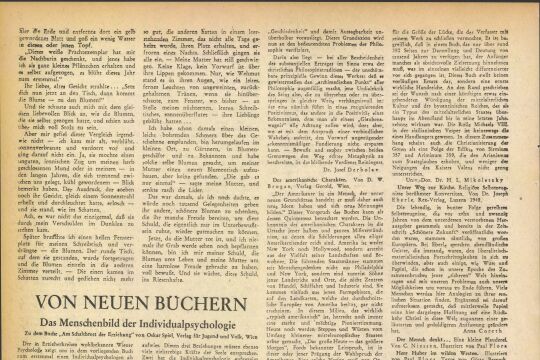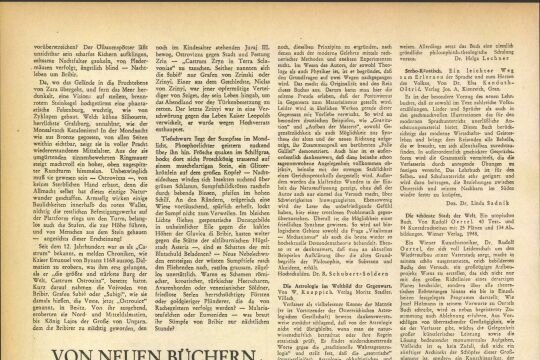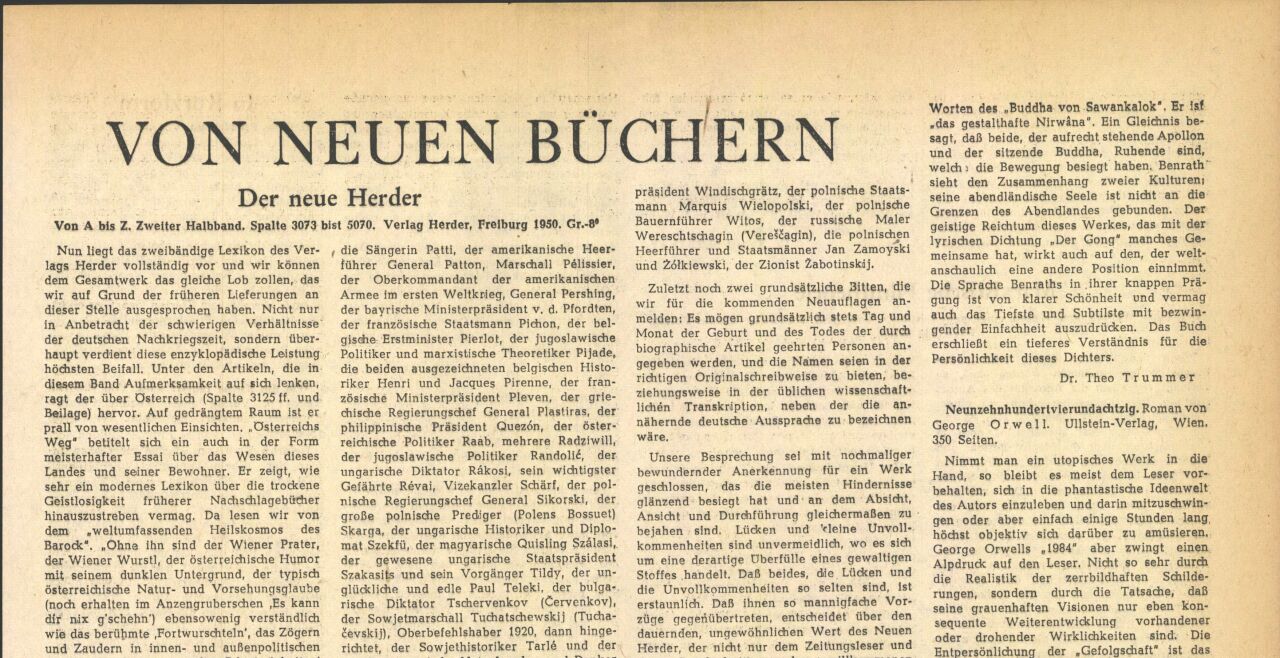
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wiener literarisches Echo
Vor uns liegen sieben Hefte einer Zeitschrift, deren weiterem Erscheinen man — nach der Lektüre der ersten Nummer — nicht ohne Sorge entgegensah; aus mancherlei Gründen, deren Erörterung sich heute erübrigt. — Es wäre vermessen, wollte man die fleißige und gewissenhafte Arbeit, die in diesen Heften steckt, die geisteswissenschaftlichen Fachkenntnisse der Autoren, ihren Mut und ihren Humor, mit einem höflichen Pauschallob abtun. Halten wir uns deshalb bei der Besprechung an die letzte Folge: das 3. Heft des 2. Jahrgangs. Den ersten Teil bilden zwei literarische Studien (über Grimms Märchen und über Plndar, Dante, Green) und ein kulturkritischer Essay über die Praxis der Buchbesprechungen in Zeitungen und Zeitschriften. Mit den Autoren der genannten Artikel (Theodor Schultz, Horst Rüdiger und Erwip Hartl) haben/wir bereits drei von dem Quartett kennengelernt, das von Rudolf Bayr /angeführt wird und Niveau, Lautstärke und Rhythmus des ganzen Ensembles bestimmt. Der Mitärbeiterkreis aller sieben Nummern ist eng gezogen; möge es so bleiben. (Einer von jeder Fakultät genügt!) Das bedingt keineswegs Monotonie, aber Konkordanz, und die Rechte weiß immer, was die Linke tut. Da man trotzdem nie das Gefühl der Gleichschaltung hat, bemerkt man: es handelt sich um einen Kreis Gleichgesinnter. Welches sind nun ihre Maßstäbe, ihre Grundsätze? Wir bedienen uns zur Charakterisierung eines Goethe-Wortes über den Feuilletonisten, das der ausgezeichnete Max“ Kalndl-Hönig in der gleichen Nummer zitiert: „Immer ist er über seinen Gegenstand erhaben und weiß uns eine heitere Ansicht des Ernstesten zu geben, bald unter dieser, bald unter jener Maske halb versteckt ... dabei immer froh, mehr oder weniger ironisch, durchaus tüchtig, rechtschaffen, wohlmeinend, ja manchmal derb und heftig, und dies alles so abgemessen, daß man zugleich den Geist, den Verstand, die Leichtigkeit, Gewandtheit, den Geschmack und Charakter dieses Schriftstellers bewundern muß.“ Die interessantesten und am schärfsten profilierten Beiträge stehen in der „Warte der Zeit“ und unter der Rubrik „Buchbesprechungen“. Man urteilt mit Fadikenntnis und Kompetenz, aber auch cum ira et studio. Unter völlig geänderten soziologischen Verhältnissen ist hier die Erbschaft der „Fackel“ von Karl Kraus angetreten. — An Stelle einer umständlichen Beschreibung des Stils der kritischen Glossen im „Wiener Literarischen Echo“ mag eine Probe stehen: Ein „geneigter Leser“ schreibt an den Dichter Karl Heinrich Waggerl, einen der Mitarbeiter der Zeitschrift: „Angeregt durch die vielen Hinweise habe ich mir das .Heitere Herbarium' gekauft. Nun, die Verse sind wirklich recht nett, aber die häufigen Anrufungen Gottes (acht!) beeinträchtigen den Genuß, wirken naiv kindlich. Heil! Graf S.“ Hierauf antwortet der belehrte Dichter: „Sehr geehrter Herr, es freut mich, daß auch Sie das H. H. recht nett finden. Was den lieben Gott betrifft, so mußte ich mich an ihn halten, weil es sonst niemand mehr gibt, der einen Spaß versteht. Gute Wünsche für ihr Heill Karl Heinrich Waggerl.“ Diese Korrespondenz kommentiert Edwin Hartl folgendermaßen: „.., Auf eine derart prosaische Zuschrift mit solcher Prosa zu reagieren! Unbeirrbare Künstlerschaft, die allen Zwist ästhetisch ordnet und selbst ein gewagtes ,Heil!' verwandelt, so daß der verstiegene Griiß auf einmal dasteht wie ein trauriges Marterl auf einen geistigen Unfall.“ An solchen Dingen erfreut sich, neben den ernsten, das Herz des Lesers in dieser humorlosen Zeit. Dies ist m i t einer der Gründe — neben viel ernsthafteren!—.weswegen man wünscht, daß dieses „Echo“ nicht ungehört verhallen oder gar verstummen möge!
Dr. Helmut Fiechtner
Unendlichkeit. Von Henry Benrath. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart. 144 Seiten.
Die beiden Prosawerke „Leukas Petrae“ und „Nirwana“, die der Band vereinigt, schlagen eine Brücke zwischen der apollinischen Geisteswelt und der des „Fernen Ostens“, wobei beide im überzeitlichen Sinn zu verstehen sind. Das erste Werk wird eingeleitet durch Deutungen von Leben und schöpferischer Tat unter dem Zeichen der „Katharsis“. In ihnen offenbart sich die äußerste Hingabe an die göttliche Berufung, die Einsicht in die strenge Notwendigkeit der Unterordnung des Lebens unter das Werk. An ein Zwiegespräch mit Apollon schließen sich als „Erleuchtungen“ die zu einer Dreiheit gegliederten deutenden und befehlenden Worte des Gottes. — Einen ähnlichen inneren Aufbau hat das andere Werk. Als Kronzeuge für die fernöstliche Seele spricht ein annamiti-scher Prinz. Der Dichter erkennt die im tiefsten Seinsgrunde bestehende Verbindung der hellenisch-apollinischen Haltung mit dem irrationalen indischen Lebensgefühl. Dies wird deutlich in der Erscheinung und in den
Worten des „Buddha von Sawankalok“. Er isf „das gestalthafte Nirwana“. Ein Gleichnis besagt, daß beide, der aufrecht stehende Apollon und der sitzende Buddha, Ruhende sind, welch: die Bewegung besiegt haben. Benrath“ sieht den Zusammenhang zweier Kulturen; seine abendländische Seele ist nicht an die Grenzen des Abendlandes gebunden. Der geistige Reichtum dieses Werkes, das mit der lyrischen Dichtung „Der Gong“ manches Gemeinsame hat, wirkt auch auf den, der weltanschaulich eine andere Position einnimmt. Die Sprache Benraths in ihrer knappen Prägung ist von klarer Schönheit und vermag auch das Tiefste und Subtilste mit bezwingender Einfachheit auszudrücken. Das Buch erschließt ein tieferes Verständnis für die Persönlichkeit dieses Dichters.
Dr. Theo Trümmer
Neunzehnhundertvlerundachtzlg. Roman von George O r w e 11. Ullstein-Verlag, Wien, 350 Seiten.
Nimmt man ein utopisches Werk in die Hand, so bleibt es meist dem Leser vorbehalten, sich in die phantastische Ideenwelt des Autors einzuleben und darin mitzuschwingen oder aber einfach einige Stunden lang höchst objektiv sich darüber zu amüsieren. George Orwells „1984“ aber zwingt einen Alpdruck auf den Leser. Nicht so sehr durch die Realistik der zerrbildhaften Schilderungen, sondern durch die Tatsache, daß seine grauenhaften Visionen nur eben konsequente Weiterentwicklung vorhandener oder drohender Wirklichkeiten sind. Die Entpersönlichung der „Gefolgschaft“ ist das Ziel jedes totalitären Regimes, wir haben es in den Anfängen kennengelernt. Und die meisten Menschen von heute merken es gar nicht einmal, wie wenig „Persönlichkeit“ sie heute noch sind, weil sie ihre Freiheit gar nicht mehr dazu nützen wollen, sich noch auf sich und ihr Stehen in der Welt zu besinnen. Der Mensch von heute denkt und handelt wirklich mehr als Masse denn als Einzelwesen. So wollen es aber die politischen Organisatoren und haben längst den Keim dazu in die Menschheit gelegt. Orwell will mit seiner politischen Satire ein Warnungsrufer sein. Er zeigt im Inferno eines totalitären Staates mit einem imaginären Oberhaupt kein krankhaftes Phantasieprodukt, sondern die endliche Auswirkung schon begonnener Tendenzen. Und das ist das Grauenhafte: daß diese Weiterentwicklung im Bereich des Möglichen liegt! Darum wirkt es auch so aufwühlend und erschütternd. Es fällt auf, daß für Orwell im Gegensatz zum aller-neuesten Zukunftsroman „Der achte Tag“ von Hermann Gohde die Kirche zu existieren aufgehört hat. Vielleicht nicht unwichtig, noch zu bemerken: „1984“ gehört keinesfalls in die Hand heranwachsender Jugend, vielmehr setzt dieses Werk einen reifen, gesetzten Leser voraus. Dr. Josefine G a n g 1
Der kleine Held. Roman von Walter v. Molo, österreichische Buchgemeinschaft, Wien.
In diesem Buch, das zum siebzigsten Geburtstag des bedeutenden deutschen Schriftstellers wieder erschienen ist, erzählt Walter v. Molo von den Jahren seiner Kindheit, die er in Wien verbracht hat. Vom Standpunkt eines heranreifenden Knaben aus sucht er Einblick in die Welt der Erwachsenen zu gewinnen, und wenn er auch nüchtern und sachlich von Erlebnissen und Begegnungen in der Schule und zur Ferienzeit berichtet, so ist doch das Geschehen gleichermaßen von einem herzerfrischenden Humor gewürzt und von schmerzlichen Erkenntnissen durchwoben, wie sie jedem, der nach Wahrheit und innerer Harmonie Verlangen trägt, nicht erspart bleiben, wenn es gilt, die Forderungen des Lebens zu erfüllen. Da all die mannigfachen Probleme von einem Dichter gestaltet wurden, ergibt sich ein reizvolles Mosaik der kleinen und großen Welt, dessen Zauber noch durch den verblassenden Glanz der Donaumonarchie erhöht wird.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!