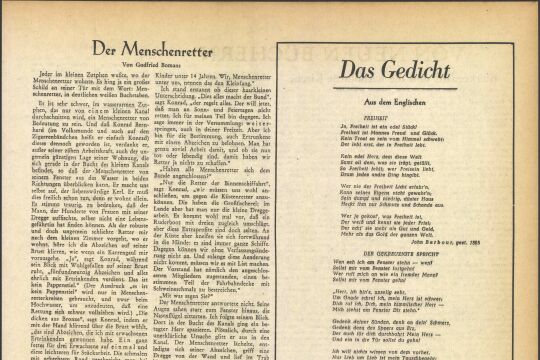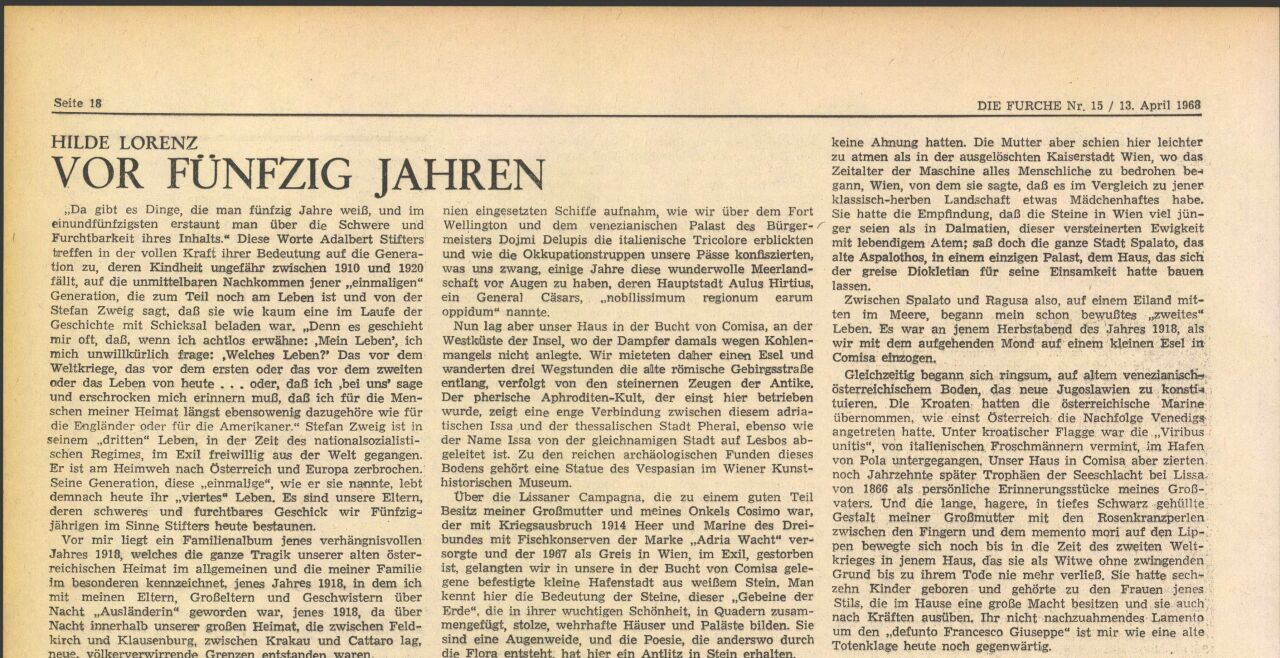
„Mein Herz hatte sich schon gefürchtet, ehe ich es wußte”, sagt die namenlose Heldin in Marlen Haushofers Roman „Die Wand”, den ich nicht zögere, als den besten nach 1945 entstandenen österreichischen Roman in der Erblinde Stifter zu bezeichnen. Er ist eine Dichtung über die Bewährung des Menschen in seiner größten Isolation. Daß der zurückgezogen lebenden Erforscherin, ja Visionärin geheimnisvoller Seelenräume gerade im Jahre des Erscheinens der „Wand” der Arthur-Schnitzler-Preis zuerkannt wurde, hat alle jene Leser, die um die Bedeutung Marlen Haushofers wissen, 1963 mit dem Gefühl so selten sich vollziehender Gerechtigkeit und Freude erfüllt.
Die 1920 im oberösterreichischen Frauenstein geborene Tochter des Revierförsters Heinrich Frauendorfer und seiner Frau Marie verlebte zehn glückliche Kinderjahre, deren stete Präsenz und Tiefe viele ihrer subtilen Erzählungen und den vor zwei Jahren erschienenen, schönsten, zartesten Roman einer Kindheit speisen: „Himmel, der nirgendwo endet”. Zwischen den Seiten, zwischen den Zeilen dieses Buches beginnt ein Mädchen, das noch mit dem Herzen denkt und mit dem Kopf fühlt, sich mit allen Sinnen diese unsere schöne schmerzende Welt zu erobern. Echtheit, Klarheit, äußerste Einfachheit bei größter innerer Dichte zeichnen auch die drei für Kinder geschriebenen Bücher der Haushofer aus. Nirgendwo werden Konzessionen gemacht, ergibt sich ein Niveauverlust, wie er gerade in der Jugendliteratur oft so übel zu vermerken ist (als ob nicht gerade die Heranwachsenden Anrecht auf das Beste hätten!). Das Katzenbuch „Bartls Abenteuer” ist zudem eines der vielen Zeugnisse der lebensbestimmenden Liebe der psychologisch erfahrenen Dichterin zu den Tieren. Dazu Frau Haushofer selbst — und man kann ihr Bekenntnis auf alles verstehen, was sie je geschrieben hat: „Jedes Wort darin ist wahr!”
Zurück zur Lebenstafel: 1930 kam Marie Helene in das Internat der Ursulinen nach Linz, mußte wegen Krankheit unterbrechen, maturierte und begann nach ihrer Arbeitsdienstzeit in Ostpreußen 1940 an der Universität Wien Germanistik zu studieren. 1941: Aufenthalte in München und Prag, 1942 Rückkehr nach Wien, 1943 Wiederaufnahme des Studiums in Graz; 1945 Flucht nach Frauenstedn und Abbruch des Studiums. Kurz darauf erscheinen die ersten Kurzgeschichten, die in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften abgedruckt werden. 1947 Übersiedlung nach Steyr. Der Ehe mit Dr. Manfred Haushofer entstammen zwei Söhne.
Die erste Buchpublikation war 1952 die Novelle „Das fünfte Jahr”. 1955 galt der Roman „Eine Handvoll Leben” bereits mehr als ein Versprechen, das mit der „Tapetentür” 1957 vollends eingelöst wurde. Dazwischen liegt der bewegende Erzählband „Die Vergißmeinichtquelle”, 1958 gefolgt von der wichtigen Novelle „Wir töten Stella”. Jetzt stehen wir knapp vor Erscheinen des jüngsten Erzählbandes der Haushofer: „Schreckliche Treue” im Frühjahr bei Claassen. (Auszeichnungen schon vor dem Schnitzler-Preis: 1953 Staatlicher Förderungspreis für Literatur, 1956 Preis des Theodor-Kör- ner-Stiftungsfonds.)
Mit Nachdruck zu verweisen ist auf den 1966 „Marien Haushofer” gewidmeten Band „Lebenslänglich”, in der Taschenbuchreihe des Stiasny-Verlages, den Oskar Jan Tauschinski vorzüglich ausgewählt und eingeleitet hat. Tauschinski, eng vertraut mit ihrem Werk, schreibt über die Arbeit Marlen Haushofers: „Ihre Seismographen registrieren die feinsten Erdstöße des Unheimlichen, Außermenschlichen in keine Ahnung hatten. Die Mutter aber schien hier leichter zu atmen als in der ausgelöschten Kaiserstadt Wien, wo das Zeitalter der Maschine alles Menschliche zu bedrohen be- gann, Wien, von dem sie sagte, daß es im Vergleich zu jener klassisch-herben Landschaft etwas Mädchenhaftes habe. Sie hatte die Empfindung, daß die Steine in Wien viel jünger seien als in Dalmatien, dieser versteinerten Ewigkeit mit lebendigem Atem; saß doch die ganze Stadt Spalato, das alte Aspalothos, in einem einzigen Palast, dem Haus, das sich der greise Diokletian für seine Einsamkeit hatte bauen lassen.
Zwischen Spalato und Ragusa also, auf einem Eiland mitten im Meere, begann mein schon bewußtes „zweites” Leben. Es war an jenem Herbstabend des Jahres 1918, als wir mit dem aufgehenden Mond auf einem kleinen Esel in Comisa einzogen.
Gleichzeitig begann sich ringsum, auf altem venezianisch- österreichischem Boden, das neue Jugoslawien zu konstituieren. Die Kroaten hatten die österreichische Marine übernommen, wie einst Österreich die Nachfolge Venedigs angetreten hatte. Unter kroatischer Flagge war die „Viribus unitis”, von italienischen Froschmännern vermint, im Hafen von Pola untergegangen. Unser Haus in Comisa aber zierten noch Jahrzehnte später Trophäen der Seeschlacht bei Lissa. von 1866 als persönliche Erinnerungsstücke meines Großvaters. Und die lange, hagere, in tiefes Schwarz gehüllte Gestalt meiner Großmutter mit den Rosenkranzperlen zwischen den Fingern und dem memento mori auf den Lippen bewegte sich noch bis in die Zeit des zweiten Weltkrieges in jenem Haus, das sie als Witwe ohne zwingenden Grund bis zu ihrem Tode nie mehr verließ. Sie hatte sechzehn Kinder geboren und gehörte zu den Frauen jenes Stils, die im Hause eine große Macht besitzen und sie auch nach Kräften ausüben. Ihr nicht nachzuahmendes Lamento um den „defunto Francesco Giuseppe” ist mir wie eine alte Totenklage heute noch gegenwärtig.
Es kann kein Zufall sein, daß die bedeutungsvollsten Stunden unseres Lebens in Bild und Schrift festgehalten werden. Vielleicht unterliegt dies einer Notwendigkeit, einem geheimen, glücklichen Gesetz der menschlichen Existenz, So fallen uns die Sternbilder unserer Vergangenheit, die schweigend bestehen, sich nie aufdrängen, Jahrzehnte später zu richtiger Zeit wieder in die Hand, um aufzuzeigen, wie manches Ereignis im Leben schon damals begonnen, sich schon damals angebahnt hat, freilich oft für uns noch unbewußt. Wir empfinden solche Gedenkstücke dann wie ein Kunstwerk, das wir nicht erst in seiner Vollendung kennen, sondern das uns durch das Wissen um sein Entstehen und Wachstum verständlich und kostbar geworden ist jedem Augenblick des Alltags, auch im außermenschlichen Geschehen.”
Ein Gespräch
FRAGE: Wann, Frau Haushofer, haben Sie zu schreiben begonnen?
ANTWORT: Geschrieben hab’ ich von meinem achten Jahr an bis zu meinem neunzehnten nur so für mich, Geschichten, Gedichte und sehr merkwürdige Romankapitel, die ich leider, wie so vieles aus dieser Zeit, verloren hab’. Während des Krieges dann keine Zeile. Erst 1946 hab’ ich wieder angefangen, und diesmal mit der Absicht, meine Geschichten anzubieten.
FRAGE: Wann, wo, durch wen geschah die erste Publikation?
ANTWORT: Damals gab es eine Aktion des Pen-Clubs zur Förderung neuer Talente. Hermann Hakel ist es dann auch wirklich gelungen, einige meiner Erzählungen in Zeitungen und Zeitschriften unterzubringen.
FRAGE: Kündigt sich ein neuer Plan schon früh an? Gehen Sie lang mit der Idee zu einer Erzählung, einem Roman, herum?
ANTWORT: Das ist ganz verschieden, Erzählungen schreibe ich meist rasch nieder, Romane gehen mir oft jahrelang im Kopf herum, ehe ich sie schreibe oder fallenlasse.
FRAGE: Und wie lange brauchen Sie zur Niederschrift selbst?
ANTWORT: Das ist schwer zu sagen bei meiner Arbęits- weise. Wenn man das Nachdenken, Notizenmachen usw. dazurechnet, arbeite ich vielleicht zwei oder drei Jahre an einem Roman. Nach der ersten Niederschrift — ich schreibe mit der Hand, weil mich das Geklapper der Maschine stört — kann ich nur mehr kleine Änderungen anbringen. Gefällt mir etwas gar nicht, verwerfe ich es und versuche nicht, es umzuschreiben.
FRAGE: Wie, wann, wo schreiben Sie? Regelmäßig? Zu einer gewissen Tageszeit? Eine gewisse Anzahl von Zeilen oder Seiten?
ANTWORT: Damit berühren Sie einen schmerzlichen Punkt. Lange Zeit hab’ ich am frühen Morgen geschrieben. Da aber mein Alltag als Hausfrau um halb sieben beginnt und ich nicht jünger werde, können Sie sich vorstellen, daß mein früher Morgen einfach zu früh wurde und ich den ganzen Tag aus dem Gähnen nicht herauskam. Seit ungefähr acht Jahren schreibe ich jetzt von drei bis sechs nachmittags.
Das ist zwar nicht die ideale Zeit und auch das ist nur möglich geworden, weil meine Kinder erwachsen sind und ich in diesen drei Stunden allein bin. Der Abend gehört der Familie. Da auch die Wochenende wegfallen und häufig nachmittags etwas Unaufschiebbares dazwischen kommt, bleiben mir zum Schreiben durchschnittlich drei Nachmittage. Seit Jahren nehme ich mir vor, regelmäßig zwei bis drei Seiten am Tag zu schreiben, bis heute ist es mir nicht gelungen. Meist wird dann doch wieder ein schubweises Schreiben daraus. Schuld daran ist, daß ich nur arbeiten kann, wenn ich ganz allein bin. Außerdem bin ich von Natur aus faul und daher gezwungen, von Zeit zu Zeit über meine Kräfte zu arbeiten.
FRAGE: Gibt es Vor- oder Leitbilder?
ANTWORT: Natürlich haben mich bewußt und unbewußt eine Menge Dichter beeinflußt. Ich hab’ aber gar kein Nachahmungstalent, und so glaube ich nicht, daß man von diesen Einflüssen viel in meinen Büchern bemerken kann. Um einige Lieblingsautoren zu nennen: Dickens, Tolstoi, überhaupt die Engländer und Russen. Von den Deutschen Heine und Kleist.
FRAGE: Haben Sie Beziehung zu jemandem. Schreibenden Ihrer Generation?
ANTWORT: Ich stehe in freundschaftlichen Beziehungen zu einigen meiner Kollegen und Kolleginnen, aber wir unterhalten uns eigentlich wenig über Literatur.
FRAGE: Gibt es eine Instanz, der Sie sich mit Neuem, noch vor der Öffentlichkeit, stellen?
ANTWORT: Ja, einige meiner Bücher hat Hans Weigel im Manuskript gelesen, aber er hat mir nie irgendwelche Änderungsvorschläge gemacht, sondern sie aus reiner Freundlichkeit durehgesehen und kleinere Fehler angekreuzt.
FRAGE: Wie schätzen Sie selbst das von Ihnen Geschriebene ein? Wo glauben Sie, daß Sie heute stehen?
ANTWORT: Das weiß ich nicht. Für mein Gefühl stehe ich bei jedem Buch an einem neuen Beginn, so als hätte ich noch nie geschrieben.
FRAGE: Was halten Sie für Ihr wesentlichstes Buch?
ANTWORT: „Die Wand”, und ich glaube nicht, daß mir ein solcher Wurf noch einmal gelingen wird, weil man einen derartigen Stoff wahrscheinlich nur einmal im Leben findet.
FRAGE: Was war das bisher Erfolgreichste?
ANTWORT: Auch „Die Wand”. Dieses Buch äst entweder begeistert gelobt worden oder auf äußerste Ablehnung gestoßen.
FRAGE: Inwieweit spielt Ihre eigene Erfahrung eine Rolle? Welchen Platz räumen Sie dem Autobiographischen ein?
ANTWORT: Ich schreibe niie über etwas anderes als über eigene Erfahrungen. Alle meine Personen sind Teile von mir, sozusagen abgespaltene Persönlichkeiten, die ich recht gut kenne. Kommt einmal eine mir wesensfremde Figur vor, versuche ich nie in sie einzudringen, sondern begnüge mich mit einer Beschreibung ihrer Erscheinung und ihrer Wirkung auf die Umwelt. — Ich bin der Ansicht, daß im weiteren Sinn alles, was ein Schriftsteller schreibt, autobiographisch ist.
FRAGE: Glauben Sie an die Veränderbarkeit der Welt durch den Schriftsteller?
ANTWORT: Ja, ich glaube daran, vielleicht nicht gerade heute oder morgen, aber irgendwann einmal wird wieder das Wort eines Dichters oder Denkers große Umwälzungen ausläsen. Daß dann immer etwas ganz anderes dabei herauskommt, wenn man diese Träume in die Tat umsetzt, ist eine besondere Ironie.
FRAGE: Gehen Sie von der Fabel, einer Figur, einer Örtlichkeit aus?
ANTWORT: Ich gehe nie von Fabeln aus, weil ich unfähig bin auch nur die einfachste Fabel zu erfinden. Meist gehe ich von Landschaften, Häusern, Steinen, Pflanzen und Tieren aus, häufig auch von Traumerlebnissen. Ich glaube, es ist eine meiner größten Schwächen, daß mich Menschen zuwenig interessieren. Ich brauche immer ziemlich lange Zeit, bis ich für meine Helden ein bißchen Sympathie aufbringe. Manchmal werden sie mir unterwegs langweilig und ich gebe sie auf. Aber noch nie ist mir ein Baum, ein Stein oder eine Landschaft langweilig geworden.
FRAGE: Wie oft folgen Sie einer Einladung zur Lesung eigener Werke, zu Tagungen, Diskussionen oder dergleichen?
ANTWORT: Ich bin wenig unterwegs, weil ich einfach keine Zeit habe viel zu reisen und weil ich mich nur daheim halbwegs wohlfühle. Da ich sehr ungern und nicht gut lese, bekomme ich heute, nach manchen Absagen von meiner Seite, kaum noch Einladungen zu Tagungen oder Lesungen.
FRAGE: Es fällt auf, daß Sie, im Gegensatz zu anderen österreichischen Autoren, bei in Deutschland gedruckten Büchern keinerlei sprachliche Konzessionen machen. War das beim Lektorat jeweils hart durchzukämpfen?
ANTWORT: Solange ich bed Sigbert Mohn war, ist das ganz wunderbar gegangen. Herr Mohn hat mir völlig freie Hand gelassen, und es hat nie Kämpfe gegeben. Leider besteht der Verlag ja nicht mehr und in Zukunft wird gerade dieses Problem für mich sehr schwierig werden.
FRAGE: In welchem Zeitraum sind die Erzählungen entstanden, die nun bei Claassen erscheinen werden?
ANTWORT: Mit zwei Ausnahmen in den letzten drei Jahren.
Dieses Gespräch wurde von Studio Kärnten des Österreichischen Rundfunks für die Reihe „Die literarische Werkstatt aufgenommen.