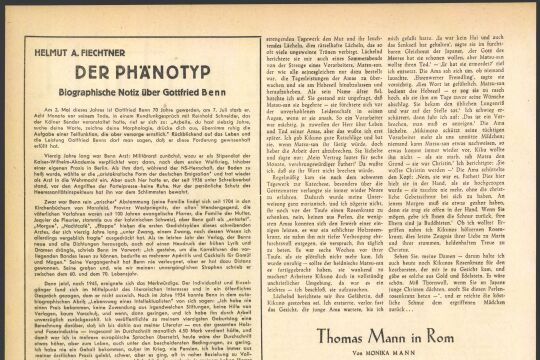Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von der Einsamkeit des Dichters
Der mondäne Badeort Knokke le Zoute, das belgische Biarritz, sah im Herbst dieses Jahres recht merkwürdigen Besuch: 200 Lyriker aus 30 Ländern hatten ihre Einsiedeleien verlassen und waren der Einladung des Organisationskomitees der „Rencontres Internationales de Poesie" gefolgt, um sich hier kennenzulernen und Fragen ihres Metiers zu besprechen. Von der „littėrature pure" und „engagėe" bis zu den Fragen der Metrik wurde alles diskutiert. Mit dieser vielstimmigen Symphonie, deren Ton und Tempo vor allem durch die wortgewandten und mitteilungsfreudigen Romanen bestimmt wurde, kontrastierte der ruhige, in französischer Sprache vorgetragene Monolog Gottfried Benns, der die deutsche De-
legation anführte. Diese Prosa-Arie des alten Expressionisten kündete von der Einsamkeit des Dichters und der Selbst-
genügsamkeit des Gedichts, das sich an niemanden wendet, von der Tragik des Künstlers, der sich keiner der Mächte verpflichten dürfe — und dessen Werk doch die Zeiten überdauert.
An Gottfried Benn richtete bald darauf in einer großen deutschen Tageszeitung Alexander Lernet-Hojenia eine „Aufforderung zum großenZwiegespräch", indem er, von der Position Nietzsches und seinem tragischen Scheitern ausgehend, das Recht der Nation, der Öffentlichkeit geltend machte, von ihren wirklichen Dichtern angeredet zu werden:
„Führen Sie nicht Monologe, die man ja doch abhört, entschließen Sie sich zur Ansprache, zu jenen großen Zwiegesprächen, auf denen alle wahre Dichtung, alle wahre Religiosität, aller wahre Geist gründet. Auch sie, diese Zwiegespräche, sind zuletzt Monologe, der größte vielleicht die Confessiones Augustins, in zwölf Büchern spricht er zu Gott, stundenlang, tagelang, das ganz Leben lang, und Gott antwortet mit keiner einzigep Silbe — aber denijodi hat er jemand, zu cįem er spricht und zu sprechen nicht aufhört, denn wenn das Ich alles ist, so ist auch das Du alles, und wahrscheinlich sind beide dasselbe ..."
Die Erwiderung Gottfried Bgnns auf diesen freundschaftlichen Appell mag manchen überrascht pdęr gar befremde haben. Aber sie iąt fjqpli Bepns Persönlichkeit, durch seine fpsitiqp und durch sein ganzes Werk będipgt. Zunächst das Persönliche:
„Ja also der gapzen Welt diesen Kuß, aber der Gemeinschaft gegenüber doch eine gewisse Reserve! Auch ist dies meiner Erfahrung nach eine Angelegenheit der Nerven und der Konstitution, auch der Ermüdbarkeit, ich habe in mehreren Büchern mir die etwas salpppe Bemerkung erlaubt: Ich big kein Mensfhenfeind, aber wenn Sie mich besuchen wollen, bitte kommen Sie pünktlich und bleiben Sie nicht zu lange, aber das ist nicht weltanschaulich gemeint, nifht misogyn. Ich sitze abends lieber allein in meinem Lokal, trinke, die Wände sind abgerückt, es ist mehr Kulisse da als in meiner Wohnung, das Radio spielt, erweitert noch die Szene, ich sehe die Dinge vor mir, lok- kerer, schattenvertiefter, manches verschlingt sich miteinander, meine Notizen rücken sich näher — auf was soll ich mich da noch beziehen? Publikum, Öffentlichkeit, Ruhm, Nation — alles ist irrelevant, in diesem Moment bin ich unsterblich.“
Das mag nun wirklich nicht „weltanschaulich" gemeint sein, aber in einem „Berliner Brief" aus dem Jahre 1948 („Ausdruckswelt", 1949) hat Benų sich noch deutlicher zu dem Thema geäußert:
„Ich habe es nicht unterlassen, die literarische Produktion der vergangenen drei Jahre auf mich wirken zu lassen und mein Eindruck ist folgender: Innerhalb des Abendlandes diskutiert seit vier Jahrzehnten dieselbe Gruppe von Köpfen über dieselbe Gruppe von Problemen mit derselben Gruppe von Argumenten und der Zuhilfenahme von derselben Gruppe von Kausal- und Konditionalsätzen und kommt zu derselben Gruppe von sei es Ergebnissen, die sie Synthese, sei es von Nicht- Ergebnissen, die sie dann Krise nennt, — das Ganze wirkt schon etwas abgespielt, wie ein bewährtes Libretto, es wirkt erstarrt und scholastisch, es wirkt wie eine Typik aus Kulisse und Staub. Ein Volk oder das Abendland, das sich erneuern möchte, und manches läßt darauf schließen, daß es sich auch noch erneuern könnte, ist mit dieser Methode nicht zu regenerieren ... Gegen diese Öffentlichkeit meine eigenen tragischen Gedanken halten, ist nicht mein Beruf. Ich trage meine Gedanken allein; zu ihrem Gesetz gehört, daß einer, de'r seine eigene innere Grenze überschreitet und ins Allgemeine möchte, unberufen, unexistentiell und peripher vor dieser Stunde erscheint. Ich trage auch die Einwände gegen się allein. Ästhetizismus, Isolationismus, Esoterismus — ,der Kranichzug der Geisti gen über dem Volk1 — in der Tat: für diesen Vogelzug bin ich spezialisierter Ornithologe, für diesen Zug, der niemanden verletzt, zu dem jeder aufblicken kann, nachblicken kann und ihm sein Träume übergeben... Und dann zielen sie auf einen Vorgang, der sich mir zu nähern scheint: das kommende Jahrhundert wird die Männerwelt in einen Zwang nehmen, vor eine Entscheidung stellen, vor der es kein Ausweichen und keine Emigration gibt, es wird nur noch zwei Typen, zwei Konstitutionen, zwei Reaktionsformen zulassen: diejenigen, die handeln und hochwollen, die Geschichtlichen und die Tiefen, Verbrecher und Mönche — und ich plädiere für die schwarzen Kutten.“
Der Pessimismus und scharfe Kritizismus Benns wurzelt tief und wurde durch die Umwelt und das persönliche Schicksal des Dichters noch verschärft. Benn stammt aus preußisch-brandenburgischer Landschaft und aus einem protestantischen Pfarrhaus. Das kalvinische Schweizertum der Mutter mag den radikalen Trieb zur Unabhängigkeit und Selbstverantwortlichkeit ebenso geschärft haben wie seine jahrelange Bindung an Berlin und dessep gespannte Geistigkeit. Benn studierte auf Wunsch seines Vaters zunächst Philosophie und Theologie, wandte sich aber dann den Naturwissenschaften zu. Auf der Kaiser-Wilhelm-Akademie wurde er zum Mediziner ausgebildet und erhielt dort den gesellschaftlichen Schliff im Stil des alfen Offizierskorps. Von der naturwissenschaftlich-medizipisdieu Schule blieb ihm die Kälte des Denkens, Nüchternheit, letzte Spiärfe der Begriffe, Bereithalten von Belegen für jedes Urteil, unerbittliche Kritik, Selbstkritik, mit einem Wort: die unerbittliche Härte des Objektiven. — Und auf der anderen Seite: die Unverständlichkeit, Dunkelheit und Rätselhaftigkeit des Lebens. Der Mensch erscheint den irrationalen Mächten gegenüber als hilflos, als Gefangener der eigenen Tiefe, die er in Rausch und Traum, im Fluten und Strornęn der Zeit und der wechselnden Bilder erlebt. Diesen tragischen Dualispips hat Benn in seinem Essay „Pallas" folgendermaßen gekennzeichnet: „Das, was lebt, ist etwas anderes als das, was denkt,' dies ist eine fundamentale Tatsache von hęųte und wir müssen uns mit ihr abfinden." Und in einer Mischung aus Hybris und Verzweiflung hebt er die Kunst als das einzig Unvergängliche auf den leeren Thron. In ihr sind die Zeit und die Geschichte ebenso aufgehoben wie die Kausalität. Gegen den Entwicklungs- und Fortschrittsglauben des XIX. Jahrhunderts setzt Benn sein statisches Weltbild (daher die Buchtitel: „Statische Gedichte“ und „Der Ptolemäer"). Es hat freilich nichts von klassischer Helle und Heiterkeit, sondern ist von dunkler Trauer durchflutet und im Tiefsten frag-würdig. „Aber etwas muß es doch geben, es ist doch etwas da, ein Innen, darin wandern wir doch ruhelos, immer hin und her, prüfen, überhören es, erhalten Weisungen — liegt es denn in mir, nein, etwas muß es doch geben!" so klagt einer der „Drei alten Männer" in dem gleichnamigen Gespräch. Dies ist auch die Frage, welche an die „Stimme hinter dem Vorhang" gerichtet wird, an den „Großen Vater", den Deus absconditus.
Aber es bleibt die Klage um das verlorene Ich und um entschwundene glücklichere Zeiten:
Adi, als sich alle einer Mitte nęigten,
und auch die Denker nur an Gott gedacht, sie sich den Hirten und dem Lamm verzweigten wenn aus dem Kelch das Blut sie rein gemacht und alle rannen aus der einen Wunde, brachen das Brot, das jeglicher genoß —, oh ferne zwingende erfüllte Stunde, die einst auch das verlorene Ich umschloß.
Am Ende des Antwortbriefes, von Gottfried Benns heißt es:
„Schließlich, lieber Herr Lernet, rufen Sie mich in wahrhaft brüderlicher Weise auf, doch zum Glauben hinzufinden, der für Sie das Gute ist, und zu Gott. Glaube, ich meine religiöser Glaube, ist aber, wie Sie wissen, ein Geschenk, man kann ihn nicht beziehen; und sich an ihn herankämpfen kann doch nur auch der, der das ipnere Bedürfnis danach hat. Ist nun aber ein Mensch, der dieses Bedürfnis nicht hat, völlig wertlos, abgehängt und rechnet unter die Versager? Ein Jesuitenpater, der die Freundlichkeit hatte, mir zu schreiben, sagte: Ein Mensch, der Gott so unabhängig und so in der Ferne sieht wie Sie, ist mir lieber, als einer, der sich immer so nahe auf ihn bezieht und alles mögliche von ihm erwartet. Ich füge hinzu: Niemand ist ohne Gott, das ist mensdienunmöglich, nur Narren halten sich für autochthon und selbstbestimmend ... Diese Distanz zu Gott, wie sie mir vorschwebt, ist eine reine Ehrfurcht vor dem großen Wesen. Ihn fortgesetzt mit Blicken und Lippen anzustarren, ist in meinen Augen ein großer Frevel, es setzt ja voraus, daß wir überhaupt für ihn etwas sind, während meine Ehrfurcht annimmt, er geht nur mit etwas, einem geringen Etwas, durch uns hindurch, und dann geht er auch zu etwas anderem. Auch zu diesem Thema könnten Sie in meinen Büchern Bekenntnisse solcher Art finden.“
Das letzte hören wir im Gespräch mit der „Stimme hinter dem Vorhang", die auch einmal ganz verschämt als „G..." bezeichnet wird. Ihr antwortet der Chorführer: „Im Dunkel leben, im Dunkel tun was wir können." Das ist vorläufig Gottfried Benns letztes Wort.
Der Briefwechsel zwischen Lernet-Holenia und Benn wurde in der „Neuen Zeitung", München, veröffentlicht. Alle Neuausgaben der Werke von G. Benn sind im Limes-Verlag, Wiesbaden, erschienen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!