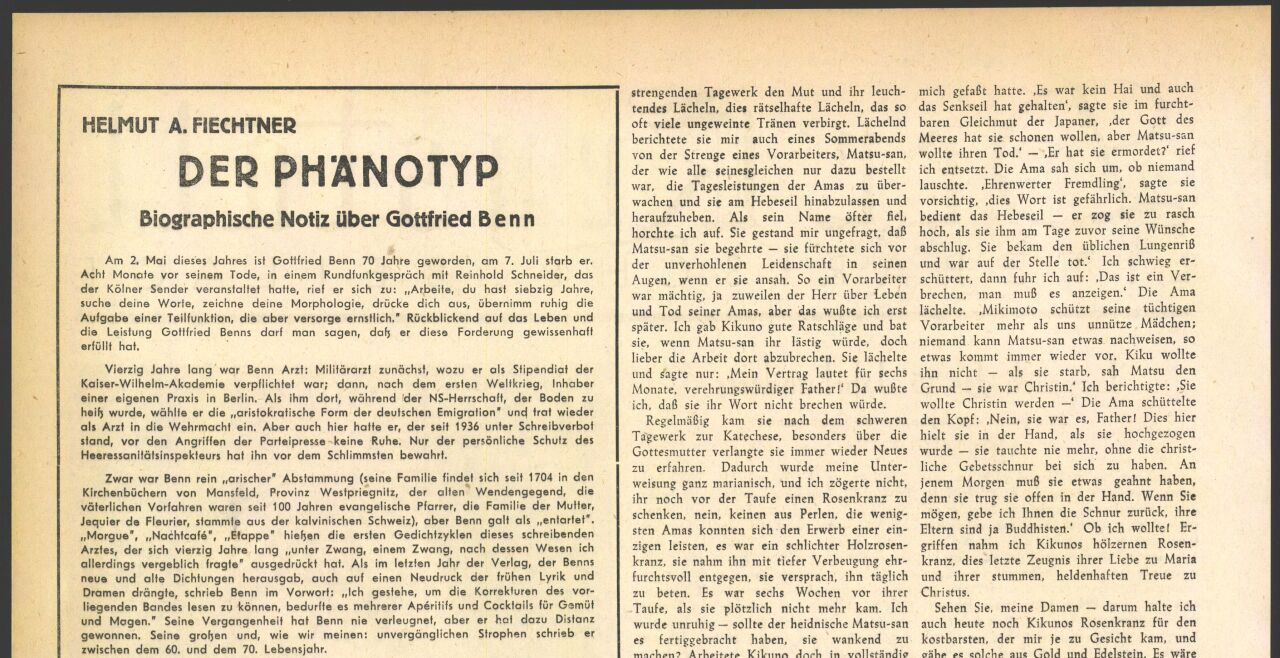
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
DER PHÄNOTYP
Am 2. Mai dieses Jahres ist Gottfried Benn 70 Jahre geworden, am 7. Juli starb er. Acht Monate vor seinem Tode, in einem Rundfunkgespräch mit Reinhold Schneider, das der Kölner Sender veranstaltet hatte, rief er sich zu: „Arbeite, du hast siebzig Jahre, suche deine Worte, zeichne deine Morphologie, drücke dich aus, übernimm ruhig die Aufgabe einer Teilfunktion, die aber versorge ernstlich.“ Rückblickend auf das Leben und die Leistung Gottfried Benns darf man sagen, dafj er diese Forderung gewissenhaft erfüllt hat.
Vierzig Jahre lang war Benn Arzt: Militärarzt zunächst, wozu er als Stipendiat der Kaiser-Wilhelm-Akademie verpflichtet war; dann, nach dem ersten Weltkrieg, Inhaber einer eigenen Praxis in Berlin. Als ihm dort, während der NS-Herrschaft, der Boden zu heifj wurde, wählte er die „aristokratische Form der deutschen Emigration“ una^ trat wieder als Arzt in die Wehrmacht ein. Aber auch hier hatte er, der seit 1936 unter Schreibverbot stand, vor den Angriffen der Parteipresse keine Ruhe. Nur der persönliche Schutz des Heeressanifätsinspekteurs hat ihn vor dem Schlimmsten bewahrt.
Zwar war Benn rein „arischer“ Abstammung (seine Familie findet sich seit 1704 in den Kirchenbüchern von Mansfeld, Provinz Westpriegnitz, der alten Wendengegend, die väterlichen Vorfahren waren seit 100 Jahren evangelische Pfarrer, die Familie der Mufter, Jequier de Fleurier, stammte aus der kalvinischen Schweiz), aber Benn galt als „entartet“. „Morgue“, „Nachtcafe“, „Etappe“ hiefjen die ersten Gedichtzyklen dieses schreibenden Arztes, der sich vierzig Jahre lang „unter Zwang, einem Zwang, nach dessen Wesen ich allerdings vergeblich fragte“ ausgedrückt hat. Als im letzten Jahr der Verlag, der Benns neue und alte Dichtungen herausgab, auch auf einen Neudruck der frühen Lyrik und Dramen drängte, schrieb Benn im Vorwort: „Ich gestehe, um die Korrekturen des vorliegenden Bandes lesen zu können, bedurfte es mehrerer Aperitifs und Cocktails für Gemüt und Magen.“ Seine Vergangenheit hat Benn nie verleugnet, aber er hat dazu Distanz gewonnen. Seine grohen und, wie wir meinen: unvergänglichen Strophen schrieb er zwischen dem 60. und dem 70. Lebensjahr.
Denn jetzt, nach 1945, ereignete sich das Merkwürdige. Der Individualist und Einzelgänger fand sich im Mittelpunkt des literarischen Interesses und in ein öffentliches Gespräch gezogen, dem er nicht auswich. Noch im Jahre 1934 konnte Benn in dem autobiographischen Abrifj „Lebensweg eines Infellekfualisfen' von sich sagen: „Ich habe nie einen Preis bekommen, keine Zuwendung aus irgendwelchen Stiftungen, keine Hilfe von Verlagen, kaum Vorschufj, und wenn, dann geringen, und ich habe ihn durch Arbeil unverzüglich zurückgezahlt. Ich veröffentlichte zu meinem vierzigsten Geburtstag eine Berechnung darüber, dafj ich bis dahin aus meiner Literatur — aus der gesamten Holz-und Faserindustrie — insgesamt im Durchschnitt monatlich 4.50 Mark verdient hätte, und damit war ich in mehrere europäische Sprachen übersetzt, heute wäre der Durchschnitt etwas höher, aber zum Leben, auch unter den bescheidensten Bedingungen, zu gering. Ich habe nie ein Gehalt bekommen, aufjer im Krieg, nie Pension, ich habe immer aus meiner ärztlichen Praxis gelebt, schwer, aber es ging, oft in naher Beziehung zu Voll-stieckungsbeamten, aber sie waren menschlich. Ich habe noch nie in meinem Leben länger als zwei bis drei Wochen im Jahr mich freimachen können für Ferien oder Arbeit, die meisten Jahre aber gar nicht.“
Das klinge, meint Benn, recht puritanisch, aber diese Lebensweise brachte ihm auch das Aeufjersfe von Luxus und Freiheit, das heute möglich ist: Freiheit vom Zwang der Gruppen, Vereine und Behörden, Unabhängigkeit von Presse und Literafurbetrieb. Auch noch den sechzigsten Geburtstag hoffte er, „ohne Bankelt und Blattpflanzen“ begehen zu können. Es sei, so meint er, provinzielle Unenfwickeltheit des Künstlers, zu erwarten, dafj sich die Oeffenflichkeit für ihn interessiert, ihn ökonomisch unterstützt. „Er wütet in sich herum — wer müfjte ihm das danken? Durchdenken Sie vielleicht auch, wieviel Egmonl- und Leonoren-Ouvertüren über den Stammpolifiker hinweggebrausf sind bei Eröffnungen und Fesfakten, ohne ihn verändert zu haben.“ Und Benn erinnert an das Wort Monets „II taut decourager les arts“. Das seien gesunde Ideen, denn man müfjte unterscheiden zwischen dem Kulturträger und dem Künstler. Der erstere pflegt, verarbeitet, baut an, verbreitet, ist für Kurse und Lehrgänge, glaubt an Entwicklung und Fortschritt, ist, mit einem Wort: horizontal gerichtet. — Der Kunstträger ist, statistisch beweisbar, asozial, an Flächenwirkung und Förderung der Kultur im allgemeinen uninteressiert. Er kennt nur sich und sein Werk, sein Material mufj er „kalt“ halten, er ist der neben dem Leben lebende, der prädisponierte Einzelgänger. (Diese Kennzeichnung des Künstlers wird im Werke Eenns unzählige Mal variiert.) Zwar versucht Benn seine These auch durch vielerlei historische Belege zu stützen. Aber wichtiger ist wohl, dafj er selbst so geartet war: „In Krieg und Frieden, in der Front und in der Etappe, als Offizier und als Arzt, zwischen Schiebern und Exzellenzen, vor Gummi- und Gefängniszellen, im Triumph und im Verfall verliefj mich die Trance nie, dafj es diese Wirklichkeit nicht gäbe.“
Nach Benns Stil, besonders dem der frühen Werke mit ihren abgehackten Sätzen und den hektischen Assoziationen, könnte man in Benn den Typus des nervösen, schlanken Intellektuellen vermuten. Aber der „Phänotyp“ war von anderer Art. In seinem Essay „Der Aufbau der Persönlichkeif“ unterscheidet Benn, in Uebereinstimmung mit dem dänischen Erbforscher Johannsen, zwischen „Phänotyp“ als Summe aller in einem einzelnen Individuum tatsächlich erscheinenden Wesenszüge, und dem weiteren, dahinterstehenden „Genotyp“, das isf die Summe aller aus einem bestimmten Stamm auslösbaren Wesenszüge und Eigenschaften. (Im „Roman des Phänotyps“ aus „Der Ptolemäer“ versucht Benn, aus unzähligen Einzelzügen, wie in einem Mosaik, ein Bild des heuligen Menschen zu entwerfen.) „Er hatte“, schreibt Thilo Koch, „ganz im Gegenteil etwas von der Gelassenheit eines leibesmächtigen Buddha“. Benn selbst sagt von sich, er sei nie ein gesellschaftlicher Matador gewesen; nur ungern ging er unter Menschen, besonders ungern auf Feste und andere gesellschaftliche Veranstaltungen. Der Grund: eine gehirnliche Schwere, Müdigkeit von hohen Graden, Widerstand gegen äufjere Eindrücke — vor allem: Einsamkeitsbedürfnis. „Kommen Sie pünktlich und bleiben Sie nicht zu lang“ — das war es, was er von unvermeidbaren Besuchern erwartete. So lebte er auch während der letzten zehn Jahre in Berlin: in einem kleinen Ordinationszimmer in Schöneberg, zwei schmale Fensler zum Hof, rings um ihn Posfberge, Manuskripte, ein Kofferradio, ein Mikroskop, einige Bücher, einige Arzneiflaschen, ein Tisch, ein Bett, ein Stuhl. Die Abende verbrachte er, um die Ecke, in einem durchschnittlichen Berliner Bierlokal. Dort stand sein zweiter Schreibtisch, dort isf vieles, wohl das meiste, von dem entstanden, was seinen späten Ruhm begründete.
Benn war, was die gesellschaftliche Wirkung der Literatur betrifft, äufjerst skeptisch, ja pessimistisch. Daher hat er die in dem bereits erwähnten Rundfunkgespräch gestellte Frage „Soll die Dichtung das Leben bessern?“ sehr zurückhaltend und eher negativ beantwortet. Seine Ausführungen, denen Reinhold Schneider vom Standpunkt des christlichen Dichters entgegnete, beschlofj Benn mit den folgenden Worten und einem Zitat: „Damit Sie sehen, wie ernst die Situation ist, der ich Ausdruck zu verleihen mich bemühe, schliefje ich mit einem Vers von Hebbel, in dem Sie auch das Wort hören, das meinem Stil fremd ist, das aber viele von Ihnen vielleicht erhoffen, es ist ein Vers aus dem Gedicht ,An die Jünglinge', er lautet:
Ja, es werde, spricht auch Gott, und sein Segen senkt sich still, denn er macht den nicht zum Spott, der sich selbst vollenden will.“
Bibliographie der Neuausgaben der Werke von Gottfried Benn im Limes-Verlag, Wiesbaden: Frühe Lyrik und Dramen. Fragmente. Destillationen. Apresludes (Neue Gedichte).
Frühe Prosa und Reden. Essays. Ausdruckswelt (Essays und Aphorismen), Doppelleben (Zwei Selbstdarstellungen), Der Ptolemäer, Probleme der Lyrik, Drei alle Männer. Die Stimme hinter dem Vorhang. Altern als Problem, für Künstler. Monologische Kunst (Ein Brielwechsel mit Alexander Lernet-Holenia). Soll die Dichtung das Leben bessern?
Im Verlag der Arche, Zürich, erschienen:
Goethe und die Naturwissenschaffen. Statische Gedichte. Gesammelte Gedichte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































