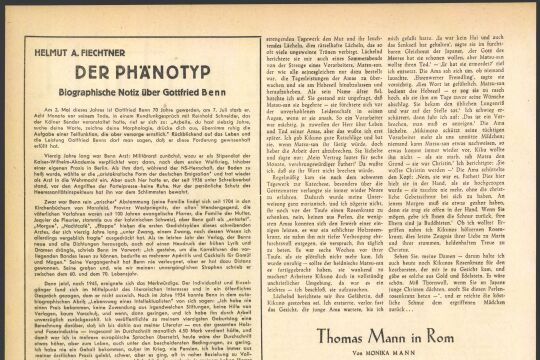Am 13. Dezember 1946 berichtet Dr. med. Gottfried Benn, Bozener Straße 20, Berlin-Schöneberg, seinem „Gentleman-Freund“ und „erlauchten Protektor“, dem Bremer Großkaufmann Friedrich Wilhelm Oelze, mit dem er seit 1932 in stetem Briefwechsel steht, von einer aufwühlenden Begegnung, die seinem Leben eine entscheidende Wendung gegeben hat.
Der zweifache Witwer, eben sechzig geworden, hat noch einmal geheiratet: „Ein Wesen von großem Reiz nach der menschlichen Seite hin.“ Dr. Ilse Kaul, 27 Jahre jünger als er, „hat eine groß? eigene zahnärztliche Praxis hier ganz in meiner Nähe .. .jeder macht am Tage seine Praxis, und abends reden wir zusammen ... Es ist diese neue Verbindung eine Für mich sehr schöne, aber natürlich von vornherein auch eine sehr ernste und melancholische... am erstaunlichsten, daß ich sie völlig als ebenbürtig empfinde ... Es ist von beiden Seiten eine ausgesprochene Liebesheirat.“
Was mag daraus werden? „Sie wird einiges lernen, einige innere und äußere Erfahrungen bei mir und durch mich sammeln, und dann wird sie weitergehen und meinen Namen noch eine Zeitlang tragen und die Erinnerung an mich bewahren, so lange sie es kann und mag.“
Wie so vieles von Bedeutung beginnt auch dies ganz banal. Um die fällige Lebensmittelkarte zu erhalten, braucht Ilse Kaul eine Typhus-Impfbescheinigung - so verlangt es eine Verfügung der Militärregierung. Auf dem Weg zu ihrer eigenen Ordination kommt sie täglich an einem Praxisschild vorbei, das sie in seiner lapidaren Strenge geheimnisvoll anzieht. Goldbüchstaben auf schwarzem Glas, mehr Gedenkstein als Orientierungshilfe:
Arzt / Dr. med. G. Benn /
11—12 und 5-6.
Wie wär’s, wenn sie hier wegen des leidigen Impfzertifikats vorspräche? Parterre rechts, die Sprechstundenhilfe führt sie ins Wartezimmer. Die Wände voller Bücher: Medizinisches, Geschichte, Philosophie, eine Menge Kant. Schließlich der Herr Kollege - ihr erster Eindruck: „Keine Spur von konzilianter Höflichkeit. Ein stummes Kopfnicken und eine Kehrtwendung, den langen Flur zurück in sein Sprechzimmer, ich hinter ihm her.“ Und vor allem dies: „Ich war betroffen von dem in Leid versteinerten Gesicht.“
-Auf einem Drehhocker mit wackeliger Sitzfläche nimmt die Patientin Platz. „Es tut mir leid, aber ich muß Ihnen das Zeug einspritzen: Es ist Vorschrift, und wir haben ja auch wirklich einige böse Typhusfälle gehabt.“
Dann die Bescheinigung. Geburtsdatum, Geburtsort.
„Fürstenfeld bei Küstrin? Da kennen Sie womöglich auch Sellin - dort bin ich aufgewachsen.“
Natürlich - die beiden Ortschaften sind nur wenige Kilometer voneinander, entfernt. Man hat also die gleiche Heimat.
Weitere Gemeinsamkeiten: der Arztberuf und - die Literatur. Die Patientin trägt eine Lyrik-Anthologie bei sich, die sie gerade in einem Tauschladen ergattert hat - sie ahnt nicht, daß der Mann, dem sie da von Werfel- und i Dehmel-Gedichten vorschwärmt, einmal selber ein berühmter Lyriker gewesen ist. Ob er es eines Tages wieder sein wird?
Jetzt ist er nur Arzt. Das Schreibverbot, das die NS-Behörden über den einstigen Hitler-Sympathisanten verhängt haben, gilt weiter - bloß mit umgekehrtem Vorzeichen.
Zwei Tage darauf, bei einem Abendessen in seiner Wohnung - Kohlsuppe, Pflaumenkompott und Nescafe -, gibt er sich seiner Landsmännin und Kollegin zu erkennen: Aus einem Wandschrank holt Benn ein Bändchen „Aus gewählte Gedichte“ aus dem Jahr 1936 hervor und gibt es ihr mit.
Sechs Wochen später sind die beiden miteinander verheiratet. In der Arztetage Bozener Straße 20 praktizieren nun zwei: gemeinsames Wartezimmer, getrennte Sprechzimmer. Beide von neun bis halbeins und von drei bis sieben. Und dann, am Abend, das „anderė“ Leben - beginnend mit dem Spaziergang durch die Kufsteiner Straße, am RIAS vorbei, zum Schöneberger Stadtpark.
Die Freunde: Renee Sintenis, Heinz und Änne Ullstein, Leonarda Ringel- natz. Das allmähliche Wiederaufleben der seit Jahren stilliegenden literarischen Produktion, die ersten Verlegerbesuche, die Heimkehr der alten Freunde aus der Emigration: Ludwig Marcuse, Thea Sternheim, Gertrud Hindemith, George Grosz.
An den praxisfreien Mittwochnachmittagen der Schriftstellernachwuchs: Holthusen, Hagelstange, Hollerer, Bender, Boehlich - am liebsten in der Bierkneipe: Dort kann Benn selber den Zeitpunkt des Aufbruchs bestimmen. Denn noch ist die Post zu erledigen, und ihrer wird von Tag zu Tag mehr.
Mit dem nunmehr einsetzenden Ruhm nimmt die Zahl der Einsender zu, die sich von Gottfried Benn Begutachtung und Förderung ihrer eigenen Sch reib versuche erhoffen. Viele muß er enttäuschen: die einen, weil er ihnen seine schonungslose Kritik an den Manuskriptrand schreibt, die anderen, weil er auf ihre Elaborate gar nicht erst reagiert.
„Einer der Gründe, warum ich dich geheiratet habe, war, daß du mir die Leute vom Leib hältst,“ sagt er zu seiner Frau, die nun, wie er später in seinem autobiographischen Werk „Doppelleben“ rühmen wird, „mit zarter und kluger Hand die Stunden und die Schritte und in den Vasen die Astern ordnet“.
Von Gottfried Benns drei Ehen wird diese - entgegen den Warnungen eines Arztkollegen: „Wissen Sie denn nicht, daß der X Frauen auf dem Gewissen hat?“ - nicht nur die' dauerhafteste, sondern auch die engste und die seiner literarischen Arbeit zuträglichste. Die Schauspielerin Eva Brandt, die er 1914 heiratet und die ihm die Tochter Nele schenkt, stirbt nach acht Jahren an den Folgen einer Gallenblasenoperation: Herta von Wedemeyer, die 1938 in sein Leben tritt, begeht, durch die Kriegswirrnisse von ihrem Mann getrennt, im Sommer 1945 Selbstmord.
Ilse Kaul weicht bis an sein Lebensende nicht von seiner Seite: Die Schwestern des Krankenhauses, in dem er - Sommer 1956 - seine letzten Stunden zubringt (es ist auch das Todesjahr von Brecht und Carossa), haben ihr einen Liegestuhl neben das Sterbebett gestellt, über ihrem grauen Kostüm trägt sie seinen Bademantel, das blaue Nachtlicht ist auf ganz schwach geschaltet. Gottfried Benn, bis zuletzt bei vollem Bewußtsein, ringt sich von Zeit zu Zeit einen Satz ab - irgendwann auch den für ihr künftiges Selbstgefühl entscheidenden:
„Du wirst bestimmt alles richtig machen ...“ Dann, beim ersten Morgengrauen, die Worte: „Bitte, mach das Fenster auf...“ Und schließlich sein allerletzter Wunsch: „Eine Nonne-ich möchte eine Nonne sehen ...“ Er meint damit jenes andere, ihm vertraute Krankenhaus, in das er hofft, zurückverlegt zu werden. Aber dafür ist es zu spät: Noch vor der Morgenvisite tritt der Tod ein.
Benns Sterbezimmer füllt sich mit Ärzten, „Zelebritäts-Odalisken“ hat er sich selber einmal mokiert: Jeder will dabeigewesen sein. Will berichten kön-’ nen, wie das Gesicht des Verstorbenen von einem Augenblick zum andern bis zur Unkenntlichkeit verfällt und wie es sich Stunden später aufs wundersamste wieder erholt, so daß dem damit be trauten Künstler schließlich doch noch eine seiner schönsten Totenmasken gelingt.
Als Ilse Benn gegen Mittag, vom Beerdigungsinstitut zurückkehrend, wieder in der Bozener Straße eintrifft, drängen sich dort schon die Kondolen- ten, häufen sich die Blumengrüße, läutet das Telefon Sturm: das Radio hat bereits die Todesnachricht gesendet.
Der Dahlemer Waldfriedhof, wo Gottfried Benn nach christlichem Ritus bestattet wird (manche Puristen hätten es lieber gesehen, wenn der Leichnam verbrannt und die Asche ^stilgerecht“ in alte Nescafe-Dosen gefüllt worden wäre), ist das letzte, was die Witwe nun noch in Berlin hält. Jeden Tag fährt sie ans Grab: die eine Strecke mit dem Taxi, die andere mit dem Bus. Es macht ihr nichts aus, wenn sie der Schmerz übermannt, wenn sie vor den anderen Fahrgästen unvermittelt in Tränen ausbricht.
Aber der Zustand der Depression hält an: Auch die Freunde liegen in Dahlem begraben - Renėe Sintenis, Karl Hofer, die Ullsteins. Der Waldfriedhof wird für sie zum Symbol alles dessen, was sie geliebt, alles dessen, was sie verloren hat.
Noch drei Jahre, und Ilse Benn weiß: Wenn sie nicht vollends schwermütig werden will, muß sie hier weg. Weg von Berlin. Etwas möglichst Entlegenes soll es sein. Bernhausen in Württemberg heißt die erste Station, später folgt Wolfschlugen. Und hier, jenseits der Stuttgarter Telefongrenze, kauft sie sich an. Sie nennt es „Auswanderung“, manchmal auch „Witwenverbrennung“.
In schöner Naivität hofft sie, unerkannt zu bleiben. In Ruhe ihre Zahnpraxis betreiben und in der verbleibenden Zeit das ihr übertragene Dichtererbe verwalten zu können. Doch der Benn-Kult hat solche Ausmaße erreicht, daß man sie natürlich auch hier ausfindig macht.
Auf die Germanisten folgen die Mediziner: Auch sie drängt es, dem Dichter-Arzt, mit dem sie den einen seiner beiden Berufe teilen, zu huldigen. Als ich mich mit Ilse Benn treffe, kommt sie gerade von einer Ärztetagung in Berlin zurück, mit der eine ausgezeichnete Benn-Gedächtnisausstellung einhergegangen ist: Rezeptformulare neben Gedichthandschriften, das Praxisschild neben der Büchnerpreis-Ur- kunde, die medizinischen Schriften neben den literarischen.
Hier, im Grenzgebiet von Kunst und Wissenschaft, fühlt sich auch Ilse Benn am wohlsten: Keinem der gestrengen literarischen Magazine vertraut sie ihre Studie „Mein Mann Gottfried Benn“ an, sondern der Hauszeitschrift eines Arzneimittelkonzerns.
Dabei spürt man durchaus die talentierte Feder des verhinderten Profis: Ilse Kaul hatte als junges Mädchen, bevor sie sich dem Medizinstudium zuwandte, eine Zeit lang den festen Wunsch, Schriftstellerin zu werden. Die Redakteure der „Grünen Mark“ wüßten ein Lied davon zu singen: Sie wurden - unter Pseudonym, versteht sich - mit Manuskripten der Debütantin bombardiert, und eines davon, „Die Ruderfahrt“, haben sie sogar irgendwann abgedruckt.
Als Ilse Benn 1959, drei Jahre nach dem Tod des Dichters, den Sprung von Berlin nach Württemberg wagt und dafür sogar all die Strapazen eines DDR- Transits (zum Beispiel: siebenfach ausgefertigte Listen sämtlicher Bücher), in Kauf nimmt, hat sie vor, sich zumindest für die Dauer eines Jahres ausschließlich der anstehenden literarischen Arbeit zu widmen.
Doch sie wird viel früher rückfällig: Schon nach wenigen Monaten fehlt ihr das Klingeln der Patienten an der Tür, sie nimmt die Arbeit am Behandlungsstuhl wieder auf, die Pflege des Benn- Erbes wird in die praxisfreien Stunden verlegt. Fällt es ihr nicht sogar heute, wo sie sich mittlerweile für den Ruhestand entschieden hat, schwer, sich vom vertrauten Inventar des Sprechzimmers zu trennen - und das umso mehr, als sich diesem Inventar im Lauf der Jahre auch so manches Erinnerungsstück aus der Praxis ihre Mannes eingefügt hat: Bestrahlungslampe, Sessel, Instrumentenschrank.
Eine Etage höher, in der Dachmansarde, verdichtet sich’s: Benn pur. In der alten Kredenz aus Berliner Zeiten, säuberlich katalogisiert, der Großteil der Briefe, daneben das einfache Stahl- rohrßett, an dem der Dichter bis zuletzt festhielt.
Wir kommen auf dies und das zu sprechen: auf das wiederholt lautgewordene Rauschgiftgeraune (Ilse Benn: „Kein Wort wahr! Schlafmittel und Pyramidon - sonst nichts!“); auf den Benn-Biographen Walter Lennig, der die Unnahbarkeit seines Studienobjekts überwand, indem er sich - als Patient - in Ilse Benns Zahnpraxis einschlich und sich ihrer Komplizenschaft versicherte; auf die schwärmerischen Bekundungen einer sechzehnjährigen Besucherin, sie sei in ihrem Schullesebuch soeben auf Benn gestoßen (Ilse Benn: „Viel zu früh! Außerdem ist diese Art Literatur einfach nicht popularisierbar!“); auf die Auswüchse des Benn-Kults (sechsundzwanzigjähriger Medizinstudent nimmt sich zwei Tage nach dem Tod des Dichters das Leben); und auf jene Nachbarortschaft Benningen, die der Witwe einen Moment lang als verlockender Alterssitz erscheint, bis sie sich zuguterletzt, Benns heftige Abneigung gegen alles Anekdotische bedenkend, doch für das indifferentere Wolfschlugen entscheidet.
Indifferent? Die Schwaben haben ein erklärtes Nahverhältnis zur Literatur: keine Ortschaft ohne Hölderlin-, ohne Mörikestraße. Ilse Benns Haus steht in der Hauffstraße. Bei guter Führung wird sie also wohl damit rechnen müssen, daß es hier eines Tages auch eine Benn-Straße geben wird.
Aus dem Buch „Musen leben länger“ von Dietmar Grieser. das demnächst im Langen-Müller-Verlag erscheinen wird.