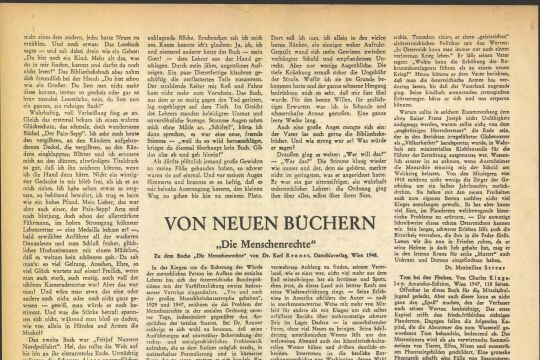Jeder Film hat zwei Väter: Gesinnung und Witterung. Die Väter eines der bedeutendsten österreichi-chen Nachkriegsfilme, „Der letzte A k t“, sind ein Regisseur, dessen künstlerischer Rang ebenso wie leine lautere, irgendwie als links tendierend zu bezeichnende Gesinnung außer Zweifel steht, und ein junger österreichischer Manager, in dessen Grammatik die drei Steigerungsstufen heißen: Polster, Polsterer, lauter Gold. (Unleugbar lauter auch am Rande die Tat, die ein dritter Mann, der Produzent des Films, im letzten Akt der tapferen Wiener Resistance vor zehn Jahren gesetzt hat.) Alles lauter also, lauter Lauterkeiten.
Merkwürdig: und doch stimmt da etwas nicht. *
Halten wir vorerst die unleugbaren Vorzüge des Films fest.
Aus dem Munde des sterbenden jungen Haupt-mannes-Ritterkreuzträgers, der im Bunker der Reichskanzlei beim Führer persönlich Verstärkung für eine Himmelfahrtsarmee holen soll und bei einer (übrigens völlig unglaubwürdigen) Attacke auf den Führer von dessen Leibgarde erschossen wird, erfahren wir die nicht eben abundanter Weisheit volle, aber grundanständige Moral der Geschieht': Seid wachsam und kritisch. („Nicht mehr Jawolllll sagen: damit hat der ganze Mist angefangen!“) Die Handlung, ein Schulbeispiel von Einheit der Zeit und des Schauplatzes, fängt das szenenreiche Drama des Dritten Reiches und seines Führers in den letzten Akt, die Tage vom letzten Geburtstag bis zum Tode Hitlers, wie in einen Brennspiegel zusammen. Es sind die Tage, da in dem unheimlichen Manne hektisch aufschießende letzte Hoffnungen auf den Tod Roosevelts, auf die befohlenen Entlastungsoffensiven nicht mehr existierender oder schon resistierender deutscher Verbände blitzschnell mit tiefen Depressionen und manischen Wutausfällen gegen „Verräter“ und „Deserteure“, Göring, Himmler, Fegelein, die „schlappen“ Generale, Armee und SS wechselten.
Das alles ist, von seriösen literarischen Quellen gespeist und von verläßlichen Zeugen beraten, exakt nachgebildet und kaum an einem entscheidenden Punkt der äußeren Vorgänge ernsthaft anzufechten. Da schier unlösbare Problem der Maskentreue ist stellenweise bis an die Grenze des Menschenmöglichen vorgetrieben, im Endeffekt allerdings, wie nicht anders zu erwarten war, nur von wechselndem Erfolg gekrönt; Hitler in einigen Einstellungen von beklemmender Aehnlichkeit, dann wieder überraschend fremd; Goebbels scharfliniertes Asketenprofil zu schwammig weich und die Synchronstimme zu kantoral, andere wieder mehr, andere weniger geglückt. (Am Rande vermerkt: Das Burgtheaterdeutsch mehrerer Darsteller mußte in München auf ein bellendes Neuhochpreußisch umsynchronisiert werden — ein „Unternehmen Michael“, das der Naturtreue des Films ohne Zweifel zustatten gekommen ist, im Grunde aber doch in der Geschichte der deutschen Sprache ein Kapitel von erschütternder Tragikomik darstellt.) Regie, Darsteller, Kamera gaben Bestes.' Albin Skodas Hitler ist eine Maskenstudie von dämonischer Eindringlichkeit, in der Gestik dagegen (siehe weiter unten), ist er stellenweise deutlich überspielt. Geschlossener, freilich auch dankbarer, weil nicht im ständigen Ringkampf mit der historischen Silhouette, ist die frei erfundene Rolle des Hauptmanns Wüst, dem Oskar Werner, in jeder Sekunde intuitiv und bewußt-beherrscht zugleich, die charakteristischen Züge seines fahrig-nervösen modernen Hamlet-Typs aufprägt. Den grausigen Szenen der Ueberflutung der S-Bahn-Schächte ist ihre illegitime Abkunft von den heilsamen Schwefelquellen des Badner Strandbades fast nicht anzumerken. Alles in allem: ein Film von vollendeter Technik und meisterlicher Handwerklichkeit.' Rühmenswert die Namen-losigkeit des Titelvorspannes, wie überhaupt die Publicity um den Film um wohltuende Zurückhaltung bemüht ist.
Die Einwände beginnen beim Drehbuch, das, wie man hört, von den Protokollen des amerikanischen Richters Musmano und der Filmnovelle Erich Maria Remarques über nicht wenige fremde Bearbeitungen bis zur Endfassung des Drehbuches durch Fritz Habeck zahlreiche Stationen durchlaufen hat, in denen sich vermutlich manche hohe Inspiration eine schroffe Tiefkühlung durch Routine gefallen lassen mußte. (Die verwundete literarische Ehre der dabei Getroffenen soll, wie man weiter hört, durch Entschädigungen von mäzenatischer Großzügigkeit wiederhergestellt worden sein.) Diese fremden Elemente konnten nichtsdestoweniger nur mangelhaft miteinander verschmelzen. Sie sündigen übrigens brüderlich vereint ausgiebig gegen die Authentizität und Dokumentärst, die allein einer solchen „story“ frommte. Der Einwand, daß eben der Vorgang nicht wiederholbar, die Toten nicht auferstehen und ihr Spiel da capo spielen können, gilt nur bis zu einem gewissen Grade: ein deutscher reiner Dokumentarfilm ungefähr desselben Themas im Vorjahr hat gezeigt, daß die toten Menschen und vielsagenden Dinge im Film sehr wohl „auferstehen“ können!
G. W. Pabst aber macht in seinem unentschlossenen Schwanken zwischen Historismus und Feuilleto-nismus denselben Fehler wie seinerzeit Ernst Lothar, der seinen geschichtlichen Schutz-Engel mit der Posaune niederschrie. Wie es dort Stilbruch war, den Mord an Dollfuß (richtiger Name) von einem jungen Mann namens Müller oder Meier begehen zu lassen, so ist es hier Stilbruch, Schulter an Schulter mit Adolf Hitler und Josef Goebbels die Phantasiegeschöpfe von Romanciers, Novellisten und Journalisten aufmarschieren zu lassen.
So fällt in diesem Film gerade das aus dem Rahmen, worin er seine Klaue zeigt: die ungeschicht-licheE Fleißaufgaben (das „Remarkige“ und „Päpstlichere als der Pabst“; die unzähligen lyrischen, symbolischen und zynischen Schnörkel und Koketterien, von dem Ertrinkenden vor dem Plakat „Wir schwören ...“ über den makabren Danse funebre in der Bunkerkantine bis zu der richtiggehenden Beton-schmockerei, da sich die Generale nach den Detonationen, die den Tod Hitlers und Eva Brauns künden, wie auf ein Kommando erleichtert aufatmend (des sind wir froh: benedicamus domino ...) eine Zigarette anzünden. Das ist nicht Shakespeare, das ist Münchner Bier. Diese Szene zeigt, wie der Film mit jedem Quadrat der Entfernung von der Wirklichkeit unehrlicher, unglaubwürdiger, marionettenhafter wird. *
Damit tritt ein zweiter Einwand vor.
Das Danaergeschenk Pudowkins an den Spielfilm, die „Montage“, inkludiert nicht nur den Schwindel und den Trick (Pudowkin schildert in seinem Buche „Manuskript und Regie“, wie es ihm einmal wie Schuppen von den Augen fiel, als er erkannte, daß eine trickhafte Kombination erdachter Einzelstadien den Einschlag einer Granate viel natürlicher wiedergebe als die blöde Photographie des realen Vorganges.'), sondern auch das „künstlerische“ Prinzip der Verzerrung, Vergrößerung, Uebertreibung. Der Spielfilm muß übertreiben, um den Verlust, der ihm auf dem Wege der Uebertragung der Aufnahme auf die Leinwand, notwendig in die Arme fällt, aufzuholen und solcherart letztlich wieder „echt“ zu wirken. Das bedingt, wenn es überhaupt anders als durch Glück und Zufall zum Ziele führen soll, ein geradezu hellseherisches Auge für das einerseits notwendige, anderseits noch erlaubte Ausmaß dieser Uebertreibung. Und dieses Auge versagt in dem Film „Der letzte Akt“, es blinzelt und schielt ganze Strecken weit, vor allem aber — und dies gleichzeitig von Buch, Regie, Kamera und Darsteller her — bei der Gestalt Hitlers. In dem fleißigen Bestreben, das Ne-ronisch-Pathologische in Hitler allein zur Erklärung der Katastrophenwirkung hervorzuheben, hat man so hoch übers Ziel geschossen, daß der Endeffekt nichts anderes als ein teils verabscheuenswürdiges, teils erbarmungswürdiges Häuferl Unglück ist. Und — Himmelherrschaft noch einmal! — sowar'sja, sowar „er“ ja nun wirklich nicht. Wir müßten uns dann selber ins Gesicht spucken darüber, daß wir mit einem solchen Nervenbinkel, Sterngucker, Spritzensüchtigen, Hysteriker und Epileptiker, mit einer solchen Panoptikums-Wachsfigur, wie uns ihn dieser Film vorzugaukeln sucht, nicht schon in 13 Tagen, sondern erst in 13 Jahren fertig geworden sind! Es würde, glaube ich, unseren sauberen, bitteren Kampf gegen ihn und unser unmeßbares persönliches Opfer in diesem Kampf nur ehren, wenn wir endlich zugäben, daß er neben alledem, das er vielleicht auch' gewesen sein mag, auch und in erster Linie ein anderer gewesen ist: diesem, und nur diesem Adolf Hitler kann es gelungen sein, Millionen durchaus nicht kritiklose Menschen, führende Männer der Politik, Kunst und Wissenschaft in der ganzen Welt mitzureißen, zu beeindrucken, zu verwirren und zu verderben.
Diesen Hitler aber, dieses Dokument und diese Intuition bleibt uns dieser Film völlig schuldig — aus dem Fluch des Spielfilms, des spielerischen Films heraus, aus dem gefahrvollen Spiel der Phantasie, das von der Wirklichkeit mindestens so weit abirrte wie sein Held von Realität. Pabst-Skodas Hitler hat in der Geschichte des Films nur ein einziges Gegenstück (mit verkehrten Vorzeichen); Veit Harlan-Werner Krauß' „Jud Süß“: er ist so unrichtig und ungerecht, so ungeheuer und ungeheuerlich wie dieser.
Damit ist nicht nur ein hartes ästhetisches und ethisches Urteil über den Film „Der letzte Akt“ gesprochen, sondern auch eine letzte und, wie es scheint, die wichtigste Frage gestellt: Soll, darf, kann dann ein Film überhaupt in einer Zeit, da uns die Kontur der Akteure noch so überscharf vor Augen steht und die Folgen ihrer Taten uns noch so tief in den Knochen sitzen, diese unheilvolle Realität wiederholen? Die Antwort kann nur „nein“ sein.
Ein lückenloser, reiner Dokumentarfilm des „letzten Aktes“ der deutschen Tragödie ist nicht möglich, und der Spielfilm muß, wie der vorliegende Fall zeigt, an der unklaren Deutung, an der mangelnden Distanz scheitern. Wenn G. W. Pabst, wie verlautet, seit Jahren die Glut und die Dämonie eines Shakespeare-Dramas vorschwebte, hätte ihm auch irgendwie die Weisheit und Geduld des Dichters zu denken geben müssen: aus seiner Zeit hat Shakespeare die Geschöpfe seiner Dramen nicht geschöpft. Vielleicht wird ein Bühnendrama in 50 oder 100 Jahren diesen achten Heinrich-Macbeth-Lear zwingen. Ein Film unserer Tage kann es nicht.
Bliebe noch am Rande die Wirkung auf den Zuschauer zu untersuchen — die konsternierte Stimmung des Publikums bei der Premiere reizt dazu. Ein treues Abbild der Geschichte, also Information, Aufklärung? Nein. Faszination? Absatz? Vielleicht. Mahnung? Versöhnung? Ich glaube nicht daran. Ich befürchte eher, daß durch diesen Film kaum verheilte Wunden, in denen dieser Film mit einer Art hingebungsvoller Liebe wühlt und stochert, wieder aufbrechen. Hätte ich beispielsweise im Kriege einen Dreizehnjährigen verloren, so müßte ich bei der Filmszene, da der „Führer“ diese Milchgesichter dekoriert und sie ihm mit ihren unmutierten Stimmen im schneidigen Kommißjargon antworten, wie ein zu Tode getroffenes Tier aufbrüllen. Es fällt schon schwer genug, nicht bei dem Gedanken aufzuschreien, daß hier aus unserer persönlichsten Not und Verelendung, die uns bis zum heutigen Tag nicht das zerbombte Heim, die zerfetzte Bücherei und den gestohlenen dritten Anzug wiedergebracht hat, Gold gemünzt wird.
Aus allen diesen Gründen senke ich achtungsvoll den Degen vor dem filmischen Können und vor dem ehrlichen Wollen, das einen Teil der Schöpfer dieses Films geleitet haben mag; bin aber trotzdem ganz und ohne Vorbehalte gegen die Idee, gegen die Ausführung und gegen die Aufführung des Films „Der letzte Akt“.
F i 1 m s c h a ü (Gutachten der Katholisch&n Film-lommission für Oesterreich), Nr'. 15/V vom 16. April 1955: III (für Erwachsene und reifere Jugend): „An der schönen blauen Donau“, „Andersen und die Tänzerin“, „Brustbild, bitte!“, „Duell im Dschungel“, „Geliebtes Fräulein Doktor“, „Taza, der Sohn des Cochise“ — IV a (für Erwachsene mit Vorbehalt): „Atomexplosion in Nevada“, „Gefährliche Schönheit“, „Die Geier von Carson City“ — IV b (für Erwachsene mit ernstem Vorbehalt): „Stunde der Abrechnung“.