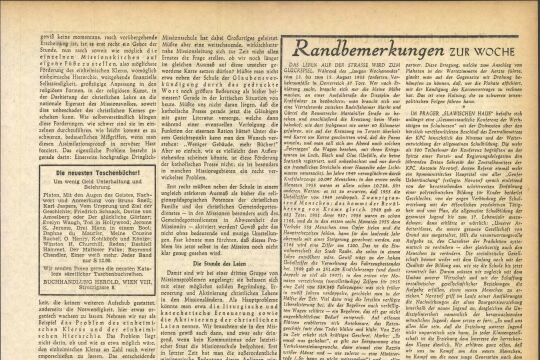Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Randhemerkungen zur woche
DAS POLITISCHE KLIMA DER SOMMERMONATE hat, gerade in Oesterreich, seit langer Zeit seine eigenen Lichter und Schatten. Es wäre wert, einmal zusammenzustellen, was an Katastrophen und an Gespenstern in den Monaten Juli und AgMsr seit vierzig Jahren am Horizont unseres Volkes erschienen sind. Zwanzig Jähre sind es nun her, seit Hitler mit dem Würgegriff der 1000-Mark-Sperre zielsicher den deutschen Reiseverkehr nach Oesterreich, und mehr noch, die große Angst nicht weniger Oesterreich getroffen hat. Es blieb in diesen Tagen einigen österreichischen Blättern und einigen deutschen Kreisen vorbehalten, das Gespenst einer neuen 1000-Mark-Sperre an die Wand zu malen. „Oesterrelchtsche“ Zeltungen wiesen mit dem uniib erhörbaren Unterton der Warnung auf das Zurückgehen des deutschen Reiseverkehrs in Salzburg hin — es ist das Verdienst der größten Tageszeitung Westdeutschlands, der „Süddeutschen Zeitung“ in einem Artikel auf erster Seite und erster Stelle die Tragwürdigkeit des Verhaltens gewisser deutscher Volksgenossen 1955 Oesterreich gegenüber aufzuzeigen, „da sogar solche Bundesdeutsche, die nie einen Pfennig Vermögen In der Ostmark besaßen, die im Wiener Staatsvertrag getroffene Regelung über deutsches Eigentum übelnehmen. Haben wir es nötig, nach Tirol zu fahren? Fahren wir eben nach Afrika — so etwa ist die Reaktion. Wir wollen sehr hoffen, sie werde nicht zum Tragen kommen . .“ Diesem Wunsch unserer süddeutschen Freunde wollen wir hinzufügen: es hängt sehr viel von einem würdigen Standhalten des österreichischen Volkes und lumal seiner Vertreter ab. Vielleicht darf der Besuch des Hamburger Bürgermeisters Dr. Sieveking in Wien als ein Exempel deutscherseits für ein um Einsicht und rechten Handel bemühtes Verhalten genannt werden. Hamburgs Hafen ist an Oesterreich stark interessiert — leider blieb die österreichische Reaktion dubios: viele österreichische Wirtschaftler und Politiker sind, ähnlich unseren Fußballern, von einem eigentümlichen Angstkomplex den Deutschen gegenüber besessen. Entweder zu kalt oder zu warm, finden sie selten das rechte Maß und die Mitte, die im Gespräch mit unseren deutschen Freunden to wohl tut. Zwischen Ab w ehr, Ablehnung und U eb er gab e sollte doch endlich der rechte Weg gefunden werden, der allein Oesterreichs Unabhängigkeit sichern kann. Die Angst ist ein schlechter Berater; das gilt auch für die Angst um das deutsche Geschäft. Die deutschen und österreichischen Wünsche, Forderungen und Beschwerden gehören in aller Oeffentlichkeit verhandelt. Der Schritt in einen besseren Morgen wird von der Klarheit und Sauberkeit dieser Auseinandersetzungen abhängen.
ERNSTE EXISTENZSORGEN bestehen für die Ordensspitäler, wenn das in Beratung stehende „Allgemeine Sozial-Versieherungs-Gesetz“ (ASVG) in der vorgeschlagenen Form in Kraft tritt. Die „Furche“ hat bereits (Nr. 14/Xl) vor einem Vierteljahre, als der Sozlalmlnlster die Grundzüge des ASVG Im Wiener Presseklub entwickelte, den Sorgen der Ordensspitäler Ausdruck gegeben. Nichts ist seither zur Bereinigung dieses sozialen Problems geschehen, so daß der Erzbischof-Koadjutor Doktor Jachym beim Bundeskanzler vorstellig werden mußte. Nach 240, Ziffer 2 des ASVG, würden die privaten Krankenanstalten während der ersten 26 Tage 75 Prozent des von der Landesregierung festgesetzten Verpflegssatzes erhalten — was mit anderen Worten bedeutet, daß die „reichen“ Privatanstalten den „armen“ Krankenversicherungsinstituten einen Rabatt von 25 Prozent gewähren sollen, Benötigt ein Patient einen Aufenthalt über 2t Tage, will man den Anstalten bloß ein Sechzigstel der monatlichen Beitragsgrundlage zubilligen, wirklich billigt Denn bei einem monatlichen Durchschnittsverdienst von 1350 Schilling macht dann der Verpflegssatz 22.50 Schilling aus. Es gibt aber bekanntlich auch Rentner. In diesem Falle kann das Sechzigstel bis auf 10 Schilling sinken. Die Gemeinde Wien hat selbst errechnet, daß ein Spitalsplatz im Tage 105 Schilling kostet! in Linz bezahlt man dem Städtischen Krankenhaus 57 Schilling (auch eine merkwürdige Mathematik). Man fragt sich: woher sollen die Ordensspltäler den Unterschied nehmen? Es kommt aber noch „besser“: sollte der Patient voll Uebermut eine Krankheit, eine Operation und Nachbehandlung anbieten, die über eine festgesetzte „Höchstdauer“ geht — dann mögen die privaten Anstalten für die Kosten aus eigenen Mitteln aufkommen. Sehr sonderbar mutet der Versuch an, die Defizite aus Bundesmitteln zu „stützen“ (so wie man einen Milchpreis stützt), wozu jährlich 50 Millionen Schilling vorgesehen sind. Für Minderleistungen der Sozialversicherungsträger, denen die Versicherten vom Arbeitslohn Betträge leisten, wird eine Stützung aus Steuergeldern vertretbar gehalten, anstatt den Anstalten gleich kostendeckende Ver-pflegssätze zu geben. Was es für einen Sinn hat, die katholischen Krankenanstalten durch Vertrauensärzte zu überprüfen — steht auf einem anderen Blttt. Vielleicht, um das Defizit zu kontrollieren oder die doppelt so lange Arbeltszelt der Ordensschwestern? Beschließt man das ASVG in der vorliegenden Form, wird man bald nichts zu kontrollleren haben. Und tausende Patienten können dann Spitalsbetten suchen gehen. Denn die Ordensanstalten, Orte tätiger Nächstenliebe, müssen über kurz schließen, weil das ASVG es so liebt.
IM SCHLAGSCHATTEN DER GROSSEN POLITIK bereitet sich einiges in der Wiener Gemeindestube vor — und zwar wenig schönes. Die geplante Tariferhöhung der Wiener Verkehrsbetriebe ist geeignet, die Erbitterung weiter Kreise der Bevölkerung unserer Bundeshauptstadt wachzurufen. Da ist einmal der Gedanke an sich: mitten in einer Zeit, in der Lohn und Preis notdürftig ausbalanciert sind, in der Appelle an die Pretsdisztplin der Privatwirtschaft gehalten werden und man dem Lohnempfänger sein gestiegenes Realeinkommen in schön gezeichneten Tabellen und stilistisch ausgeklügelten Wirtschaftsberichten vor Augen führt, bereitet man in aller Stille einen Anschlag auf das Portemonnaie der Wiener vor. Wer weiß, welches volkswirtschaftliche Regulativ neben dem Brotpreis der Straßenbahntarif ist, wird sich die weiteren Drehungen der Lohn- und Preisspirale schon heute vorstellen können. Dazu kommt aber noch etwas anderes: die beinahe schon zynisch zu nennende Art und Weise, durch die eine solche durch nichts als fadenscheinige Ausreden zu motivierende Schmälerung des Realeinkommens gerade breiter Kreise schmackhaft gemacht werden soll. Denn — offen gesprochen — die groß proklamierte Aufhebung der Grundgebühr für Gasbezug von sage und schreibe 3.60 Schilling (nicht einmal zwei Fahrscheine nach dem angekündigten neuen Tarife) und die „wesentliche“ Verbilllgung — für die gänzliche Aufhebung fehlte wiederum das Herz — der Grundgebühr für den Bezug von Elektrizität können nur als ein Hohn für den ohnmächtigen Konsumenten gewertet werden. Offen sei es gesagt: Die Schöpfung der kommunalen Verkehrsbetriebe, von Lueger bekanntlich als Waffe gegen das Preisdtktat privater Gesellschaften geplant und verwirklicht, hat sich von den Intentionen ihres Gründers nicht nur weit entfernt, sondern übt heute dieselbe Willkür aus. Die Tartfpolltik der Gemeinde Wien für die Verkehrsbetriebe Ist r- so die in Aussicht gestellten Tarife Tatsache werden — eine wirtschaftlich nicht zu rechtfertigende Bedrückung gerade der wirtschaftlich Schwachen. Wir wissen nicht, welche Antworten Stadtrat Resch auf der Wiener Konferenz der Sozialistischen Partei auf seine Darlegungen zu hören bekommen hat. Wir wollen zur Ehre der Sozialistischen Partei annehmen, daß es nicht nur Beifall war. Tatsache aber Ist, daß diese Konferenz letzten Endes der neuen Tarifpolitik ihre Zustimmung nicht versagt hat. Wenn die sozialistischen Führer das alte Geheimrezept Otto Bauers, dem er seine Verbundenheit mit den Gedanken und dem Fühlen der Massen verdankte — „Ich fahre stets mit der Straßenbahn“, erklärte er einmal einem Journalisten —, noch anwenden würden, sie bekämen in diesen Tagen wenig Schmeichelhaftes zu hören. Die Oesterreichische Volkspartei aber hat in Wien ein einmalige Chance. Wenn sie nicht nur papierene oder rhetorische Proteste abgibt und im stillen Kämmerlein doch Ja und Amen sagt, sondern die Dynamik zu einem echten dauerhaften Kampf in dieser Frage entwickelt: dann wäre es gar nicht schwer, in Wien ihrem Namen Ehre zu machen, und Kreise, die ihr heute noch verschlossen sind, zu gewinnen.
BÖHMISCHE DÖRFER - ist ein sprichwörtlicher Ausdruck für etwas Unverständliches (wie es dem nicht Tschechischkundtgen nicht erst seit dem Drelßigfährigen Kriege ergeht, wo der Ausdruck entstand). Seit Jahren häuften sich die Nachrichten in der Presse, daß nicht bloß einzelne Häuser (aus „strategischen Gründen“), sondern wirkliche bähmische Dörfer von der Erdoberfläche verschwinden. Besorgte Bauern aus dem Waldviertel sahen nach Feierabend in das Niemandsland, wo sie gerne Wiesen gemäht hätten, wären die Bauern nicht Gefahr gelaufen, selbst gemäht zu werden. Nun hört man, daß die erst vernichteten Siedlungen wieder aufgebaut werden und Neubewohner gesucht sind. Für die Grenzbe2lrke von Brünn, Znaim und Ntkols-burg liegen — was als großer Erfolg gewertet wird — 908 Ansuchen von Neusiedlern vor (Znaim hatte vor dem Kriege 26.000 Einwohner). Für Nikolsburg sind 58 Häuser im Bau und ungeachtet des fortschrittlichen Namens Mikulov nur acht fertig zum Einzug für die Neusiedler. Nikolsburg hatte 193* rund 7800 Einwohner, heute sind es (einschließlich der auf acht Häuser veranschlagten 40 Neubewohner) 5340. Sehr ermutigend (für die .Statistik) sieht es in dem von Niederösterreich abgetrennten Fslds-berg und den nächst Gmünd acht zur Gänze und sechs teilweise abgetretenen Ortsgemeinden aus, die SS Prozent deutschsprachige Bevölkerung besaßen und mit Niederösterreich in vielen Beziehungen enge zusammenhingen (heute hängen die Bahnlinien teilweise in der Luft). Von den 11.819 Hektar Boden ist ein Viertel ungenutzt und ein weiteres Viertel mangelhaft bewirtschaftet! die Bevölkerung, bei Kriegsende auf 15.000 (ohne Flüchtlinge) geschätzt, hat mehr als ein Drittel des Bestandes verloren und liegt damit nahe der Ziffer von 1920. Eine Volkszählung wie damals, am 31. Jänner 1920, zu machen, erübrigt steh, Zum Zählen müßte erst etwas da sein.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!