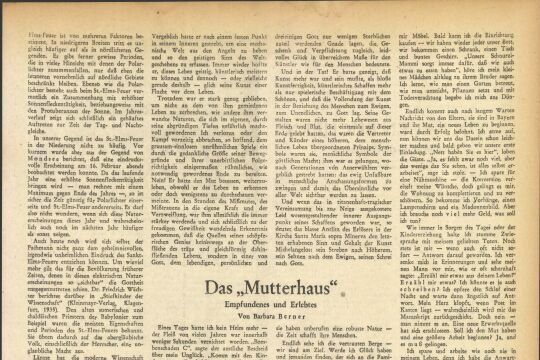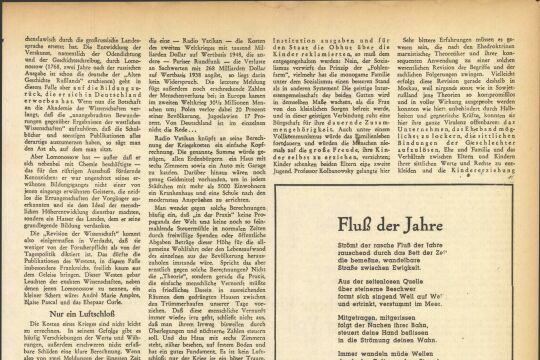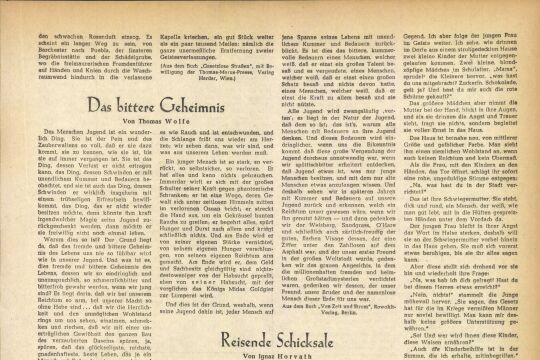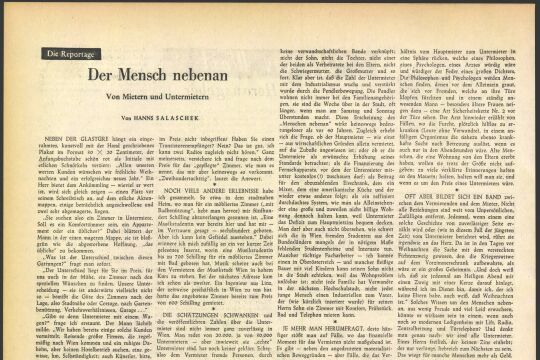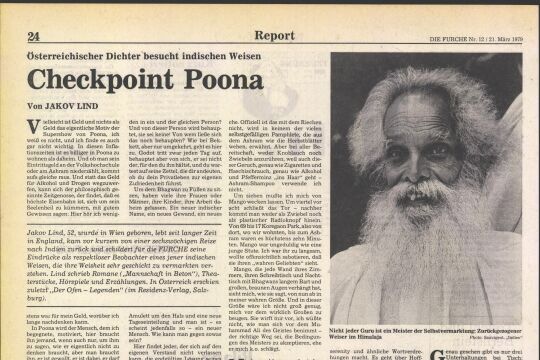Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
X, Arsenalstraße 9'
Wer eine eigene Wohnung besitzt, und sei sie auch noch so klein, weiß diesen Schatz nicht zu ermessen, solange er nicht Menschen ohne Heim kennengelernt hat.
Gibt's denn in Oesterreich noch Menschen ohne Heim? Leider nur zu viele. Oft hört man klagen: Meine Wohnung ist mir zu klein, wenn ich doch etwas Größeres bekommen könnte; eine andere Unzufriedene meint: Meine Wohnung ist hofseitig und ich habe zuwenig Sonne ... ; wieder andere würden sich eine süd-ostseitige oder im Stock gelegene Wohnung wünschen. Ja, wenn man Tauschwünsche haben kann, ist es gut; doch wer, wie diese Aermsten der Armen, die nicht einen Quadratmeter ihr Eigentum nennen können, leben müßte, was dann?
An sozialen Errungenschaften steht Oesterreich in Europa mit an erster Stelle. Auch die Betreuung von obdachlosen Frauen ist vorbildlich — soweit sie Aufnahme finden in dem beschränkten Rahmen, der für diese traurigen Fälle zu Gebote steht.
Ein einziges städtisches Obdachlosenheim für Frauen steht Wien zur Verfügung. 240 Frauen finden da ein Unterkommen t ein Tropfen auf einen heißen Stein, wenn man weiß, wie viele Menschen noch umherirren, die sich nicht zu den „Glücklichen“ zählen, in einem Obdachlosenheim Aufnahme gefunden zu haben. Und wie viele bangen jetzt neuerlich, bald auf der Straße zu sitzen, wenn wieder Delogierungen einsetzen werden.
240 heimatlose Frauen im Alter von 18 bis über 80 Jahren leben, wie gesagt, mehr oder weniger lange in diesem Heim. Das Hau ist zweifelsohne'gut geführt, und doch, wer möchte mit diesen Frauen tauschen, wenn er auch nur einen einzigen kleinen, feuchten Kellerraum zur eigenen Verfügung hat?
240 obdachlose Frauen — 240 Schicksale, die dahindämmern, ohne daß man wesentlich zu ihrer Hilfe, zu ihrer Erleichterung beitragen könnte. Es sind durchweg Frauen, die in Wien beheimatet waren, als sie noch eine Wohnung ihr eigen nannten. Denn sie alle waren ja einmal irgendwo zu Hause. Nicht alle sind in Wien oder Oesterreich geboren. Sehr viele Heimatvertriebene aus allen deutschsprachigen Gegenden findet man hier, und diese Frauen — es ist traurig, doch wahr — fühlen sich noch einsamer, ärmer, ausgestoßener als andere. Denn auch unter diesen Allerärmsten findet man noch Unterschiede. Es sind dies Grenzen, die sie sich selbst ziehen. Es genügt schon, wenn eine einen anderen Dialekt spricht als die anderen, um sie anzuprangern und aus der ohnedies nur sehr losen Gemeinschaft auszustoßen.
Altruismus findet sich auch hier; jedoch nur selten. Die heitere, gemütvolle 82jährige Frau L. sitzt auf einem Bänkchen und häkelt. Lachfalten ziehen über ihr heiter-freundliches Gesicht. Geistig und körperlich ist sie rege wie eine Junge. Jede Minute, die sie Zeit findet, arbeitet sie für das Wohlfahrtswerk der Adventgemeinde. — Im Grund genommen ist es gar nicht wichtig, was sie macht, aber sie ist so vollkommen ausgefüllt durch ihre Tätigkeit, diß sie keine Zeit hat für Streitereien, wie sie doch sonst hier leider an der Tagesordnung sind. — Heute ist diese Frau Witwe, alleinstehend, wurde während der letzten Kriegstage ausgebombt und lebt nun von einer Witwenrente in der Höhe von etwa 330 S. Lind diese Frau ist glücklich, man sieht es ihr an.
„Was will ich denn mehr“, lächelt sie, „ein schönes, sorgenfreies Leben habe ich, Gas, Licht, Heizung, ein Bett, nur — ach, wenn man doch nicht so viel streiten würde um mich herum, aber dann wäre es wohl zu schön.“
Voll Spitzfindigkeiten, erzählt Frau P., ist eine ihrer Bettnachbarinnen. „Stellen Sie sich vor“, sagt sie — die Worte sprudeln wie ein Wasserfall und man hört ihr die Erleichterung an, daß sie endlich einmal erzählen kann —, „stellen Sie sich bloß vor, da komme ich an einem Juliabend heim, es hat 29 Grad und ich gehe natürlich zum Fenster und mache es auf, da kommt diese Frau wie eine Furie zum Fenster hingeschossen und wirft es zu und sagt, der Arzt habe ihr gesagt, sie dürfe keine frische Luft haben. Da habe ich gesagt, den Arzt möchte ich kennen, der so was verschreibt, und mache das Fenster wieder auf, und da stürzt sie wieder hin, wo sie sich doch gerade ihre Haare eingedreht hat, und stoßt das Fenster wieder zu, und dann natürlich gehe ich wieder hin und mache das Fenster wieder auf, denn, sagen Sie doch, wer kann denn bei so einer Affenhitze bei zugemachtem Fenster existieren. Und da wird sie wild wie eine Verrückte, und schon ist sie wieder beim Fenster und haut es zu und sagt, sie bleibt nun bei dem Fenster stehen, das wird ihr keiner mehr aufmachen, und da bin ich dann ...“
Klassenunterschiede gibt es natürlich nicht, aber wer mehr Geld hat, kann auch hier schöner und besser leben. Im kleinen Kreis macht sich das schon bemerkbar.
Zwei Einbettzimmer existieren im Heim. Das eine bewohnt eine Aerztin, auch so etwas findet sich erstaunlicherweise in einem Obdachlosenheim. Die Frau ist krank und bettlägerig. Ihr Traum ist, wie der der meisten Insassinnen hier: eine eigene Wohnung. „Dann könnte ich endlich auch wieder praktizieren und die Krankenkassenpatienten bekommen; anders ist mir das nicht möglich.“ Ein verständlicher Wunsch. Seit drei Jahren ist sie hier, und sie weiß nicht, wie lange dieser Zustand noch währen wird.
Den zweiten Einzelraum bewohnt eine gutaussehende, gepflegte Frau. Der Raum ist, man könnte fast sagen, wohnlich hergerichtet. Mit bescheidenen Mitteln kann man ja auch in diesem begrenzten Rahmen einen persönlichen Stempel abgeben. Sei es ein kleines Bild an der Wand, eine bunte Tischdecke oder eine Vase mit Blumen. Frau R. war früher Sekretärin, ist aber heute in einem Alter, wo man in diesem Beruf schwer eine Stellung bekommt. Sie wurde aus ihrer Wohnung gerichtlich delogiert und hat ihre Möbel an zehn verschiedenen Stellen eingestellt. Auch ihr dringlichster Wunsch: eine Wohnung, und war' sie auch noch so klein.
Zehn Zweibettzimmer gibt es im Heim. Eines davon wirkt wie ein eheliches Schlafzimmer. Mit schöner Decke über beide Betten und den gleichen Vorhängen: Mutter und Tochter hausen hier. — Ein anderes Zimmer wieder beherbergt zwei junge Lehrerinnen,' die sich aber, wie die abseitige Stellung der Betten verrät, doch nicht so schwesterlich vertragen dürften.
Sonnenstrahlen im Alter. Die hat sich wohl jede dieser Frauen einmal erhofft. Und was ist daraus geworden?
In den Zimmern mit den fünf und sechs Betten ist nett aufgeräumt, darauf achtet die Lagerleitung. Aber trotzdem wirkt das ganze etwa — wie ein Spital, möchte man sagen, ein bißchen leer, traurig; der gewisse Gemeinschaftsgeist fehlt. Eine der Frauen liest, eine andere strickt; andere wiederum tun gar nichts, sitzen bloß und haben die Hände im Schoß. Einige kochen, denn es geht ältf Mittag.
Schöne, geräumige Küchen sind da, mit Gasherden und Gasbrennern. Die Frauen können hier kochen, backen, abwaschen. Kalt- und Warmwasser ist vorhanden — viele haben das früher in eigenen Wohnungen nie gekannt. Außer einem Kleiderkasten hat jede auch ein Kästchen, in dem man Lebensmittel und Geschirr aufbewahren kann. Und da in der Küche ist ein eifriges Werken zu beobachten. Fleisch, Gemüse, Kartoffeln, Mehlspeisen, alles duftet durcheinander. Jede kocht, nach Geschmack und Lust, was ihr mundet. Und wahrscheinlich auch, was die meist magere Rente oder der Verdienst zuläßt.
Ein Blick in den Gemeinschaftsraum. Tische, Sessel, ein großer Ofen, der Wärme ausstrahlt. Die Frauen sitzen meist im Mantel, arme, müde Gestalten sind es, die erwartungsvoll oder neugierig oder stumpf zum Heimleiter und mir herschauen. Sic sprechen kein Wort und warten, was da kommen soll. Und dann erfahre ich bruchstückweise und in kurzen Schlagworten Geschicke:
Frau P„ 43 Jahre alt, geschieden, ihre sechs Kinder — fünf Buben, ein Mädchen — sind beim Mann. Frau P. war 17 Jahre verheiratet, ist nun seit 13 Jahren krank: Epilepsie. Sie bezieht eine Dauerrente von etwa 220 S im Monat. Einmal im Monat fährt sie nach Mödling, ihre Buben zu sehen. — Dafür lebe ich noch, glänzen ihre Augen auf. — Sie schaut elend aus, krank, verfallen, arbeitsunfähig. Magere Hände, schwarze, fiebrig glänzende Augen.
Frau S„ 76 Jahre alt, seit 20 Jahren verwitwet. Die Wohnung 1945 ausgebrannt; seit 1949 ist sie hier im Heim. Nach ihrem Mann bezieht sie eine ausreichende Pension und macht einen zufriedenen Eindruck.
Frau T„ 54 Jahre, war Verkäuferin, Köchin, ist alleinstehend, Heimatvertriebene, seit 1948 im Heim; jetzt Invalidenrentnerin mit einer Rente von 500 S.
Frau F., 70 Jahre alt, Sudetendeutsche, war Schneiderin, ist alleinstehend. Ihr gefällt es hier, und sie bezieht eine Rente von 500 S. Ab und zu verdient sie sich ein bißchen dazu.
Frau B., 52 Jahre alt, Kriegerswitwe, Wohnung durch Bomben verloren; arbeitet als Bedienerin. Rente 400 S. Frau B. lobt die Reinlichkeit und Ordnung im Heim und möchte nicht weg von da.
Frau A„ 28 Jahre alt, Schneiderin, arbeitet in einem Betrieb; hat ein uneheliches Kind; mußte die elterliche Wohnung verlassen; das Kind ist in einer Kinderkrippe: Sobald sie eine Wohnung hat, will sie das Kind zu sich nehmen.
H e i m 1 e b e n. Die Heiminsassinnen müssen um 22 LIhr - in der Regel - daheim sein. Wenn sie Arbeit haben, die länger dauert, oder eingeladen sind oder einen Kinobesuch machen, dürfen sie auch später kommen. Frauen, die gewisse Nachtberufe ausüben, können hier keine Aufnahme finden. „Denn“, meint der Heimleiter, „bis in den Tag hinein schlafen und in der Nacht ... nein, das geht bei uns nicht.“
Logispreis pio Woche differiert zwischen 6.50 bis 20 S. Bettwäsche wird beigestellt. Waschküche ist vorhanden, Trockenboden, Bügelgelegenheit. Die sanitären Anlagen werden ständig saubergehalten.
Die Küchen sind stundenweise zu benützen. Alles wäre in Ordnung, doch der größte Feind des Heimes, des Heimlebens ist: der Streit!
Eine Schwester des Aufsichtspersonals erzählt, sie hätten sich untereinander versprochen, immer dann eine Fahne auszuhängen, wenn es im Hause einen Tag lang keinen Streit geben würde. „Und wie oft war das der Fall?“ frage ich. „In den langen Jahren, die ich hier bin, einmal ...“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!