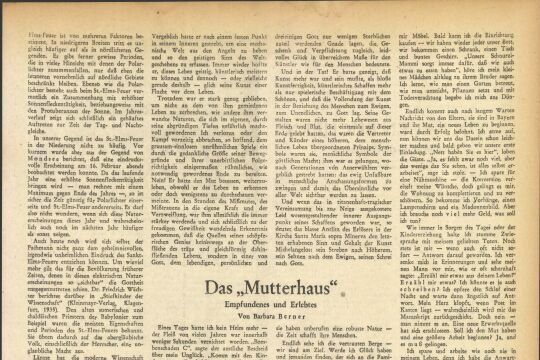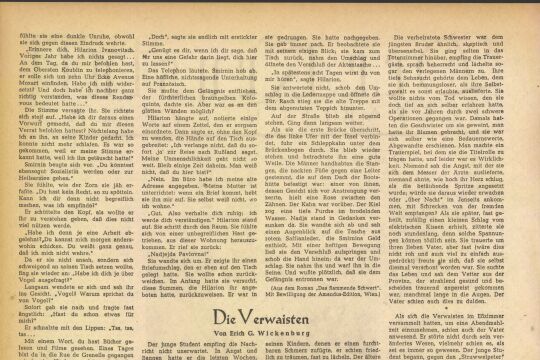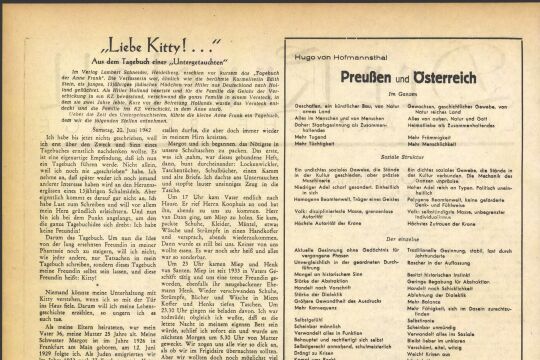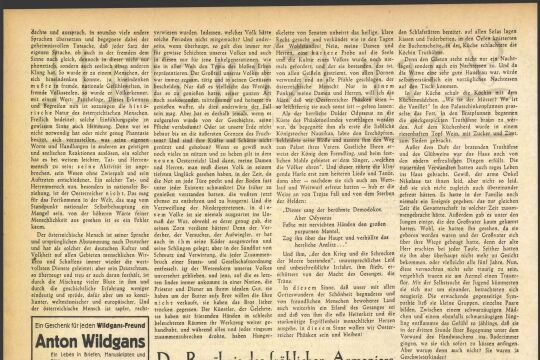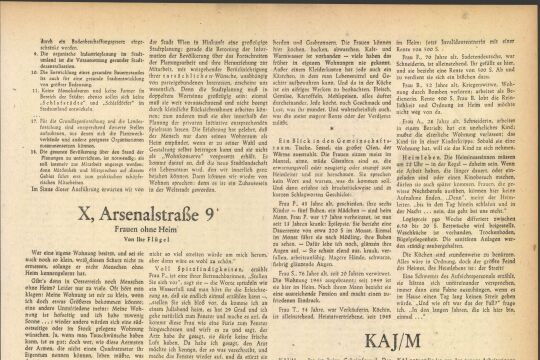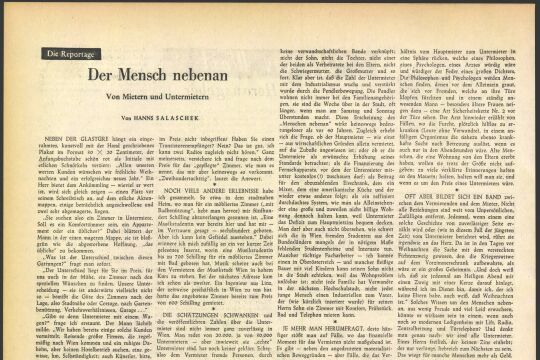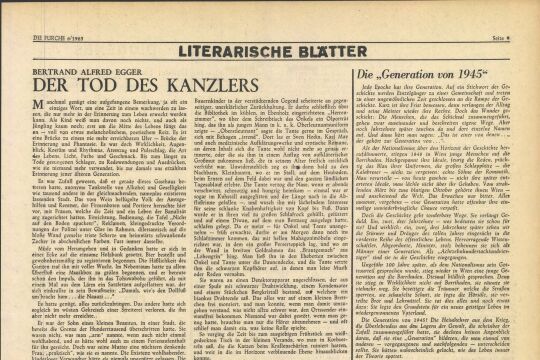Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Alltägliche Tragödien
Wir leben zwar in Ballungszentren beisammen, entfremden uns aber von den Mitmenschen, sind isoliert. Viele sind ein Leben lang einsam, manche trifft es erst am Lebensende, im Altersheim, besonders Frauen - sie leben länger.
Wir leben zwar in Ballungszentren beisammen, entfremden uns aber von den Mitmenschen, sind isoliert. Viele sind ein Leben lang einsam, manche trifft es erst am Lebensende, im Altersheim, besonders Frauen - sie leben länger.
Im Dezember 1982 stirbt eine 79- jährige Frau. Nachbarn werden aufmerksam, alamieren die Polizei. Die Kellerwohnung wird versiegelt. Polizei und der eingeschaltete Notar machen die 61- jährige Tochter der Verstorbenen ausfindig - sie hat ihre Mutter seit dreizehn Jahren nicht gesehen.
Sie weiß ihrerseits nichts über den Verbleib ihres 40jährigen Sohnes und ihres elfjährigen Enkels. Alle werden ausfindig gemacht. Ein Armenbegräbnis im Gemeinschaftsgrab ist vorgesehen.
Die Nachbarn berichten, daß diese Verstorbene in großer Einsamkeit lebte, auch als die Tochter noch hie und da Kontakte an- bot. Niemand durfte ihre Wohnung betreten, sie sprach wenig und war mürrisch und abweisend, aber stets hilfsbereit, wo es um praktische Anliegen ging.
Die Besichtigung der Wohnung im Beisein des Notars zeigt das komplette, gewohnte Bild der Verwahrlosung: In der Drei-Zim- mer-Souterrain-Wohnung sind reine Putzfetzen bis zum Plafond gestapelt. Wer die Frau kannte, der glaubt zu verstehen: Für mich paßt nichts anderes als Fetzen. Unter den hohen Stapeln wird ein Sparbuch gefunden, das das Armenbegräbnis unnötig macht.
In der Wohnung ist gerade für eine Person Platz zum Sitzen und zum Schlafen. Alles andere ist verstellt.
Das Begräbnis führt die drei
Generationen der Hinterbliebenen zusammen; auf dem Zentralfriedhof gehen sie bei peitschendem Regen fremd und stumm mit weitem Abstand von einander — jeder einsam, jeder allein, auch das Kind, der Urenkel.
Zwangsläufig stellt sich die Frage nach der Geschichte dieser sehr intelligenten, seit Jahrzehnten vereinsamten Frau. Welche Realität hat sie als Kind erlebt, welche Verhaltensweisen hat sie als Kind lernen müssen, um so isolierende Daseinstechniken zu entwickeln?
Ein langes Gespräch mit der Tochter gibt eine Menge Hinweise: Die Frau war ein lediges Kind einer Bauernmagd. Als sie drei Jahre alt war, stirbt auch die Mutter, die ohnehin wenig Schutz und Sicherheit bieten konnte. Sie wächst in einem großen Waisenhaus auf, wie es sie in der damaligen Zeit häufig gab. Sie findet wohl Sexualpartner, aber keine Lebenspartner. Ihre Tochter wird ledig geboren, auch deren Sohn.
Ich habe die Frau zwanzig Jahre gekannt. Ihre Angst vor Men-
sehen war zweifellos größer als ihre Sehnsucht nach Gemeinschaft.
Die 90jährige Frau M. beschließt, ihre Wohnung aufzugeben und in ein Heim zu ziehen, das sie von drei Urlaubsaufenthalten her kennt. Es liegt 300 Kilometer von Wien entfernt. Sie entscheidet souverän, will keine Einwände hören. Der Grund für die Entscheidung liegt darin, daß sie eine schwere Gehbehinderung hat, daß sie mager und kraftlos geworden ist und oft hinfällt, ohne sich selbst erheben zu können. Sie sagt: „Dort wird man auf mich schauen, dort werde ich auch nicht allein sterben müssen.“
Sie war ausgebildete Lehrerin und Sozialarbeiterin und hat sich in beiden Berufen eine ausreichende Pension erarbeitet. Nach der Pensionierung sucht sie (damals schon leicht gehbehindert) eine altersgerechte Wohnung und übersiedelt planmäßig. Sie baut sich systematisch die Pensionsphase ihres Lebens auf. Als halbe Engländerin gibt sie regelmäßig Nachhilfestunden. Bis zu dreißig Wochenstunden schafft sie noch mit 85 Jahren!
Dann baut sie ihre Verpflichtungen ab. Sie hat aus jeder Lebensphase Freunde - ihre älteste Freundin aus der Zeit des gemeinsamen Kindergartens.
Sie ist in ihrer Wohnung nie einsam. Jeder Tag ist strukturiert, jede Woche hat ihren Plan. Eine gepflegte Wohnung, Fernsehen, Besuche, leidenschaftliches Lesen lassen ihr die Zeit kurz erscheinen.
Als sie hilfsbedürftig wird, kommt eine besonders liebe und intelligente Heimhelferin mehrmals in der Woche.
Wer jemals erlebt hat, was eine Übersiedlung ins Heim bedeutet, wird ermessen, wie es in den letzten Wochen bei Frau M. zugeht. Am letzten Abend sind alle unnützen und nützlichen Dinge weggeschafft - die Arbeit von drei Monaten. Sie hat nicht einmal mehr ein Bett. Nachbarn organisieren ihr das.
Sie gibt zwar zuletzt noch bis in den Abend eine Englischstunde, sitzt zwei Stunden bei einer Freundin, schläft eine letzte Nacht in ihrer Wohnung, in ihrer Stadt, und fährt allein mit dem Zug nach H.
Regelrecht erschöpft kommt sie ins Heim. Das Zimmer ist zu klein, um sich mit Krücken zu bewegen. Die ersten Wochen schläft sie nur, dann merkt sie, daß sie nur noch schlafen will. „Es geht halt bergab“.
Zweifellos braucht ein Mensch in diesem hohen Alter eine Umgebung, die ihm hilft, die ihn anregt, die ihn erwärmt, die ihn erfreut, die ihn interessiert, wenn er noch in einer völlig neuen Umgebung Wurzeln schlagen soll. Das Essen kommt ins Zimmer — sonst kommt niemand und nichts. Und sie kann nicht mehr um Hilfe rufen. Sie will es immer noch allein schaffen — schafft es aber nicht mehr allein.
Auszug aus: Information des Ludwig Boltzmann-Instituts für Altersforschung 4/83
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!