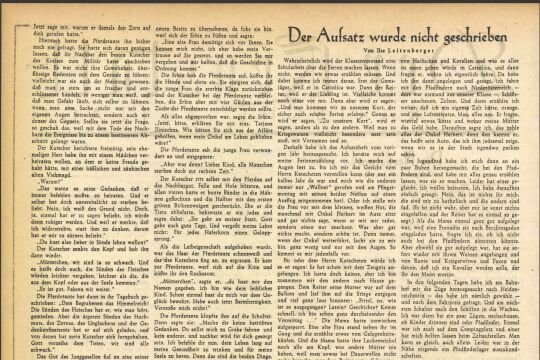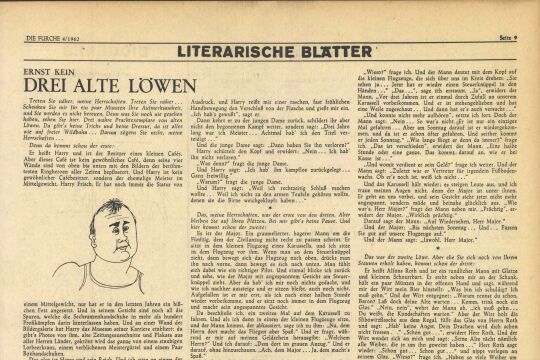Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Lamento einer Zimmervermieterin
Mit dl^en Ausländem ist es ein Kreuz, glauben SSe mir. Ich kann ein Lied davon singen, weil ich sozusagen beruflidi mit ihnen zu tun habe. Ich vermiete nän:üich Zimmer an Ausländer. Mein Mann 1st schon seit Jahren leidend und hat deshalb nur eine kleine Pensdon. Mein Sohn geht seinen künstlerischen Neigungen nach. Die äußem sich hauptsächlich darin, daß er alle Augenblicke eine andere Frau heiratet. Die einzige Bedingung, die er seinen Hei-ratskandddatinnen stellt, ist ein gutes Klavier, das sie zu Hause stehen haben müssen, damit er komponieren kann. Da es in Wien noch immer genug Haushalte mit Klavieren gibt, wird er wahrscheinlich noch lange von einer Ehe zur nächsten wandern. Inzwischen muß ich seine Tochter aus der allerersten Ehe erhalten. Die Mutter, eine Sängerin, eine schlechte Sängerin übrigens, treibt sich irgendwo in Deutschland herum und schickt uns alle zwei, drei Jahre zu Weihnachten eine Karte. So bin idi auf die Ausländer angewiesen. Sie dürfen mich nicht mißverstehen. Ich habe nichts gegen Ausländer, aber das Kreuz mit ihnen ist, daß man nie weiß, was sie im Sdiilde führen, obwohl man mit ihnen unter einem Dach wohnt. Angefangen hat es während des Krieges mit einem Serben. Damals habe ich nur ein Zimmer vermietet, weil mein Sohn noch bei mir gewohnt hat. Dieser Serbe war ein ruhiger junger Mann, der in einer Möbelfabrik gearbeitet hat und abends meistens zu Hause geblieben ist. Er hat sich nie beklagt, wenn mein Sohn bis spät in die Nacht im Erkerzimmer auf dem Klavier geklimpert hat. Der junge Mann hat eine Zeitlang eine Braut gehabt, auch ein ruhiges Mädchen, aber das Ganze hat sich bei ihr įai tlauae abgespielt, so daß wir außer Obligo waren. Er war alles in allem ein idealer Mieter — er hatte wenig Besuche und war ein pünktlicher Zahler. Eines Morgens aber, so um fünf Uhr, drangen plötzlich Gestapobeamte in meine Wohnung ein, Pistolen in der Hand, und holten ihn ab. Sie können sich nicht vorstellen, wie es damals war! Das war knapp nach dem 20. Juli 1944. Mein Sohn wollte nicht mehr zurück an die Front und täuschte ein Magenleiden vor. Stellen Sie sich vor, das wäre durch die Verhaftung unseres Untermieters, den mein Sohn ledchtsinnl-gerweise ins Vertrauen gezogen hat, aufgeflogen! Dann wäre nicht nur mein Sohn gefährdet gewesen, sondern auch mein Mann und ich, vor allem aber unser alter Hausarzt Doktor Wimberger, der voriges Jahr gestorben ist und der meinen Sohn damals bei dieser Sache fachmännisch beraten hat. So konnte er die Militärärzte besser an der Nase her umführen. Mein Sohn hat auch Widerstand geleistet, aber privat, sonst hätte man ihn ja auch verhaftet, wia unseren Untermieter, der ims beinahe alle zugrundegerichtet hätte. Es ist aber alles gut ausgegangen. Wir haben den Menschen dann erst nach dem Krieg wiedergesehen. Er ist gekommen, um seine Sachen abzuholen. Es war noch alles da, bis auf seine Aufzeichnungen. Die habe ich natürlich verbrannt, gleich nachdem die Gestapobeamten weggegangen sind. Ich habe nicht wissen können, daß es sich dabei nur um Gedichte oder so etwas Ähnliches gehandelt hat, ich kann doch nicht Serbisch. Herr Raikow war offenbar sehr enttäuscht, er hat aber meine Beweggründe verstanden, glaube ich. Vielleicht war er auch etwas enttäuscht, weil er damit gerechnet hatte, wieder bed uns zu wohnen, aber das war nicht möglich, denn bald nach seiner Verhaftung ist ein Bulgare in sein Zimmer eingezogen. Als es soweit war, haben wir buchstäblich aufgeatmet; das kann ich Ihnen sagen. Die Bulgaren waren nämlich mit den Deutschen verbündet, so daß Herr KostofE uns unter Umständen schützen konnte. Angst bekam ich erst, als die Russen ein-
marschierten, aber da stellte sich heraus, daß die Bulgaren sich mit den Russen verbündet hatten. Herr Kostofl begann jetzt ganz öffentlich die Geschäfte zu machen, die er bisher nur insgeheim in kleinem Rahmen betrieben hatte, und mietete auch das Erkerzimmer, das ihm als Lager diente. Johann, mein Sohn, zog zu einer Witwe mit einem Steinway-Konzertflügel. In unserem Bösendorfer hob Herr KostofE sein Geld auf. Es war ein ganzer Stapel deutscher Banknoten, die seine Landsleute mit Lastwagen nach Wien gebracht hatten. Herr KostofE kaufte für sie edn, was er nur kriegen konnte, imd zahlte immer die besten Preise. Da habe ich auch edn paar Male mit kleinen Provisionen unser Haushaltsgeld aufgebessert. Ich habe ihn mit einem Radiohändler bekanntgemacht, der einen ganzen Haufen Apparate versteckt gehabt hat, und dann mit einem Mann, der in seinem Kohlenkeller Stoffballen gelagert hatte. Es hat sich herausgestellt, daß es ein brauner StofE für Nazihemden war, aber Herr Kostoff hat ihn doch genommen. Sein armes Land braucht alles, hat er gesagt. Vielleicht haben sie den Stoff in Bulgarien eingefärbt, vielleicht haben sie ihn aber auch für ihre Soldaten verwendet, so wie er war. Herr Kostofl war sehr tüchtig. Er hat sich ein eigenes Telephon anlegen lassen, auch eine eigene Türglocke, damit seine Kunden uns nddit störten. Er war ein wirklich feiner Mann. Und gescheit war er, sage ich Ihnen! Als die Wirtschaftspolizei das viele Geld im Klavier fand, konnte er nachweisen, daß er für die Amerikaner arbeitete. Ich glaube, das waren nicht mehr Reichsmarkbanknoten, audi nicht die bunten Besatzungssdiilllnge, die man haufenweise gednidct hat, son-ciem schon richtige Schillinge, die einen echten Wert gehabt haben. Und Herr Kostoff hatte das ganze große Klavier voll davon. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen, als der Kommissar bei der Hausdurchsuchung den Klavierdeckel hochgehoben hat. Bald darauf hat Herr Kostoff eine eigene Export-Import-Firma gegründet, am Opemring. Trotzdem hat er die Zeit, in der er bei uns gewohnt hat, ndit vergessen. Wenn ich etwas brauche, einen Staubsauger, einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine, besorgt er es mir durch seine Firma mit dreißig Prozent Rabatt. Wenn Sie einmal etwas kaufen wollen, sagen Sie es mir nur, ich werde es Ihnen über die Firma Kostoff billiger besorgen. Sehen Sie, da liegt der Unterschied. Auch Herr Raikow, mein erster Mieter, hat ein Geschäft; gleich da in der Kochgasse, aber bei ihm kann man nichts kaufen. Ich habe ihn einmal anstandshalber besucht. Er hat in seinem Laden nur Gerumpel, mit dem man nichts anfangen kann.
Ich wollte Ihnen aber noch von meinen anderen Mietern erzählen. Der nächste, der bei mir gewohnt hat, war ein Amerikaner. Ein Sänger. Zu Anfang habe ich mich gefreut, daß unser schöner Flügel nach langer Zeit wieder einmal zu Ehren kommt. Mister Colhoun hat sicii nämlich selbst begleitet, wenn er geübt hat. Meistens hat er sich aber begleiten lassen, und zwar immer von jungen Damen, die er ziemlich oft gewechselt hat. Er hat auch mit Damen im Duett gesungen. Da hat er sie beide selbst am Klavier begleitet. Aber das waren bei weitem nicht alle Damen, die zu ihm gekommen sind. Er hat immer wieder Verehrerinnen nach Hause geschleppt, Damen der Gesellschaft, junge Mädchen oder einfach Schlampen, die er gerade erwischt hat. Das hätte mich alles nicht gestört, Mister Colhoun war ansonsten sehr großzügig und hat uns immer mit amerikanischen Konserven zum Selbstkostenpreis versorgt, ich habe aber den Lärm nicht ausgehalten. Ich hätte diesen Mister Colhoun am liebsten hinausgeworfen, ich habe mich aber nicht getraut, weil er als Amerikaner irgendwie zur Besatzungsmacht gehört hat. Als er endlich nach Deutschland gezogen ist, habe ich vor Freude im Erkerzimmer getanzt. Mein nächster Mieter war ruhig. Ein Inder, der Medizin studiert hat. Als ich gesehen habe, wie er auf dem Klavierdeckel seine medizinischen Präparate ausbreitet und daneben sein Butterbrot streicht, habe ich den Flügel verkauft und statt dessen einen großen Tisch in das Erkerzimmer gestellt. Aber ansonsten war dieser Inder ein wirklich ruhiger Mann. Er ist so leise durch den Korridor gegangen, daß ich ihn nicht gehört habe. Oft war ich erschrocken, wenn ich ihn plötzlich vor mir gesehen habe, ich meine, das Gesicht habe ich gar nicht gesehen, wfeil es bednähfe igchwarz war, scmdOTh nur den weißen Turban, den er immer getragen hat. Das war schon unheimlich.
Mein nächster Mieter, ein Perser, der Jus studiert hat, war wieder ein Revoluzzer. Als der persische Schah einmal Wien besucht hat, ist mein Mieter mit eingeschlagenem Kopf nach Hause gekommen. Ich mußte ihn wochenlang pflegen, weil er nicht ins Spital gehen wollte. Sicher hat er Angst vor der Polizei gehabt, die hatte ihn nämlich schon einmal eingesperrt. Man hat nur Kalamitäten mit diesen Ausländem, sage ich Ihnen. Den nächsten Burschen, der bei mir gewohnt hat, einen Araber, bei dem ich mich vergewissert habe, daß er sich für Politik nicht interessiert, habe ich wieder um drei Uhr nachts im Gang erwischt, wie er nur mit Socken und Unterhosen ins Zimmer meiner Enkelin geschlichen ist Wer weiß, was passiert wäre, hätte ich nicht mitten in der Nacht einen Durst auf Bier verspürt. Wir hatten am Abend Kalbsgulasch mit Nok-kerln gegessen. So bin ich vor Durst wach geworden. Ich will in die Küche und sehe plötzlich den Strolch vor mir. Ich habe gleich den Besen gepackt und ihn damit ordentlich verdroschen. Ich hätte das sogar getan, wenn sein Großvater der König Ibn Saud gewesen wäre. Wenn es um meine kleine Trude geht, kenne Ich keinen Pardon. Na, sie ist Gott sei Dank schon verheiratet, so daß ich wenigstens diese Sorge los bin. Sie hat einen sehr braven Mann. Er ist bei der Mineralölverwalttmg angestellt. Jetzt habe ich zwei deutsche Studenten bei mir. Die sind auch sehr brav und anständig, obwohl sie lange Haare und Barte tragen. Aber sie baden fast Jeden Tag, was Ich schon übertrieben finde, und ihre Eltern schicken immer regelmäßig die Miete. Die D-Mark soll die beste Währung der Welt sein. Einmal war ich nicht wenig erschrocken, als ich im Erkerzimmer cJie Bücher von diesem Mao Tse-tung gefunden habe, aber dann habe ich mir gedacht, China ist weit, es kann ohnehin nichts passieren — oder glauben Sie, daß es doch gefährlich ist, solche Bücher im Haus zu haben?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!