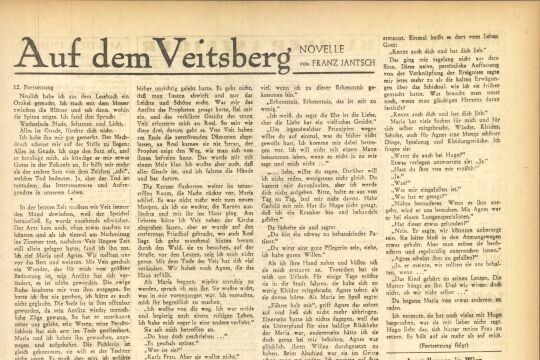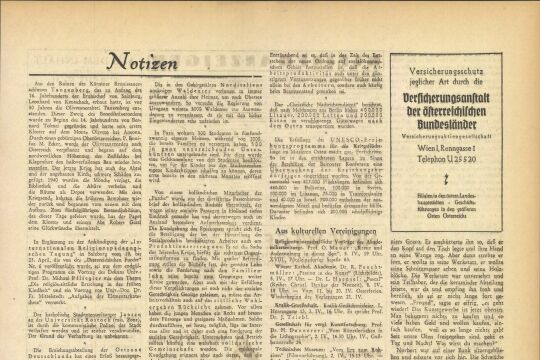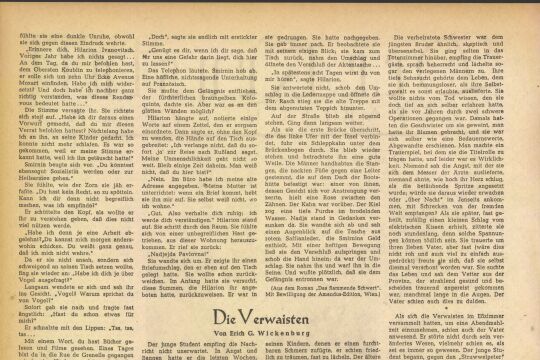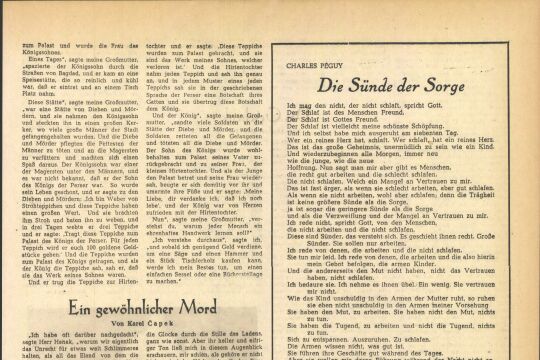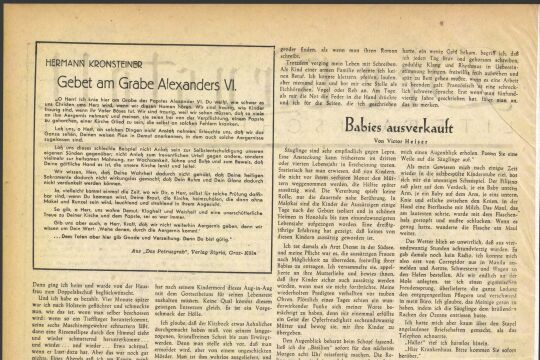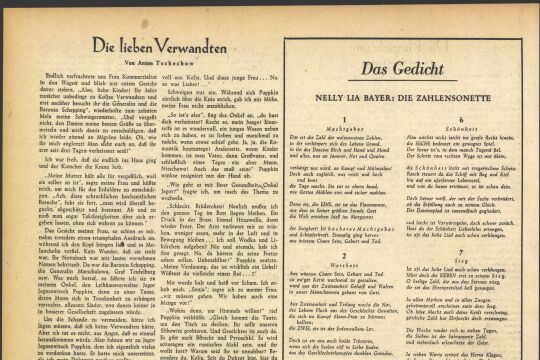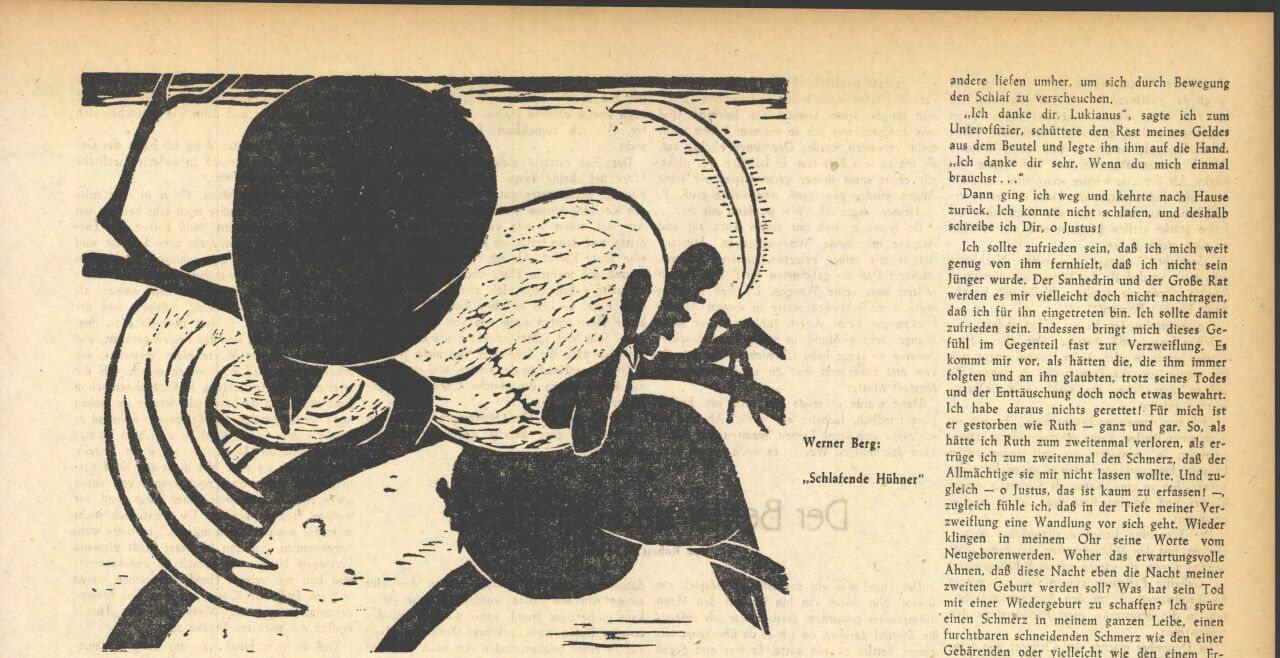
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Frau M. H. gewidmet...
Die liebe Frau meines Freundes wird es mir verzeihen, wenn ich — nach Schilderung der wesentlichen Begleitumstände — hier ihre Geschichte fast wörtlich nacherzähle.
Es war damals Ostern, und wir fuhren durch eine ziemlich langweilige Gegend einer großen Stadt zu: mein Freund, ich, ein älterer Herr, der viel schlief, eine junge Frau, dem Fehlen des Eherings nach allerdings unverheiratet, eine alte Dame. Das Abteil in dem neuen Wagen war bequem, wir selbst alle sehr ruhig, es war ein gutes Reisen. Einmal, schon in der ersten Dämmerung, öffneten wir das Fenster, um frische Luft einzulassen, da läuteten irgendwo in der Ebene draußen Glocken. Dies und der milde Abend, die ganze Stimmung der Auferstehungszeit auch, die den einen vor- und den anderen zurückdenken ließ, das alles zusammengenommen brachte es mit sich, daß wir zu sprechen begannen. Zunächst waren es kleine, freundliche Bemerkungen, die wir einander sagten, da und dort wurde eine teilnehmende Frage gestellt, und die alte Dame erzählte schließlich,daß sie zu ihrer Tochter und den Enkelkindern fahre. Sie zeigte ein Bild herum, auf dem Isolde und Johannes zu sehen waren, und im weiteren Gespräch ergab sich, daß wir alle Kinder oder doch, wie etwa mein Freund, Nichten und Neffen hatten. Nur die junge Frau — sie mochte fünfundzwanzig, auch ein bißchen älter oder jünger sein — äußerte sich nicht, bis der ältere Herr sie geradehin darum fragte:
„Ach ja“, antwortete sie, „natürlich habe ich auch Verwandte, und...“ Sie sprach den Satz aber nicht zu Ende, als hinderte sie irgend etwas daran. Sie nahm auch ihr Handtäschchen und wollte uns damit ablenken.
„Und ...“, fragte ich deshalb vorsichtig. Sie saß ja an meiner Seite. „Und ... ?“
,,. .. einmal war ich auch Mutter.“
Der Zug verlangsamte in diesem Augenblick die Fahrt, deutlich war die Bremswirkung zu spüren, und dann fuhr er in eine Halle ein. Die alte Dame verabschiedete sich und stieg aus, durch das geöffnete Fenster war zu sehen, wie sie von einer jungen Frau und deren Mann empfangen wurde, auch die Enkelkinder waren dabei. Reisende stiegen zu und sahen in unser Abteil, gingen aber vorüber und ließen uns allein. Als der Zug wieder weitereilte, kam der Schaffner und schaltete das Licht ein; er unterwies uns, wie wir es für die Nachtfahrt auf halbe Stärke stellen könnten und wir beließen es auch gleich dabei.
, „Gestorben?“ fragte ich meine Nachbarin sehr leise, so daß sie das Wort auch überhören konnte, wenn sie wollte. „Verloren? Krankheit? Flucht? Bomben?“
Sie schüttelte den Kopf. „Ganz anders.“
Ic,h schwieg und wartete. Der ältere Herr schlief bereits wieder. Mein Freund neigte sich ein wenig vor, die Frau besser zu sehen. Sie saß in ihrer Ecke, den Kopf an die Ohrenstützen gelehnt...
„Ich war damals noch sehr jung“, begann sie nach einer Weile, „kaum achtzehn, dazu kriegsgefangen. Ja“, erwiderte sie, „mit einem ganzen Lazarett kriegsgefangen, wie es gegen Ende des Krieges hin so ging. Kaum als Schwester eingekleidet und kommandiert, und schon kriegsgefangen!
Die Franzosen ließen uns zunächst weiterwerken, mit den Medikamenten, die genug vorhanden waren, sie Wiesen uns auch Lebensmittel zu. Geheilte Patienten gingen von uns aus in die Landwirtschaft, zu den Aufräumungsarbeiten, in die Bergwerke, neue Patienten wurden eingewiesen.
Im Dezember machte der Chefarzt den französischen Kommandanten aufmerksam, daß es notwendig sei, eine Lungenstation einzurichten. Immer mehr so junger Kerle kamen ja, geschwächt vom Hunger und der schweren Arbeit, und hatten Schaden davongetragen. Der Kommandant war einverstanden, der Chefarzt hatte einige Schwierigkeiten, das Personal aufzutreiben, es mußte ja von den anderen Stationen abgezogen werden. Niemand hatte eine rechte Freude damit, es hieß doch Abschied nehmen von Aerzten, Mitschwestern und Patienten, an die man sich gewöhnt hatte. Ich wurde auch überstellt.
Auf der neuen Station begann ein ganz anderes Leben. Sie werden mich verstehen, ich hatte bisher nie mit Infektionskrankheiten zu tun gehabt, hier gab es auch und hauptsächlich Tuberkulose. Erst glaubte ich eine Zeit, nicht mehr richtig atmen zu dürfen, und war nahe daran, um Rückversetzung zu bitten. Dann kam ich eines Tages, rein zufällig eigentlich, in eines der Zimmer, wo die Schwerkranken lagen, die hoffnungslosen Fälle. Sie wurden von einer ätteren Schwester betreut, ich hatte ihr irgendeine Botschaft zu sagen. Der Eindruck, den ich empfing, war erschütternd. Ich hatte auch bisher schon sterben gesehen, nach vergeblichen Operationen zumeist, aber es war doch beinahe immer bis zum letzten Augenblick eine Hoffnung gewesen. Hier siechten sie dahin, bei bestem Willen nicht genügend ernährt, ohne die richtigen Medikamente, fieberten und sehnten sich heim, in ein wirkliches oder auch nur erträumtes Paradies, das sie nie mehr sehen würden.
Als die Mitschwester erkrankte, meldete ich mich an ihre Stelle. Der Chefarzt fand mich ein bißchen jung, aber schließlich war er froh, nicht einfach eine Kraft kommandieren zu müssen. Die Angst hatte ich ja längst abgelegt, nur manchmal, an schwachen Tagen, fühlte ich sie noch.
Ich war etwas über einen Monat hier beschäftigt, es ging gegen Ostern zu, wurde wieder so ein junger Kerl eingeliefert. Seinem Soldbuch nach war er neunzehn, und er mußte einmal ein schöner, lebfrischer Junge gewesen sein. Nun war er am Ende: ausgehungert, halb zu Tode gerackert, mit weit fortgeschrittener Tuberkulose. Er hieß Heiner und war für alles so dankbar, für jeden Handgriff, für jeden Tropfen Obstsaft, für jedes gute Wort. Als ich einmal am Abend, knapp vor dem Lichterlöschen, an seinem Bette stand, zeigte er mir das Bild seiner Mutter. Sie war eine noch junge, hübsche Frau. Wenn ich die Schwesternhaube abgelegt hatte, trugen wir die gleiche Frisur.
,Arme Mutter', dachte ich. Es war unbekannt, ob sie noch lebte, eine briefliche Verbindung zwischen ihr und Heiner bestand seit den letzten Kriegsmonaten nicht mehr.
Am Abend des Karsamstag ging ich in die Stadt zum Friseur. Das war uns machmal erlaubt, am Ostersonntag sollten wir — unter Aufsicht natürlich — auch ein Kino besuchen dürfen. Während des Heimwegs setzte ich die Haube nicht auf, es war mild draußen, und es tat so gut, gepflegtes, lockeres Haar zu tragen. Als ich in meinem Zimmer vor dem Spiegel stand, einmal zu sehen, wie ich mich eigentlich als Mädchen ausnähme, wurde ich gerufen: es gehe zu Ende mit Heiner, und er verlange mich.
Ich erschrak so sehr, daß ich unmittelbar vom Spiegel weglief und die Haube zu nehmen vergaß. Heiner lag sichtlich in schwerem Fieber, sein junges, armes Gesicht war hochrot. Und nun geschah, was ich in meinem Leben nicht mehr vergessen werde! Der Junge blickte auf, als ich an sein Bett trat. Er lächelte aber nicht, wie er es sonst immer getan hatte, nur seine Augen wurden ganz groß, unnatürlich groß.
.Heiner', sagte ich. ,Was ist denn mit dir?'
Da setzte er sich mit einem Ruck auf und streckte mir beide Arme entgegen. .Mutter!' rief er mit seiner belegten, heiseren Stimme, .Mutter! Daß du gekommen bist!' Die Tränen rollten über seine Wangen. Ich ließ mich in seine Arme schließen, hatte in diesem Augenblicken gar keine Angst, fühlte, wie er seine Wange, seinen Mund in mein Haar drückte. .Mutter, so lange habe ich nichts mehr gewußt von dir! Und jetzt bist du wiedergekommen! Mutter! Mutter!'
Dann wurde er müde und sank um. Er lag ganz friedlich, lächelte ein wenig. Ab und zu schlössen sich seine Lippen, formten den ersten Laut des heiligen Wortes. Es noch einmal ganz auszusprechen, war er nicht mehr imstande. Ich lief in die Stationsküche, kochte ihm — noch immer offenen Haares — Orangenblätter-tee. Als ich zurückkam, lebte Heiner nicht mehr...“
Der Zug ratterte gleichmäßig weiter. Kein Wort fiel, keine Frage war zu hören, keine Regung. Nach einer guten Weile ging ich in den Korridor hinaus, eine Zigarette zu rauchen. Aus der einen wurde eine zweite und eine dritte, und dann trank ich im Speisewagen noch eine Tasse Kaffee. Als ich zurückkam, saß der Freund auf meinem Platz und sprach mit der ehemaligen Schwester. Ich setzte mich in die freie Ecke, er ließ es ohne Einwand zu. Der ältere Herr schlief nach wie vor. Ich tat ihm nach. Sehr viel später erwachte ich einmal, da schliefen auch die Schwester und mein Freund. Er hielt ihre Hand in der seinen, und sie hatten die Köpfe gegen die gleiche Ohrenstütze gelehnt.
Ich sah auf die Uhr. Mitternacht war schon vorüber, es ging bereits dem Ostersonntag entgegen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!