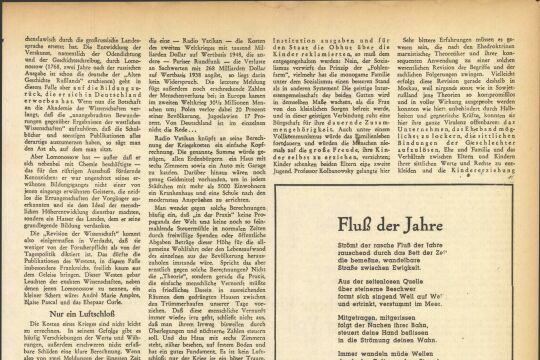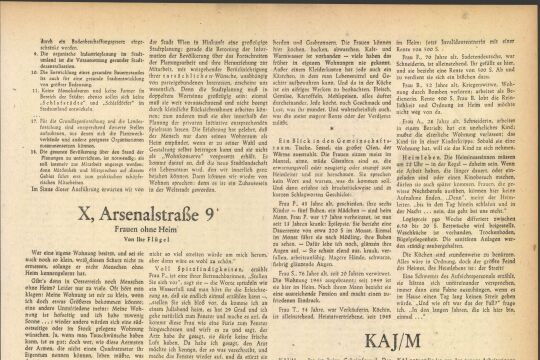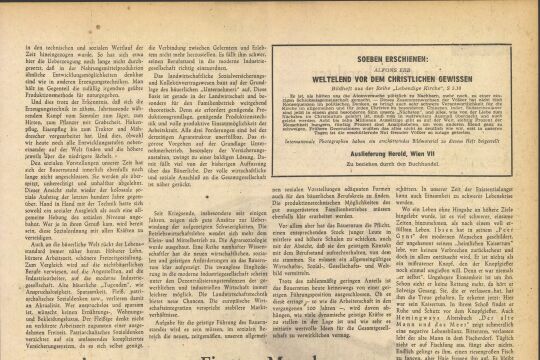Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Menschen auf der Schattenseite
Der größte Wunsch ist ihr erfüllt worden: ein Einbettzimmer im St.-Ro- chus-Heim, einem der Pflegeheime der Stadt Wien. In ein öffentliches Altersheim zu kommen, ist in der Regel das Schreckgespenst jedes Alternden. Sie aber hat in ihrem Leben nichts anderes gekannt als Heime, als diese Institutionen, die alles andere sind als ein Heim, eine Heimat. Kinde r-Siechen- heim, Obdachlosenheim, Altersheim: das sind die Stationen auf dem Lebensweg der Marie P. Wobei die letzte Station, das Altersheim Baumgarten, seit über dreißig Jahren ihr Aufenthalt war; vorher verbrachte sie zehn Jahre im Altersheim Liesing. Das Einbettzimmer in St. Rochus ist das Non- plus-ultra.
Vor kurzem feierte Marie P. ihren 70. Geburtstag. Das bedeutete verschiedene Einladungen, das bedeutete Geschenke, das bedeutete, im Heim ein Mittagessen nach Wunsch bekommen: Wiener Schnitzel und Salat. 70 Jahre - und davon 42 im Altersheim. Das bedeutet, daß über eine 28jährige das „Lebenslänglich“ im Altersheim gesprochen wurde. Kann ein Mensch das ertragen?
Marie P. hat gelernt, sich mit wenigem zufrieden zu geben. Sie hat es bereits in einem Alter lernen müssen, da andere anfangen, das Leben zu entdecken. Mit fünf Jahren an Knochentuberkulose erkrankt, lebte sie 14 Jahre in Spitälern und Heimen, wurde immer wieder operiert, mußte sich ein Bein amputieren lassen, bis sie schließlich nfit 19 entlassen wurde.
Aber was macht eine 19jährige, voll von Narben, einbeinig, ohne jede berufliche Ausbildung, sogar ohne abgeschlossene Volksschule, in der Krisenzeit der späten zwanziger Jahre? Die Eltern hatten sich kaum mehr, um die Kranke gekümmert, waren schließlich nach Deutschland übersiedelt, die Mutter war gestorben, der Vater hatte wieder geheiratet.
Ganz allein auf sich gestellt, mit einer Pfründe von monatlich 30 Schilling - wie soll man da existieren, wenn das Bett im Obdachlosenasyl im Monat 25 Schilling kostet und ein Mittagessen dort einen Schilling? Wovon soll man an den übrigen 25 Tagen leben?
Es gab unentgeltliche Kurse einer karitativen Organisation für körper- behinderte Mädchen. Dort konnte man Maschinnähen lernen. Was aber macht man, wenn die Beinprothese daran hindert, das Pedal der Nähmaschine zu betätigen? Mit leichten Arbeiten im Haushalt konnte Marie sich immer wieder für kurze Zeit über Wasser halten. Immer nur kurze Zeit, dann war die Invalide für „die Herrschaft“ doch nur ein unnützer Esser, es warteten ja damals auch gesunde Mädchen auf eine Stelle.
So blieb dann schließlich nur mehr das Altersheim für eine junge Frau von 28 Jahren.
Jetzt weiß Marie P., daß sie sich an jedem Tag satt essen kann, daß sie sogar die Diät bekommt, die sie als schwer Zuckerkranke braucht. Sie wird ärztlich betreut, sie hat ein warmes Zimmer. Jetzt sogar ein Einzelzimmer! Sie braucht jetzt nicht mehr zu bangen, daß eine neue Bettnachbarin geistig verwirrt ist, daß sie aggressiv ist oder unsauber, daß sie nach kurzer Zeit stirbt. Es waren nicht wenige Nächte, in denen der Todeskampf einer Zimmergenossin, ihr letztes Röcheln, an keinen Schlaf denken ließ.
Ist Marie P. lebensüberdrüssig, verflucht sie dieses Leben, das ihr seine schönen Seiten vorenthalten hat? „Der Herrgott und mein Humor haben mir immer noch geholfen, und die Hoffnung habe ich nie aufgegeben!“ ist ihre Antwort. Sie argumentiert nicht, wie es heute modern ist: „Wenn soviel Elend in der Welt existiert, kann es keinen gütigen Gott geben.“ Sie ist selbst mitten drin in diesem Elend und weiß sich nicht verlassen.
Und der Humor - wo nimmt sie ihn her? Wo es heute doch geradezu frevelhafter Leichtsinn ist, nicht vom Bewußtsein des Leidens niedergedrückt zu werden. Sie lebt im Leiden, aber sie lacht gerne, und wenn es ihr gesundheitlich nicht zu schlecht geht, möchte sie 100 Jahre alt werden. Sie betet auch gerne, hauptsächlich für andere. Die Anliegen, für die sie sich im Gebet einsetzt, sind in guten Händen. Marie P. führt hier genau Rechnung: Ebensoviele Gebete wie jene, in denen sie um etwas gebeten hat, werden nachher als Dank verrichtet. „Aufs Danken darf man nicht vergessen!“
Es gibt auch in diesem Leben Lichtblicke. Marje„P. war schon mit dem „Sonnenzug“ und dem „Sonnenschiff“ unterwegs, war mit den Maltesern in Rom und will in diesem Jahr zum dritten Mal mit dem Pilgerzug nach Lourdes fahren. Bei diesen Gelegenheiten stehen die Kranken im Vordergrund, hier erfahren sie echte Fürsorge, freiwillige Hüfsbereitschaft. Die Vorfreude und die Erinnerung an diese Tage helfen wieder einige Zeit über das Grau des Alltags hinweg.
Marie P. lebt in und von unserem Sozialstaat, sie hätte ohne ihn keine Chance gehabt, ihren 70. Geburtstag zu feiern, ihn überhaupt zu erleben. Sie hat keine Verwandten, die sie aufnehmen könnten. Sie konnte in keinem Haushalt so lange arbeiten, daß ihr jetzt, im Alter, das „Gnadenbrot“ gereicht würde. Sie konnte keine Versicherungsbeiträge zahlen, so steht ihr keine Rente zu. Aber der Sozialstaat sorgt für sie, sie muß nicht hungern, sie muß nicht frieren, sie bekommt monatlich 250 Schilling Taschengeld.
Sie lebt in einem Pflegeheim wie Tausende andere.
Der Unterschied ist nur, daß sie lächelt, wenn Neuankömmlinge meinen, es dort nicht aushalten zu können. Sie hat es in über 40 Jahren gelernt. Mit ihren 70 Jahren gehört sie zu den Jüngeren. Mit ihrem einen Bein, der Zuk- kerkrankheit, dem grauen Star, dem hohen Blutdruck gehört sie noch immer zu den Gesünderen, und die Frau ohne Schulbildung gehört auch zu den geistig Regeren ihrer Umgebung. Andere kommen ins Altersheim, wenn sie ihr Leben hinter sich haben, ein Leben mit frohen und schweren Stunden, mit Freuden und Leid. Marie P. hat ihr Leben dort verbracht. Andere kommen ins Altersheim, wenn die Angehörigen ein pflegebedürftiges, altes Familienmitglied daheim nicht mehr versorgen können… oder nicht mehr wollen. Um Marie P. haben sich nie Angehö rige gekümmert. Sie ist das Modell eines „Fürsorgefalles“, und Fürsorgefälle sind doch die, für die nie jemand Sorge trägt, die nie für jemanden Sorge tragen.
Wie viele Fälle wie Marie P. gibt es in Wien, in Österreich, in Europa? „Körperbehinderte“, wie solche Menschen diskret genannt werden, Körperbehinderte, für die in unserer Leistungsgesellschaft kein Platz ist. Sie werden versorgt, sie müssen keine Not leiden. Wer Not gelitten hat, weiß, wieviel das wert ist. Aber sie leben im Ghetto.
Unsere Zeit kann sich rühmen, viele Schranken abgebaut zu haben, viele Gegensätze ausgeglichen zu haben. Die Kluft zwischen Gesunden und Behinderten besteht. Von seiten der Gesunden wird den Kranken Mitleid entgegengebracht, das ist schon etwas - aber es ist zu wenig.
Mitleid hat nichts mit Gleichberech tigung zu tun. Mitleid hat schon gar nichts zu tun mit der radikalen Forderung „Was ihr dem Geringsten tut, das tut ihr mir!“ Für den Christen darf es nicht genug sein, für den Lebensunterhalt des ändern zu sorgen und ihn gnadenhalber zu besuchen oder einzuladen. Martin Buber läßt in seinen „Erzählungen der Chassidim“ den Rabbi Schmelke sprecheii: „Mehr als der Reiche dem Armen gibt, gibt der Arme dem Reichen. Mehr als der Arme den Reichen braucht, braucht der Reiche den Armen.“
Diese Gedanken sind nicht leicht anzunehmen, und es ist nicht leicht, den Kontakt mit Behinderten auf eine andere Basis als auf die des Mitleids zu stellen. Gönnermiene auf der einen Seite, Neid auf der ändern sind tief verwurzelt, zu tief, als daß daraus ohne große Mühe Partnerschaft entstehen könnte.
Der Behinderte in der Abgeschlossenheit seiner Welt, ohne Verantwortung, ohne regelmäßigen Pflichtenkreis, ist eingeschlossen in die Egozentrik seiner bescheidenen Wünsche, seiner Beschwerden. Der Gesunde ist zerrissen zwischen Pflichten und Verantwortung in Beruf und Familie, ist zerrieben zwischen Terminen. Die Hektik des Gesunden irritiert den Kranken, die Kleinlichkeit des Kranken macht den Gesunden nervös. Sie haben es verlernt, sich aneinander anzupassen, miteinander zu leben.
Die Parole „Die Gesellschaft ist schuld“ ist zu billig, trotzdem aber müßte ein strukturelles Umdenken erfolgen. Man kann von Behinderten keine Arbeitsleistung von 40 Stunden » verlangen, man kann ihnen nicht jede Arbeit zumuten. Ganz wenige aber nur sind so schwer behindert, daß es gerechtfertigt wäre, sie in der abhängigen Rolle des Almosenempfängers festzunageln. Das körperliche Leiden einzelner, die seelische Verfassung vieler könnte gebessert werden, wenn Behinderte und Gesunde gemeinsam arbeiten, gemeinsam ihre Freizeit verbringen könnten. Es ist unchristlich, dem Anblick Behinderter auszuweichen, die Tatsache ihrer Existenz verdrängen zu wollen.
Die 70jährige Marie P. kann heute keine Arbeiten mehr übernehmen. Hätte sie als 17jährige eine entsprechende Ausbildung erhalten, wäre ihr ein Leben im Pflegeheim erspart geblieben. Sie hat einige Jahre die Bibliothek in Baumgarten betreut, solange, bis diese Bibliothek aufgelassen wurde. Es war ihre schönste Zeit im Heim. Konnte sie diese Aufgabe ohne jede Schulbildung bewältigen, so hätte sie bei entsprechender Schulung ihren Lebensunterhalt als Bibliothekarin verdienen können.
Wird in unserem Sozialstaat alles getan, um auch den behinderten Menschen nach seinen Möglichkeiten zur Selbständigkeit anzuleiten und dadurch in die Gemeinschaft zu integrieren? Wird nicht immer wieder der Weg des geringeren Widerstandes eingeschlagen, auf dem der Behinderte zwar existieren kann, aber nicht weitergeführt wird? Gäbe es hier nicht große Möglichkeiten für eine wahrhaft christliche Sozialpolitik?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!