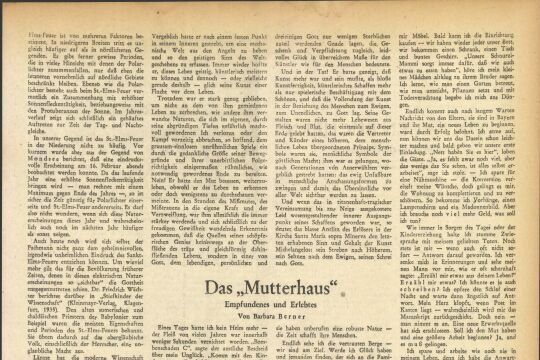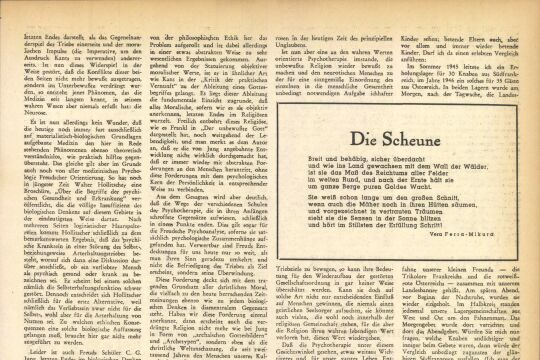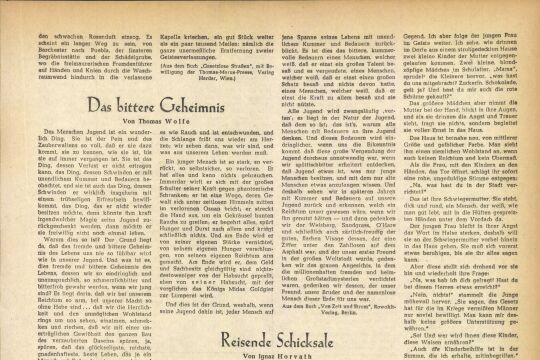Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Geboren, um zu sterben
Es gibt Krankheiten, die lassen uns Menschen nach dem Sinn des Lebens und den Gesetzen des Schicksals fragen. Die Mukopolysaccharidose ist eine solche Krankheit. Sie ist vielleicht sogar schicksalhafter als andere, sie macht betroffener als andere. Denn die Mukopolysaccharidose ist eine Erbkrankheit, die das Siegel der Endlichkeit von der ersten Sekunde des Lebens an mit sich trägt. Sie trifft nur ganz wenige - nicht mehr als 100 Kinder sind es in Österreich zur Zeit - aber wer wird ausgewählt?
Da gibt es keine Frage nach der Schuld, keine Antwort auf das Warum. Es zählt, was ist: Die Muko- polysaccaridose bedeutet ein Leben mit dem Tod.
Die Krankheit macht hilflos. Ärztliches Können vermag da nichts auszurichten. Mit dem Fortschreiten der Krankheit verlernen die Kinder langsam alles, was sie einmal gekonnt haben. Sie schreiten mit fortlaufendem Leben quasi vom Leben zurück, aus dem Leben heraus: Schritt für Schritt…
All das macht Angst. Nicht nur den Eltern. In einer Gesellschaft, die den Tod aus ihrem Alltag abgeschoben hat, werden diese Eltern zu Außenseitern, denn sie leben mit dem Tod. Und sie verändern sich.
Loslassen, Hergeben, was man liebt: Das ist die Devise für diese Menschen. Manche zerbrechen daran, schaffen es nicht: Es gibt Männer, die ihre Familien verlassen, viel Alkohol, zerbrochene Ehen, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es da Menschen, die das Schicksal offenbar an den Kem des Lebens und seines Sinns getrieben hat. Freundliche, warme Menschen, die wahrscheinlich vom Leben soviel mehr wissen, weil sie den Tod so genau kennen.
Bei der Mukopolysaccharidose geht es, wie gesagt, um das Hergeben, das Loslassen. Akzeptieren, was ist. Martha Ziegler, Mutter eines fünfjährigen erkrankten Sohnes, hat, so sagt sie, zwei Jahre dafür gebraucht.
Ein Schlüsselerlebnis dabei war das Familientreffen des erst neu gegründeten Selbsthilfevereins. 100 Familien aus Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz kommen seit wenigen Jahren einmal im Jahr zusammen. Martha Ziegler war dabei; die Diagnose hatte sie erst wenige Wochen zuvor erfahren:
,Als ich alle diese Kinder sah, wollte ich auf und davon. Ich habe gesagt, ich muß weg, ich halte es nicht aus, iqh schaffe es nicht. Man hat mich beruhigt, mir zugespro chen: ‘Bleiben Sie, geben Sie nicht auf, schauen Sie sich das an, die Kinder sind alle lieb. ‘Dann habeich mich eingestellt und hab’ mir gedacht: Du mußt es schaffen und Du schaffst es!“.
Für die Eltern ist das Familientreffen der Selbsthilfegruppe -es ist international, denn die betroffenen Familien sind wenige - meistens die erste Gelegenheit, andereKinderm.it derselben Krankheit zu sehen, an älteren Kindern zu erkennen, was in absehbarer Zukunft auf sie zukommen wird. Gewißheit klärt, Klarheit kann helfen, auch wenn Hoffnungen zerschlagen werden. Die Tatsache, daß man mit diesem Schicksal nicht allein ist, beruhigt. Das ist der Wert dieser Familientreffen.
Bedenklich bleibt das Ganze trotzdem. In der deutschen Gruppe gibt es einen Mann, der ein Kind adoptiert hat, nicht ahnend, daß es den letalen Enzym-Defekt der Mukopolysaccharidose hat. Die Selbstverständlichkeit, mit der dieser Mann zu seinem kranken Adoptivkind steht, beschämt, stimmt nachdenklich. Es scheint, als ginge es,hier um eine Chance, die das Schicksal gewährt, um an denen zu wachsen, die mit dem Tod leben müssen!
Sie gab uns etwas Besonderes: Sie füllte unsere Herzen mit Sonnenschein, machte uns sensibler und feinfühliger
Im nachhinein überlege ich mir oft: Wie konnte ein Kind mit größter körperlicher und geistiger Behinderung unser Leben verändern? Die Worte aus dem zweiten Korinther brief an Paulus gewinnen Bedeutung: “Laß Dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“
Im September 1986 war Barbara sechs Jahre. Die Krankheit hatte sie gezeichnet. Mit ihren Tatzenhändchen konnte sie kein Bilderbuch mehr umblättern, und sie hatte auch das Interesse dafür verloren. Sie lag in ihrem Buggy und wartete. Geduldig. Sie konnte uns nichts mehr sagen und nahm nur noch flüssige Nahrung zu sich. Manchmal weinte sie still vor sich hin, und wenn ich ihr Schmerztabletten gab, hörte sie auf zu weinen.
In der Nacht hatte ich sie neben meinem Bett in ihrem Wägelchen stehen, denn sitzend konnte sie besser atmen. Oft beobachtete ich sie besorgt Wird sie den nächsten Atemzug machen? Die Abstände waren sehr groß. Wieder stand der Tod neben uns.
Die Arzte meinten, daß sie wieder an Himdruck leide. Schweren Herzens willigten wir in eine Operation ein. Vielleicht kann sie mit dem „Shunt“ wieder gehen, vielleicht lacht sie wieder wie früher!
Die schlimmste Zeit in meinem Leben ist jene gewesen, in der Barbara auf der Intensivstation lag. Plötzlich waren wir getrennt, und ich hatte das Gefühl, in einer Weise versagt zu haben und sie im Stich gelassen zu haben. Nackt und fiebrig lag sie, angeschlossen an schrecklich viele Schläuche und wurde künstlich beatmet. Manchmal ging es ihr besser und ich war gleich voller Hoffnung, manchmal war ich todtraurig.
Endlich eine freudige Botschaft: Sie ist von der künstlichen Beatmung los. Ich kann bei ihr sein, wenn ich Zeit und Lust habe, und bei nächster Gelegenheit würde ich sie nach Hause nehmen.
Barbara kämpfte und gab nicht auf. Schon öfters hatte sie dem Tod ein Schnippchen geschlagen, doch am Palmsonntag 1987 nahm Gott sie zu sich.
Jeder Tag, an dem man einen geliebter! Menschen verliert, ist zu früh. Als sie so gewaschen mit einem frischen Hemdchen friedlich vor mir lag, erlöste mich ihr entspanntes Gesichtlein von meinen Sorgen, und ein großer Friede umgab auch mich. All die Ängste, all die Sorgen, alles Schwere durften wir in ihr Grab legen. All das Schöne durften wir in Erinnerung behalten.
Informationen: Gesellschaft für Mukopolysačcharido- sen. Oben Augartenstraße 26-28.1020 Wien.
TeL: 35 23 48
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!