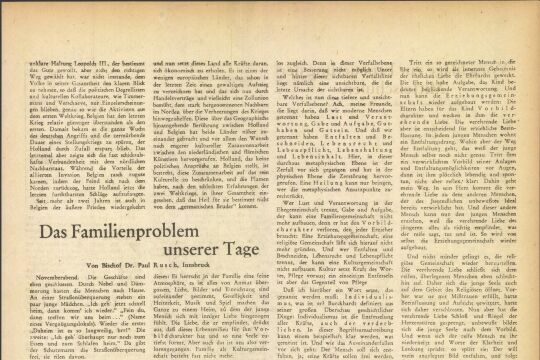Bis zuletzt ein soziales Wesen
Wie leben Menschen, die eine schwere oder tödliche Krankheit haben? Wie werden sie damit fertig? Diese Frage ist nicht nur für jene wichtig, die sie unmittelbar betrifft, sondern auch für alle anderen. Sie geht uns alle an, denn der Tod ist unvermeidlicher Bestandteil jeden Lebens, er wird Existenz im Augenblick der Geburt, bleibt unberechenbarer Faktor, um schließlich den einzelnen zu besiegen. Eine Tatsache, die allerdings in unserer Diesseits-orientierten, auf Leistung, Konsum und materiellen Wohlstand ausgerichteten Gesellschaft verdrängt und ungern wahrgenommen wird.
Wie leben Menschen, die eine schwere oder tödliche Krankheit haben? Wie werden sie damit fertig? Diese Frage ist nicht nur für jene wichtig, die sie unmittelbar betrifft, sondern auch für alle anderen. Sie geht uns alle an, denn der Tod ist unvermeidlicher Bestandteil jeden Lebens, er wird Existenz im Augenblick der Geburt, bleibt unberechenbarer Faktor, um schließlich den einzelnen zu besiegen. Eine Tatsache, die allerdings in unserer Diesseits-orientierten, auf Leistung, Konsum und materiellen Wohlstand ausgerichteten Gesellschaft verdrängt und ungern wahrgenommen wird.
Das „Leben mit dem Tod“ wird nur von schwerkranken Menschen unmittelbar und direkt erfahren. Ihr Leiden erinnert sie ständig an ihre Vergänglichkeit, das „Zwischenstadium Leben“ erscheint verkürzt, bedroht, in Frage gestellt. Zu den physischen Schmerzen gesellt sich Angst. Wobei es individuell sehr verschieden ist, wie diese Todesnähe innerlich verarbeitet wird.
Manche Menschen lehnen sich auf, hadern, fragen: warum ausgerechnet ich? Andere fügen sich drein, nehmen an, versuchen auch jetzt positive Seiten zu entdecken. Das Bewußtsein, daß jeder Tag der Letzte sein kann, gestaltet ihr Leben oft intensiver, kostbarer, auch nachdenklicher, wahrscheinlich tiefer.
Meist durchlaufen Schwerkranke etliche Phasen, ehe sie bereit sind, ihr Leiden anzunehmen und zu akzeptieren. Die erste ist jene des Aufbegehrens, des Nicht-Wahrhaben-Wollens, des Verdrängens. In dieser Phase befindet sich zum Beispiel der
„Das Bewußtsein, daß jeder Tag der letzte sein kann, gestaltet ihr Leben oft intensiver, kostbarer, auch nachdenklicher, wahrscheinlich tiefer“ fünfzigjährige Ingenieur Karl Helmer (alle Namen von Patienten wurden geändert), der einen schweren Herzinfarkt hinter sich hat und praktisch aufgegeben war. Er lag drei Wochen auf der Intensivstation, davon eine Woche im Koma: „Damals habe ich etwas erlebt, das ich mir mit irdischen Dingen nicht erklären kann. Aber darüber möchte ich nicht sprechen.“
Jetzt liegt er bereits die neunte Woche im Allgemeinen Krankenhaus, die Ärzte sagen, es könne unter Umständen noch drei weitere Wochen dauern, sie meinen auch, daß es mit der Berufsausübung vorbei sei, aber der Ingenieur ist nicht dieser Ansicht, er glaubt vielmehr fest daran, wieder gesund zu werden. Einschränken, so meint er, wird er sich halt müssen, nicht mehr so viel von einer Baustelle zur anderen fahren, mehr Bürodienst tun. Vorläufig-allerdings darf er nur zweimal pro Tag kurz und am Arm der Schwester aufstehen. Aber er ist unruhig, möchte schon nach Hause, wieder ein normales Leben führen: „Es wird schon gehen, nur weg von da, und dann wird man weitersehen.“
Ob er nicht Angst hat vor einem neuen Infarkt? Natürlich, schon, aber man müsse nicht das Schlimmste annehmen und halt ein bisserl aufpassen.
Dieses Schwanken zwischen Hoffnung und Verzweiflung, wenn sich die Situation noch nicht eingependelt hat, ist vielleicht das Schwierigste. Und hier spielt der Arzt eine wesentliche Rolle. Er muß den Kranken langsam mit der Unabänderlichkeit einer unheilbaren Krankheit vertraut machen, wobei das Problem vor allem darin hegt: Soll der Patient über seinen Zustand aufgeklärt werden oder nicht? Ist es bei tödlichen Krankheiten besser, die Wahrheit zu sagen, oder die Hoffnung zu erhalten?
Die meisten Ärzte lehnen eine allzu brüske Konfrontierung mit einer möglichen Todesnähe ab mit der Begründung, daß die Medizin auch nicht allwissend sei, daß es Spontanheilungen gebe und daß es unverantwortlich sei, den Kranken sozusagen aufzugeben, indem man ihm die Hoffnungslosigkeit seines Zustandes klarmacht.
Dies auch deswegen,, weil eine günstige psychische Grundstimmung zum Heilungsprozeß gehört. „Dem Patienten wird der Ernst seiner Lage nach Bewußtsein und geistigem Potential mitgeteilt, doch sollte die Hoffnung nicht gänzlich zerstört werden“, meint der Internist Ladislaus Ruis. Eine Aufgabe, der allerdings ein Großteil der Ärzte ziemlich hilflos gegenübersteht. Gewohnt, den Patienten vor allem auf das Funktionieren seiner Organe hin zu untersuchen, hat die reine Organme-
„Dieses Schwanken zwischen Hoffnung und Verzweiflung, wenn sich die Situation noch nicht eingependelt hat, ist vielleicht das Schwierigste“ dizin schon lange den Zugang zur psychischen Komponente der Krankheit verloren. Die meisten Ärzte vermeiden ein derartiges Gespräch überhaupt und überlassen den Patienten damit seinen eigenen Vorstellungen und Ängsten.
Hier vor allem wären die Angehörigen, eventuell auch der Priester berufen, einzuspringen. Beides geschieht, aber geschieht es richtig und in ausreichendem Maß?
Angehörige sind durch die Pflege und Betreuung todkranker oder schwerkranker Menschen häufig überfordert. Solange der Kranke fähig ist, sich selbst zu versorgen, ist die
Situation meist noch tragbar. Kritisch wird sie jedoch, sobald er bett-lägrig und somit auf die Pflege angewiesen ist. Zu Hause bleiben kann er unter solchen Umständen überhaupt nur, wenn zumindest ein Familienmitglied - in der Regel der Ehepartner - nicht berufstätig und daher in der Lage ist, für ihn zu sorgen.
Ist dies nicht der Fall, müssen andere Lösungsmöglichkeiten gefunden werden. Uber das Abschieben alter und kranker Menschen kann das Spitalspersonal allenthalben ein Lied singen. Vor allem um die Weihnachtszeit, aber auch während anderer Feste und Feiertage kommt es häufig vor, daß die bettlägrige Oma oder ein anderes schwerkrankes Familienmitglied in das Krankenhaus gebracht wird, „damit die übrige Familie“, so empört sich ein Spitalspriester, „ungestört auf Urlaub fahren kann“. Diese - tatsächlich vorhandene oder vorgegebene - äußere Belastung der Angehörigen hat Rückwirkungen, hat eine seelische Belastung des Kranken zur Folge.
Dabei wiegt das Bewußtsein, anderen eine Last zu sein, besonders schwer. Das geht manchmal so weit, daß es der Schwerkranke wenn möglich vermeidet, überhaupt irgendwelche Wünsche zu äußern und lieber total bedürfnislos bleibt. Besonders schwierig zu ertragen ist für ihn das Gefühl des Ausgestoßenseins, des Nicht-mehr-Dazugehörens, des Aufgegeben-worden-Seins. Angehörige sollten nach Möglichkeit versuchen, dem Schwerkranken dieses Gefühl zu nehmen und ihn bis zuletzt in ihre Gemeinschaft zu integrieren.
Darin sieht Rektor Alexander Un-ger, der Leiter des Bildungshauses der Diözese Eisenstadt, auch eine Aufgabe des Priesters: „Die Kränkenölung sollte nicht als reines Ritual erfahren werden, sondern als Kommunikation vom Handkontakt bis zum Gespräch.“ Diese diesseitige Interpretation christlicher Glaubenslehre findet sich in der neuen Priestergeneration häufig. „Das Himmelreich beginnt in Euch“, zitiert Rektor Unger, und meint weiter: „Es gibt Lebensqualitäten, die Jenseitscharakter haben: die Geborgenheit in Liebe, das Aufgenommensein in der Gemeinschaft. Der Sterbende sollte integriert sein bis zum letzten Augenblick.“
Der Glaube spielt häufig eine wesentliche Rolle im Leben eines Schwerkranken. Er hilft ihm, sein Leiden zu tragen und zu akzeptieren im Sinne christlicher Demutslehre, die selbst aus dem Leiden Sinnvolles und Positives schöpft.
Den Glauben als wichtigstes Fundament seines Lebens („Weil sonst nichts mir Antwort geben könnte“) betrachtet Herbert Kerbl, Ende dreißig und seit zehn Jahren an Multipler Sklerose erkrankt. Er kann kaum noch gehen, muß im Rollstuhl gefahren werden, kann nicht allein essen, das Sprechen macht ihm Schwierigkeiten. Zusammen mit seiner fast siebzigjährigen Mutter wohnt er in einem „Invalidenhaus“, wie er es nennt, also in einem Behindertenwohnheim.
Er sitzt in einem bequemen Lehnstuhl am Fenster, sehr dünn, sehr bleich, mit gepflegtem Backenbart, aber vom Tod gezeichnet. Und redet, gestikuliert, um jeden Ausdruck bemüht. Läßt sich Fotos bringen: da, das war ich, in Ceylon, bei einem Naturheilarzt, danach ging es mir einige Zeit besser, aber die Wirkung ließ bald nach. Er erzählt seine Krankengeschichte, erzählt von enttäuschten Hoffnungen, von seinem Beruf als „männliche Krankenschwester“, den er ausübte, als er bereits von seiner Krankheit wußte. Er erzählt, wie seine Frau ihn nach einem halben Jahr Ehe verlassen hat, als sie von seiner Krankheit erfuhr. Dann kam eine Freundin, die ihn pflegte, und später noch eine. Und trotzdem: „Der Optimismus soll nicht sterben in mir, er soll die Richtung nach aufwärts zeigen, denn wenn der Optimismus stirbt, ist ein Mensch sehr arm.“
Seine Anstrengungen, beachtet, aufgenommen, ernst genommen, miteinbezogen zu werden, sind erschütternd. Hat er Freunde, Bekannte? „Wenige, eigentlich!“ Manchmal kommen ihn alte Freunde besuchen, noch von früher, aber das wird immer seltener. Und zweimal pro Monat wird er in den MS-Club (Multiple-Sklerose-Club) gefahren, dort trifft er dann Menschen in gleicher oder ähnlicher Situation. „Aber Optimismus sehe ich dort sehr selten.“
Während also das Diesseits für den Schwerkranken als Hebende, in die Gemeinschaft integrierte Geborgenheit erfahren werden sollte, gewinnt für ihn die Frage „Was ist nach dem Tod“? zunehmend an Bedeutung.
„Die meisten Ärzte vermeiden ein derartiges Gespräch überhaupt und überlassen den Patienten damit seinen eigenen Vorstellungen und Ängsten“
Jenseitsvorstellungen beschäftigen ihn naturgemäß stärker als den Gesunden. Wobei sich nicht nur der gläubige Christ diesen Fragen gegenüber sieht, sondern auch der Glaubenslose, der Marxist, der Atheist. Auch bei ihnen, auch bei Menschen, die an ein Leben nach dem Tod glauben, kann man eine heitere, den Tod gefaßt akzeptierende Haltung finden. Sie ist also keineswegs an ein bestimmtes Glaubensbekenntnis gebunden.
„Ein wesentlicher Bestandteil des Optimismus, den Marxisten gegenüber dem Leben - und damit auch dem Tod - empfinden, ist der Glaube, daß nichts von dem, was richtig gedacht wurde, verlorengehen kann, daß es vielmehr von anderen übernommen wird“, meint Professor Walter Hollitscher, bewandert in der Marxismus-Leninismus-Theorie.
Neben dem Glauben ist es auch das Gefühl, noch immer eine Aufgabe zu erfüllen, noch immer irgendwo gebraucht zu werden, das dem Schwerkranken sein Leben erleichtern kann. Das zeigt sich am Beispiel der über 40jährigen Ursula Rapf, die seit ihrer Kindheit an einer relativ seltenen Krankheit leidet, die sich Multiple Hämangiomie (Blutschwamm) nennt Sie äußert sich in schwammigen Wucherungen der Venenwände und ist nicht nur sehr schmerzhaft, sondern vor allem lebensgefährlich. Dann nämlich, wenn sich ein Gerinsel löst und mit dem venösen Blut durch den Körper in die Lunge gelangt, wobei es regelmäßig zu sogenannten Lungeninfarkten kommt.
Frau Rapf hat bereits 113 Lungeninfarkte hinter sich, wobei sie jedesmal zwischen Leben und Tod schwebt, der mit Gewißheit dann eintritt, wenn das Gerinsel entweder eine Herzklappe verletzt oder eine Hauptader der Lunge verstopft. Obwohl Sie sich dessen durchaus bewußt ist, hat sie sich ihr Leben auf Dauer eingerichtet: Sie ist verheiratet, hat zwei-jetzt schon erwachsene - Kinder und leitet die internationale Bewegung „Fraternität der Kranken und Behinderten“.
Es sind diese - in Anbetracht ihrer schweren Krankheit - erstaunlichen Leistungen, die ihr Lebensmut und auch Freude am Leben geben, Weil der Tod ständig unmittelbar präsent, das Leben daher als etwas sehr Flüchtiges, jederzeit Abrufbares erscheint, gewinnt es zugleich an Bedeutung. „Dadurch“, sagt Ursula Rapf, „daß ich immer von heut' auf morgen leb', spüre ich, daß das Leben etwas Kostbares ist. Wissen Sie, man lebt so ganz anders. Man sieht viel mehr das Gute, läßt sich vom Negativen nicht so sehr unterkriegen, steht ein bißchen mehr darüber,“
Solch eine positive Einstellung findet man allerdings selten und auch nur dort, wo die erste Phase der Auflehnung überwunden ist und jene des ruhigen Uberlegens und damit Ver-traut-werdens mit der Krankheit folgt. Das muß nicht unbedingt Resignation bedeuten, vielmehr kommt es in diesem Stadium häufig zu einem
„Angehörige sollten nach Möglichkeit versuchen, dem Schwerkranken dieses Gefühl zu nehmen und ihn bis zuletzt in ihre Gemeinschaft zu integrieren“ neuen Überdenken des eigenen Zustandes, einem Zusammenfassen aller verbliebenen Kräfte, manchmal sogar einem neuen Beginn unter veränderten Umständen.
So wie etwa bei dem 54jährigen Eduard Hauser, der - ebenfalls nach einem schweren Herzinfarkt - frühzeitig in Pension gehen mußte und jetzt, auf den Aufenthalt innerhalb seiner vier Wände beschränkt, eine hauptsächlich vom Telefon aus geführte rege karitative Tätigkeit entfaltet.