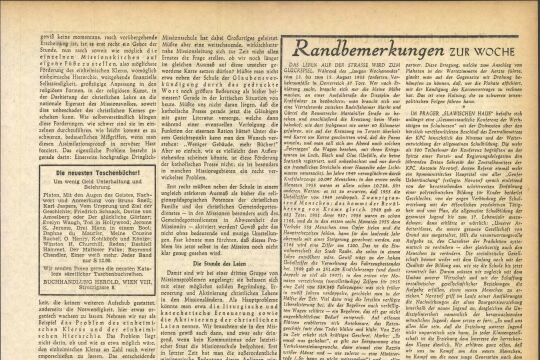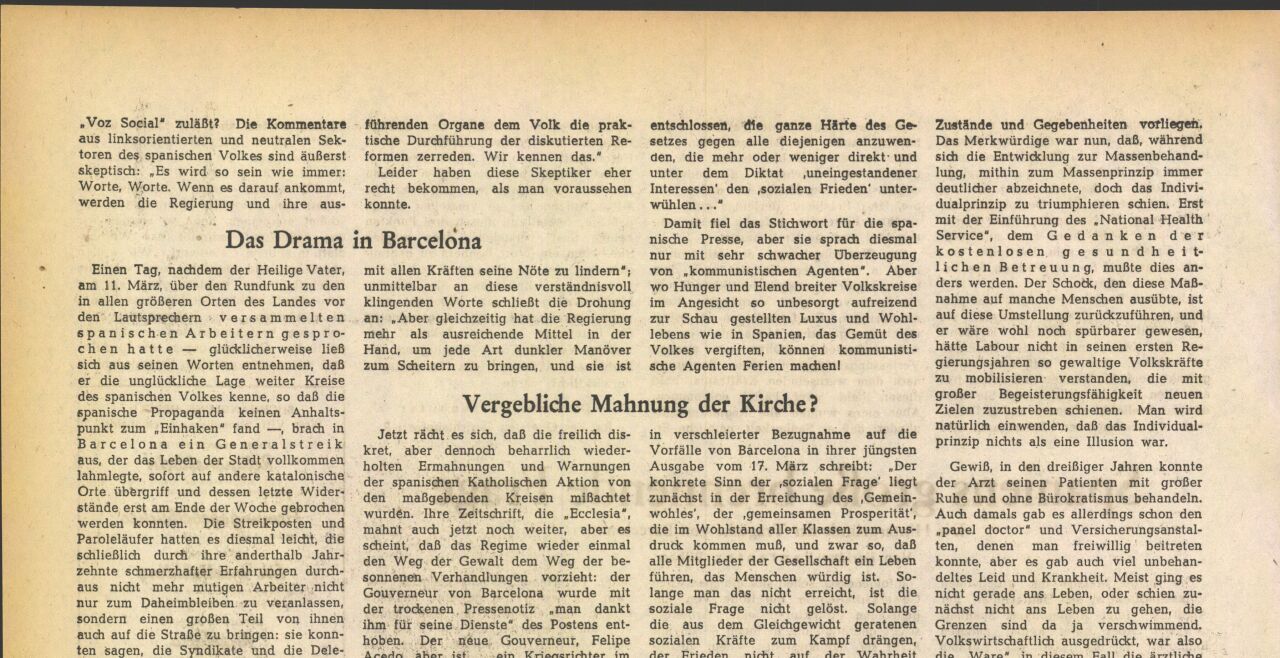
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Arzte am Fliebband
„Sie dürfen unseren Gesundheitsdienst nicht nach dem gegenwärtigen Stand beurteilen“, sagt mir der Chirurg mit dem erstaunlich jungen Gesicht im Queens Hospital von Birmingham. „Man scheint manchmal zu vergessen, daß die Einrichtung erst Juli 1948 ins Leben trat... in zehn oder fünfzehn Jahren, wenn Englands neue Städte vollendet sein werden“ — und er weist in die regenverhangene Ferne, wo sich neue Siedlungen um den Komplex der Austin-Werke ballen —, ;wird ein Netz modernster Kliniken und Spitäler das Land umspannen.“
Aus den grauen, alle Konturen verwischenden Farben des englischen Vorfrühlings scheinen mir die Züge anderer Menschen aufzutauchen. Das zerfurchte, müde Gesicht des Walliser Landarztes, auf dessen „panel“ zu wenig Namen stehen, so daß es ein immer größeres Problem wird, das Auskommen zu finden, die junge „district nurse“, die meint, daß jede Kritik am National Health Service“ nur Bösartigkeit entspringen könnte. „Sehen sie sich doch unsere Kinder an... trotz Krieg und Nachkriegssorgen das gesündeste Geschlecht, das je auf diesen Inseln herangewachsen ist!“, der Harley-Street-Spezialist, der skeptisch bemerkt: „Arzt qder Beamter... glauben Sie mir, man kann nicht beides sein“, die alte Dame, die sich zum erstenmal nach einer Operation den Luxus eines Einzelzimmers wird versagen müssen: „Es ist schwer, sich daran zu gewöhnen ... aber vielleicht ist unsere Erziehung falsch gewesen“, der schottische Zahnarzt schließlich, der mit „chair hours“, Sesselstunden also, und anderen Begriffen operiert, die unangenehm an den Jargon der industriellen Manager erinnern.
Menschen, Ängste ... Widersprüche ... kann man wirklich nach knapp drei Jahren schon urteilen? Zeichnen sich zumindest im Guten wie im Bösen gewisse Tendenzen ab?
Man wird dem Fragenkomplex kaum gerecht werden können, ohne sich mit der grundsätzlichen Problematik jedes Gesundheitsdienstes auseinanderzusetzen. Soll die Fürsorge vor allem dem Individuum oder vor allem der Masse gelten? Soll der Pestkranke eine maximale Chance haben, zu überleben, oder die Gesellschaft eine minimale, sich zu infizieren? Gewiß, die Gegnerschaft der beiden Prinzipien tritt selten so unverhüllt zutage, ja sie wirken meist in derselben Richtung. Doch immer wieder bricht der Antagonismus durch, stets von neuem kommen Augenblicke von Wahl und Entscheidung. Im großen und ganzen aber drängt die Entwicklung der Medizin, inneren Gesetzen folgend, dem Massenprinzip zu. Die britische Ärztegesellschaft hat gerade jetzt eine Zeitschrift herausgegeben, die sich „Family doctor“ betitelt. Damit wird, nicht ohne Absicht, im Zeitalter des medizinischen Fließbandes mit seinen Testen, Laboratorien, Grundumsätzen und EKG.s der Schatten des antiken Arztes beschworen, der — was immer seine wissenschaftlichen Unzulänglichkeiten gewesen sein mögen — noch den Menschen in seiner natürlichen Umgebung kannte und erforschte, und nicht nur die Krankheit, sondern auch die familiären Verhältnisse und den Charakter ins Kalkül ziehen konnte. Dabei brachte die Auflösung der medizinischen Tätigkeit in immer weiter spezialisierte Arbeitsvorgänge erstaunliche Erfolge mit sich. Eine der in England in diesem Zusammenhang häufig genannten Ziffern ist die der Säuglings- und Müttersterblichkeit. Noch im Jahre 1900 starben in Großbritannien von 1000 Kinder 150, gegenwärtig sind es nur mehr 32, während selbst 1934 von 1000 Mütter noch 4 im Kindbett starben, ist die Ziffer gegenwärtig auf 0.9 reduziert worden. Die Beispiele ließen sich unschwer vermehren, wobei man jedoch finden würde, daß die größten Fortschritte dort gemacht wurden, wo typische, sich stets wiederholende Zustände und Gegebenheiten vorliegen. Das Merkwürdige war nun, daß, während sich die Entwicklung zur Massenbehandlung, mithin zum Massenprinzip immer deutlicher abzeichnete, doch das Indivi-dualprinzip zu triumphieren schien. Erst mit der Einführung des „National Health Service“, dem Gedanken der kostenlosen gesundheitlichen Betreuung, mußte dies anders werden. Der Schock, den diese Maßnahme auf manche Menschen ausübte, ist auf diese Umstellung zurückzuführen, und er wäre wohl noch spürbarer gewesen, hätte Labour nicht in seinen ersten Regierungsjahren so gewaltige Volkskräfte zu mobilisieren verstanden, die mit großer Begeisterungsfähigkeit neuen Zielen zuzustreben schienen. Man wird natürlich einwenden, daß das Individual-prinzip nichts als eine Illusion war.
Gewiß, in den dreißiger Jahren konnte der Arzt seinen Patienten mit großer Ruhe und ohne Bürokratismus behandeln. Auch damals gab es allerdings schon den „panel doctor“ und Versicherungsanstalten, denen man freiwillig beitreten konnte, aber es gab auch viel unbehandeltes Leid und Krankheit. Meist ging es nicht gerade ans Leben, oder schien zunächst nicht ans Leben zu gehen, die Grenzen sind da ja verschwimmend. Volkswirtschaftlich ausgedrückt, war also die „Ware“, in diesem Fall die ärztliche Hilfe, nur scheinbar ausreichend vorhanden, in Wirklichkeit konnte sie wegen der sozialen Verhältnisse, oft auch wegen individueller Gleichgültigkeit, keinesfalls in ausreichendem Maß in Anspruch genommen werden. Eine Illusion also, zugegeben. Aber hat man sie nicht alsbald durch eine neue ersetzt? Hat man nicht nun den Versuch gemacht, die „Ware“, die Dienstleistung zu vergrößern, indem man die Anweisung auf die Ware immer mehr ausweitete? Dabei treffen die üblichen Vorwürfe nicht den Kern der Dinge. Das zunächst entstandene Defizit von mehreren Millionen Pfund zeigt ja vor allem den Unterkonsum der früheren Zeit auf, es waren eben früher wirklich zu wenig Menschen beim Zahnarzt und Optiker gewesen, die Gleichgültigkeit, mit der man das kostenlos Erworbene behandelt, mag das Passivum vergrößert haben, es hat es nicht hervorgerufen.' Nein, die bedenkliche Seite des Experiments — und es ist interessanter, sich mit ihr zu befassen, als seine Vorzüge zu preisen — liegt in dem Versuch, den ärztlichen Apparat plötzlich auf einen Massenbedarf umzustellen, gleichzeitig und ohne Vorbereitung alle alten Regulative abzuschaffen (Regulative an sich unerfreulicher Natur, Geldknappheit des Patienten, die finanzielle Belastung, die eine Spitalsüberweisung mit sich bringt, oder die Furcht, einen Patienten zu verlieren) sowie auf die Verknüpfung alter und neuer Methoden der Finanzierung aus dogmatischen Gründen zu verzichten. In manchen Dingen ist man nun wieder einen Schritt in die Vergangenheit gegangen: Medikamente werden nicht mehr ganz umsonst verabreicht, man darf seine Brille nicht mehr so oft zerbrechen, wie man will, und anderes mehr.
Im übrigen aber stößt man häufig auf die zweite Phase sozialistischer Maßnahmen: In der ersten zahlen nämlich die Wohlhabenden für die größere Bequemlichkeit der Armen — und dem pflichtet man gerne bei —, in der zweiten Phase aber zahlen die Armen für die Un bequemlichkeit der Wohlhabenden —, was man nicht umhin kann, bedenklich zu finden. Es ist nicht schwer, dies durch Beispiele zu illustrieren. Verwaltungsstellen, die in vielen Spitälern bis 1948 ehrenamtlich ausgeübt wurden, mußten in bezahlte Posten verwandelt werden. Wer sich einer Operation unterzieht und nachher gern für ein Einzelzimmer zahlen würde, kann dies nicht tun, da er in diesem Fall auch für die gesamten Operationskosten aufkommen müßte. Da er für das Zimmer, das noch vor zwei Jahren 8 Pfund die Woche kostete, nun 16 bezahlen müßte, können sich nur mehr ganz wenige das leisten. Der Einwand, daß in den Einzelzimmern eben die schwersten Fälle liegen, überzeugt nicht in allen Fällen. Nach Angaben, die Bevan, als er noch Gesundheitsminister war, gemacht hat, muß die Bettenanzahl aus rein budgetmäßigen Gründen niedriger gehalten werden, als es an sich wünschenswert wäre. Mit anderen V/orten: durch die bezahlten Einzelzimmer könnte die Gesamtzahl der Betten vergrößert werden, so daß die Wohlhabenden und die Schwerkranken untergebracht werden könnten. In diesen Dingen spürt man, wie in der Ablehnung ehrenamtlicher Mitarbeit manchmal so etwas wie soziale Ranküne, die auch der große Idealismus, der an sich den „National Health Service“ trägt, nicht ganz verbergen kann. Man ist hier natürlich bei dem Punkt angelangt, wo erörtert werden muß, ob ein Gesundheitsdienst nicht früher oder später ein Moment der Auswahl anerkennen muß. Vor kurzem hat sich Attlee in ärztliche Betreuung begeben, um damit dem Beispiel Bevins und Sir Staffords zu folgen. Niemand wird vernünftigerweise erwarten, daß er stundenlang warten muß oder in einem Raum mit dreißig anderen Patienten zu schlafen hat. Attlees Wichtigkeit für die Nation läßt diesen Gedanken völlig absurd erscheinen. Richtig. Kann man aber annehmen, daß diese Ausnahme nur den Premier betrifft? Daß sich nicht im Laufe der Zeit immer weitere Verästelungen bilden werden? Nach welchen Grundsätzen soll also die Priorität organisiert werden? Ein naheliegender Weg wäre der, sich dem Arzt oder Spitals-d;rektor privat erkenntlich zu zeigen. Brutal: der Weg der Bestechung. Er ist in England völlig unbekannt. Aber in England haben die Ärzte ein relativ hohes Einkommen, die unzähligen Transaktionen, die nicht in den Büchern stehen, sind hier sehr viel weniger verbreitet als am Kontinent, das Gemeinschafts- und Verantwortungsgefühl ist relativ noch immer stark. Es wäre indes äußerst gefährlich, englische Einrichtungen nachzuahmen, ohne englische Voraussetzungen geschaffen zu haben.
Im übrigen zeigt es sich in England, daß andere Versuchungen des Gesundheitsdienstes bereits die Oberfläche gewisser englischer Ehrenkodexe aufzuweichen beginnen. Recht weite Kreise haben sich daran gewöhnt, gewisse Möglichkeiten (kostenloser oder verbilligter Bezug gewisser Nahrungsmittel) ziemlich unbedenklich in Anspruch zu nehmen. Was zur Nachdenklichkeit Veranlassung gibt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!