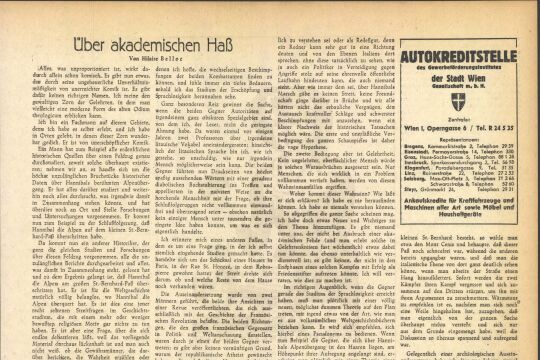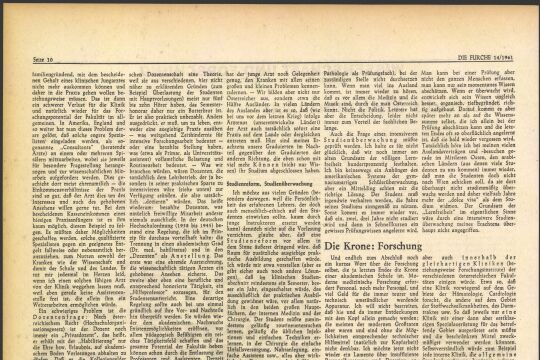Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Raum für Forschung
Das Problem geht eigentlich noch weiter. Es handelt sich nicht nur (wie bisher diskutiert) darum, daß der Klinik höchstqualifizierte Spezialisten fehlen bzw. sie im Höhepunkt ihrer Entwicklung verlassen (und damit der Forschung überhaupt verlorengehen), sondern noch um mehr: die schon kurz skizzierte immer weiterschreitende Subspezialisierung und Technifizierung der klinischen Großgebiete haben es als selbstverständlich mit sich gebracht, daß sich auch die älteren Ausbildungsärzte in den letzten Jahren ihrer etwa sechs bis sieben Jahre dauernden Fachärzteausbildung zunehmend mit Spezialfragen und Spezialtechniken, mit subtilen Methoden beschäftigen, die eben die
Leistungshöhe einer modernen Klinik weitgehend bedingen. So hatte icn zum Beispiel an meiner Klinik einen Arzt, der sich besonders auf dem Gebiete der Phonokardiographie ausgebildet hatte (eine moderne, diagnostisch sehr wichtige Methode der Herztonschreibung), einen anderen, der ein ausgesprochener Spezialist auf Fragen des Eisenstoffwechsels war, einen dritten, der sich mit Fermentmethoden besonders beschäftigt hatte usw. Auch hier ist es so, daß diese Ärzte gerade in bester Entwicklung die Klinik verlassen — einerseits, weil sie ja wegen des drängenden Nachwuchses nicht über ihre Fachausbildung hinaus verbleiben können, anderseits, weil sie selbst, langsam älter werdend und familiengründend, mit dem bescheidenen Gehalt eines klinischen Jungarztes nicht mehr auskommen können und daher in die Praxis gehen wollen beziehungsweise müssen. Das ist dann ein schwerer Verlust für die Klinik und natürlich wieder für das Forschungspotential der Fakultät im allgemeinen. In Amerika, England und so weiter hat man dieses Problem derart gelöst, daß solche engere Spezialisten eingeladen werden, als sogenannte „Consultants“ (beratende Ärzte) an einem oder mehreren Spitälern mitzuarbeiten, wobei sie jeweils für besondere Fragestellung herangezogen und zur wissenschaftlichen Mitarbeit aufgefordert werden. Dies geschieht dort meist ehrenamtlich — die Einkommensverhältnisse der Praxis sind so gut, daß der Arzt dies um des Interesses und auch des gehobenen Ansehens willen gerne tut. Bei dem bescheidenen Kasseneinkommen eines hiesigen Praxisanfängers ist es ihm kaum möglich, diesem Beispiel zu folgen. Es müßten daher Möglichkeiten geschaffen werden, solche qualifizierte Spezialisten gegen ein geeignetes Entgelt fallweise oder nebenamtlich heranzuziehen, zum Nutzen sowohl der Kranken wie der Wissenschaft und damit der Schule und des Landes. Es tut mir jedesmal im Herzen leid, wenn ich einen solchen fähigen Arzt von der Klinik Weggehen lassen muß, weil eben gerade keine Assistentenstelle frei ist, die allein ihm ein Weiterarbeiten ermöglichen würde.
Ein schwieriges Problem ist die Dozentenfrage : Nach öster reichischem Recht (Hochschulorganisationsgesetz) ist der Dozent noch immer ein „Privatdozent“, das heißt, er erhält mit der „Habilitierung“ nur die Ehre bzw. Erlaubnis, auf akademischem Boden Vorlesungen abhalten zu dürfen. Daß er die Kollegiengelder für diese Vorlesungen bekommt, ist für mehr als 90 Prozent der klini schen Dozentenschaft eine Theorie, weil sie aus verschiedenen, hier nicht näher zu erklärenden Gründen (zum Beispiel Überlastung der Studenten mit Hauptvorlesungen) meist nur fünf bis zehn Hörer haben, das Semesterhonorar daher nur ein Butterbrot ist. Er ist also praktisch unbezahlt. Anders ausgedrückt, er muß, um zu leben, entweder eine ausgiebige Praxis ausüben
— was weitgehend Zeithindernis für intensive Forschungsarbeit bedeutet — oder eine bezahlte Stellung haben, was (etwa als Primär, als Universitätsassistent) vollamtliche Belastung und Routinearbeit bedeutet. — Was wir brauchen würden, wären Dozenten, die tatsächlich dem Lehrbetrieb, der ja besonders in seiner praktischen Sparte zu intensivieren wäre (siehe unten) zur Verfügung stünden, die also tatsächlich „dozieren“ würden. Das heißt wiederum: bezahlte Dozenten, was natürlich freiwillige Mitarbeit anderer niemals ausschließt. In der deutschen Hochschulordnung (1938 bis 1945) bestand eine Regelung, die ich im Prinzip für durchaus vorteilhaft halte: die Trennung in einen akademischen Grad (Dr. med. habilitatus) und in den „Dozenten“ als Anstellung. Das erste war eine ehrende Auszeichnung, die wissenschaftlich tätigen Ärzten ein gehobenes Ansehen sicherte. Das zweite aber eben eine berufliche und entsprechend honorierte Tätigkeit, ein „Hilfsprofessor“ sozusagen, für den Studentenunterricht. Eine derartige Regelung sollte auch bei uns einmal gründlich auf ihre Vor- und Nachteile hin überprüft werden. Sie würden wieder dem akademischen Nachwuchs Existenzmöglichkeiten eröffnen, vor allem pädagogisch Befähigten ein reiches Tätigkeitsfeld schaffen und das gesamte Potential der Fakultät heben können schon durch die Entlastung der Professoren und Assistenten. Derzeit spielen die Dozenten für den Unterricht praktisch keine Rolle.
hat der junge Arzt noch Gelegenheit genug, den Kranken mit allen seinen großen und kleinen Problemen kennenzulernen. — Wir bilden aber nicht nur Österreicher aus, sondern etwa die Hälfte Ausländer. In vielen Ländern des Auslandes aber ist es so, daß (wie bei uns vor dem letzten Krieg) infolge Ärztenot (unterentwickelte Länder!) der Arzt auch tatsächlich sofort eine Praxis auf dem Lande oder dergleichen antreten muß. Hier sind meines Erachtens unsere Graduierten im Nachteil gegenüber den Graduierten der anderen Richtung, die eben schon mit viel mehr Können (nicht nur Wissen) ihr Studium abgeschlossen haben.
Studienreform, Studienüberwachung
Ich möchte aus vielen Gründen (besonders deswegen, weil die Persönlichkeit des erfahrenen Lehrers, der doch auch menschlich-ethisch auf den Studenten einwirken sollte, kaum durch junge Instruktoren ersetzt werden kann) dennöch nicht auf die Vorlesung verzichten, glaube aber, daß eine Studienreform vor allem in dem Sinne äußerst dringend wäre, daß Raum für zusätzliche ausgiebige praktische Ausbildung geschaffen würde. Ich würde mir etwa vorstellen (aber es gibt sicher auch noch andere Lösungen), daß im klinischen Studienabschnitt mindestens ein Semester, besser ein Jahr, eingeschaltet würde, das ausschließlich der praktischen Ausbildung gewidmet wäre, vor allem natürlich in den beiden großen Hauptfächern, der internen Medizin und der Chirurgie. Der Student müßte zumin- destens geläufig routineuntersuchen lernen, geläufig die üblichen Injektionen und einfachen Techniken erlernen, in der Chirurgie die einfache Unfallsversorgung, Nahtanlegung, einfache Assistenz usw., alles aber wirklich im Sinne von praktisch-Können und nicht nur von theoretisch-Wissen. Dem Österreicher könnte dieses Jahr dann für die spätere obligatorische Ausbildung angerechnet werden, wodurch ihm kein effektiver Zeitverlust trotz Studienverlängerung erwachsen würde. Der Ausländer muß die Verlängerung eben in Kauf nehmen, und er wird es gerne tun, da sich das Ansehen unser BotlWraf i6ttt?precfieri'ä’!:fiebeil würdetf—~ iš" 'sei bM dfe XJfefeSälh® bemerkt, daif sich 3ie Fakultät seit vielen Jahren um eine Studienreform bemüht, daß wir aber noch immer mit einer längst veralteten Studienordnung und Prüfungsordnung arbeiten müssen, da es scheinbar unmöglich ist, eine Novellierung der einschlägigen Bestimmungen durchzusetzen. Es ist mehr als bitter, wenn eine akademische Schule notwendigste Reformen, längst als solche erkannt (zum Beispiel Biologie, experimentelle
Pathologie als Prüfungsfach), bei der zuständigen Stelle nicht durchsetzen kann. Wenn man viel ins Ausland kommt, ist immer wieder zu hören, daß es vor allem die Medizin und die Musik sind, durch die man Österreich kennt. Nicht die Politik. Letztere hat aber die Entscheidung, leider nicht immer zum Vorteil der fachlichen Belange.
Auch die Frage einer intensiveren Studienüberwachung müßte geprüft werden. Ich halte es tür nicht glücklich, daß wir noch immer am alten Grundsatz der völligen Lern- freiheit hundertprozentig festhalten. Ich bin keineswegs ein Anhänger des amerikanischen Systems der gymnasiumartigen Schülerüberwachung, aber ein Mittelding schien mir die richtige Lösung. Der Student muß irgendwie verhalten werden, die Jahre seines Studiums sinngemäß zu nützen. Sonst kommt es immer wieder vor, daß ein, zwei, drei Jahre nicht studiert wird und dann in Schnellkursen ein gewisses Prüfungswissen angelernt wird.
Man kann bei einer Prüfung aber nicht den ganzen Menschen erfassen, man kann nur sein momentanes Wissen abschätzen. Wenn er überwacht wird, entwickelt sich sein Wissen ungleich besser, organisch, tiefbegründet', richtig auf gebaut. Darauf kommt es aber später mehr an als auf die Wissenssumme selbst, die ich allein bei der Prüfung abschätzen kann und die letzten Endes oft so oberflächlich angelernt ist, daß sie bald wieder vergessen wird. Tatsächlich höre ich bei meinen vielen Auslandsvorträgen und -besuchen gerade im Mittleren Osten, den arabischen Ländern (aus denen viele Studenten zu uns kommen) immer wieder, daß man die Studenten doch nicht nach Wien schicken soll, da sie dort überhaupt nicht studienmäßig überwacht werden und daher vielfach Jahre mehr der „dolce vita“ als dem Studium widmen. Der Grundsatz der „Lernfreiheit“ im eigentlichen Sinne wäre durch eine intensivere Studienüberwachung meines Erachtens überhaupt nicht angegriffen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!