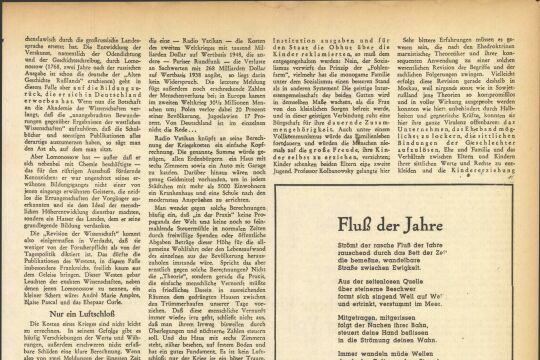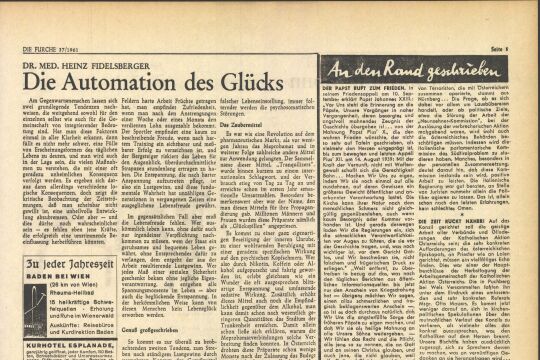Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war die Familie der Baustein des Staates. Innerhalb der Familie lief der größte Teil des Lebens ab, innerhalb des Familienverbandes fand man die Sicherheit im Lebenskampf. Die verwaisten Kinder wurden bei Verwandten aufgezogen, kranke Familienmitglieder wurden betreut, und die beruflichen oder finanziellen Verluste wurden durch Familienmitglieder ausgeglichen. Je größer die Familie, um so größer auch die Sicherheit, und dieses gesunde Lebensgefühl fand seinen Niederschlag in einem entsprechenden Kinderreichtum.
Der Ausbau der Sozialversicherung schuf hier einen völligen Wandel in der Lebensanschauung. Man ist krankenversichert und zahlt in eine Fentenkasse, man ist gegen Unfall und Arbeitslosigkeit versichert und bedarf daher des Familienverbandes nicht mehr. Wozu heiraten und Kinder großziehen? So fragen sich heute viele junge Menschen. Man kann unbedenklich dem Augenblick leben, man kann sich weite Auslandsreisen gönnen und eine Wohnung hypermodern einrichten. Man schafft sich frühzeitig “efn Auto anTkleidet sich TiäcH ‘der ‘lefifön’ Mode” Alle technischen Errungenschaften fördert man für sich allein und hat nicht das geringste Verlangen, Kinder ins Leben zu setzen und so dem einen oder anderen Vergnügen entsagen zu müssen. Man ist ja sozialversichert, und die Familie ist daher nicht mehr notwendig. Die Statistik bestätigt diese Tatsache: ln den Ländern, wo die Sozialversicherung komplett oder überkomplett ist, nimmt die Geburtenziffer ständig ab. Man genießt das Leben und überläßt alle Sorgen dem Staat. Was also früher Aufgabe der Familie war, wird heute I auf die Allgemeinheit abgewälzt, die Lösung 1 aller Lebensfragen soll vom Staat aus besorgt werden. Man fordert ein bequemes und „schönes” Leben!
Uebernahmen es früher die Familienangehörigen, ein krankes Familienniitglied zu betreuen und zu pflegen, so hat die Sozialversicherung zu einer völligen Aenderung in den Anschauungen geführt. Alte Mensche.n sind in den Familien nur so lange willkommen, solange sie eine Rente beziehen und keine wie immer gearteten Ansprüche stellen. Wird aber ein alter Mensch krank oder muß er gepflegt werden, so weigert man sich mit größter Selbstverständlichkeit, auch nur einen Handgriff zu tun, und verlangt die Uebernahme des Patienten von der Allgemeinheit. So kommt es, daß gut drei Viertel aller Spitalseinweisungen aus dem alleinigen Grund vorgenommen werden; weil niemand bereit ist, den Kranken zu pflegen. Es mögen die modernen Haushaltsmaschinen die effektive Arbeit der Hausfrauen noch so sehr erleichtern, es möge die Arbeitszeit noch weiter verkürzt werdendes kann in den einen oder anderen Familien der Lebensstandard noch so hoch sein, für die Pflege von Kranken hat man nichts übrig. Vom Bagatellfall bis zur unheilbaren Krankheit wird heute alles ins Spital eingewiesen unter dem Hinweis: Lebensgefahr — qhne Pflege.
Die moderne Sozialversicherung aber hat auch die Anschauung dem Arzt gegenüber vollkommen gewandelt. Man erwartet von ihm mit absoluter Selbstverständlichkeit, daß er alle Unbequemlichkeiten, die sich aus einer Krankheit ergeben, aus der Welt schafft. Mit der Tatsache, daß man Sozialversicherung bezahlt, glaubt man, den Arzt hinreichend honoriert zu haben, und es erübrigt sich daher auch, für die ärztlichen Leistungen zu danken. Man ruft den Arzt zu jeder Tages- und Nachtzeit, und wenn ein chronisches Leiden, ein degeneratives Leiden, wie es im Alter aufzutreten pflegt, nicht zum Verschwinden gebracht werden kann, wird er sogar mit Vorwürfen überhäuft. Bei den Gebietskrankenkassen wird der Arzt pauschaliert bezahlt, er bekommt für die Betreuung eines Patienten für ein ganzes Vierteljahr weniger als beispielsweise ein Schornsteinfeger für die einmalige Inspektion eines Kamins. Es ist verständlich, daß kein Arzt für einen solchen Betrag Tag für Tag einen Patienten besuchen kann und daher eine Spitalseinweisung verfügt.
Der gesamte technische Fortschritt dient bekanntlich der Arbeitserleichterung, der Arbeitszeitverkürzung, der menschlichen Bequemlichkeit. Für viele Berufsarten brachten die letzten Jahre eine totale Aenderung der Arbeitsweise, viele Berufe werden eine solche schon in der nächsten Zeit erleben können. In den Heil- berufen aber wird eine Mechanisierung nur bis zu einem gewissen Ausmaß herbeizuführen sein. Es würde zu weit führen, wollte man alle Gründe anführen, derentwegen der enge Kontakt zwischen Arzt und Patient, Pflegerin und Patient erhalten werden muß. Der Hauptgrund ist jedoch fraglos die Tatsache, daß ein großer Teil aller Leiden einen mehr oder minder seelischen Hintergrund hat, daß viele Krankheiten weitgehend neurotisch überlagert sind und eine rein mechanische Medizin, seelenlos und unpersönlich, natürlich wirkungslos bleiben muß.
Aber man hat indirekt auch in den Spitälern die Arbeitszeit verkürzt. Man hat die Frequenz der Kranken herabgesetzt und damit natürlich eine bedeutende Arbeitsersparnis erzielt. Denn Arbeit macht nur der neu aufgenommene Patient. Er muß gereinigt werden, der Arzt muß die Krankengeschichte schreiben, die immerhin längere Zeit in Anspruch nimmt, und wenn psychosomatische Gesichtspunkte berücksichtigt werden, kann sie viele Stunden währen — man muß Befunde erheben, eventuell eine Operation durchführen, die Verwaltung hat Schreibereien, und das Pflegepersonal muß sich an das neue Gesicht gewöhnen: Nach einer Woche aber sind spätestens alle Durch Untersuchungen vorbei, postoperativ ist das Aergste überstanden, und nun ist nicht mehr viel zu tun. Eventuell eine Injektion pro Tag, vielleicht auch zwei, Tabletten und etwas Körperpflege. Je länger der Patient bleibt, um so geringer die Arbeit. Nur der Wechsel von Patienten verursacht wirklich schwere Arbeit, ganz abgesehen davon, daß immer neue Wäsche notwendig ist, was wiederum Kosten verursacht.
So kommt man zu der immerhin bemerkenswerten Erkenntnis, daß es wohl schwer ist, ein Spitalsbett zu bekommen, daß es aber dann mit der Entlassung gar nicht so große Eile hat.
Statistisch ist erwiesen: Eine akute Blinddarmentzündung dauert bei einem freiberuflich tätigen Menschen etwa eine Woche, beim sozialversicherten Patienten aber mindestens zwei Wochen. Ganz abgesehen davon, daß nach der Spitalsentlassung selbstverständlich ein Erholungsurlaub beantragt wird (wehe dem praktischen Arzt, der nicht sofort das grüne Antragsformular ausfüllt!) und dieser dann, meist einen Monat später, wo auch die letzten Operationsfolgen längst geschwunden sind, fdr zwei oder drei Wochen auch, konsumiert wird. Fast immer wird auch noch restlicher Gebührenurlaub abgeschlossen, und wenn der Patient die Frist zwischen Spitalsentlassung und Antritt des Erholungsurlaubes in häuslichem Krankenstand verbleibt, ergibt sich der Arbeitszeitausfall bei einfacher Blinddarmoperation von mindestens sechs Wochen. Während der Unternehmer längstens zehn Tage nach der Operation wieder voll und ganz seiner Tätigkeit nachgeht.
Die Begehrlichkeit gegenüber den sozialen Leistungen nimmt immer mehr zu, gleichzeitig aber sinkt das Verständnis für die tatsächlichen Kosten. Man will heute nicht nur Medikamente, man will auch jederzeit einen Spitalsaufenthalt, selbst dann, wenn medizinische Gründe wirklich fehlen. Niemand macht sich Gedanken, was die modernen Medikamente wirklich kosten, wie hoch beispielsweise die effektiven Materialkosten einer Magenoperation sind, welcher Aufwand erforderlich ist, um bloß die Verpflegskosten sicherzustellen. Es hat sich längst eingebürgert, soziale Einrichtungen so zu konsumieren, als würden sie überhaupt nichts kosten, und es scheint heute selbstverständlich, ein Spital auch bei einer Erkältung aufzusuchen, nur weil man allein ist und niemand einkaufen gehen kann oder aber die Pflegeperson auf Urlaub fahren will und man sich im Spital in der Zwischenzeit ein Altersleiden auszukurieren beabsichtigt.
Bei ehrlicher Betrachtung stellt sich heraus, daß der überwiegende Teil aller derzeit im Spital befindlichen Personen reine Versorgungsfälle sind, die jene Abteilungen, die eigentlich ganz anderen Zwecken dienen sollen, ausfüllen und damit die öffentlichen Gelder verzehren. Müßte der Patient auch nur einen ganz geringen Betrag seiner Spitalskosten selbst tragen, so würde sich die ganze Situation grundlegend wandeln. Aber niemand will heute auch nur einen Groschen für seine Gesundheit, seine Pflege oder Versorgung ausgeben, eine jahrelange politische Beeinflussung hat die Vorstellung gezüchtet, es sei alles umsonst und alles letztlich Pflicht des Staates.
Die letzten Auswirkungen des sozialen Staates auf seine Bürger ist eben die asoziale Einstellung des einzelnen, auf diese folgenschwere Entwicklung wurde ja schon oft hingewiesen. Jeder will nur für sich und sein Wohlergehen sorgen, je mehr er aus dem allgemeinen Trog der Sozialversicherung an sich reißen kann, um so besser.
Daraus ergäbe sich die notwendige Konsequenz für die verantwortlichen Politiker und Machthaber. Statt den Menschen von heute mit Versprechungen zu ködern, seine Bequemlichkeit zu fördern, ihm jegliches Verantwortungsgefühl abzunehmen und die Sozialversicherung immer mehr zu einer sozialen Versorgung auszubauen, müßte man zu den normalen Grenzen der sozialen Sicherheit zurückkehren. In einem Land ohne Sozialversicherung bedeutet Krankheit und Siechtum wirtschaftlich eine Katastrophe, bedeutet den Untergang. Gegen die unverdienten Widerwärtigkeiten des Lebens aber schützt den modernen Menschen im sozialen Staat die Versicherung, die das Gespenst der Krankheit und der Leistungsunfähigkeit bannt. Wird aber die Sozialversicherung auf die Spitze getrieben, dann hört die Eigenverantwortlichkeit ganz auf, verkümmert der Gedanke an eine eigene Familie und die sich daraus ergebenden Pflichten. Dann fällt nicht nur der Kranke dem Staat zur Last, sondern auch der Pflegebedürftige. Die verhängnisvolle logische Formel lautet dann: Spitalsbedürftig ist, wer krank ist oder keine Pflege hat.
Wollen wir also den Planeten zu einem ungeheuren Hospital, einer einzigen Klinik ausbauen?, so fragt entsetzt der Kritiker unserer A.eit, Ortega y Gasset. Man müßte die absolute reale Notwendigkeit einer gesunden Sozialversicherung betonen und gleichzeitig aber alle sozialen Versorgungseinrichtungen wieder der Familie übertragen, das Verantwortungsgefühl wecken und weltanschaulich den Gedanken an die Familie wachrufen. Aber das wäre unpopulär; schlimmer noch, es wäre unbequem . . .