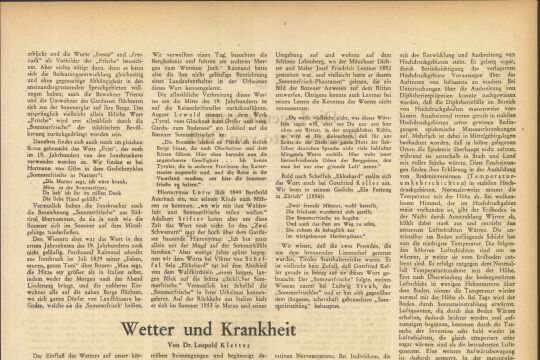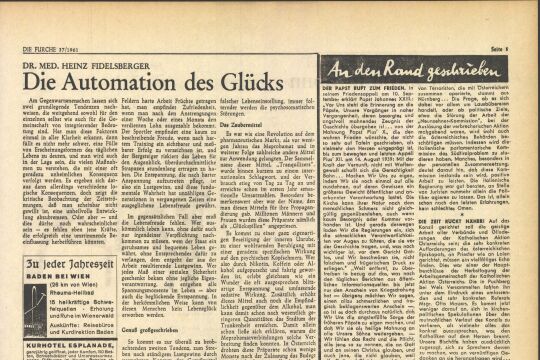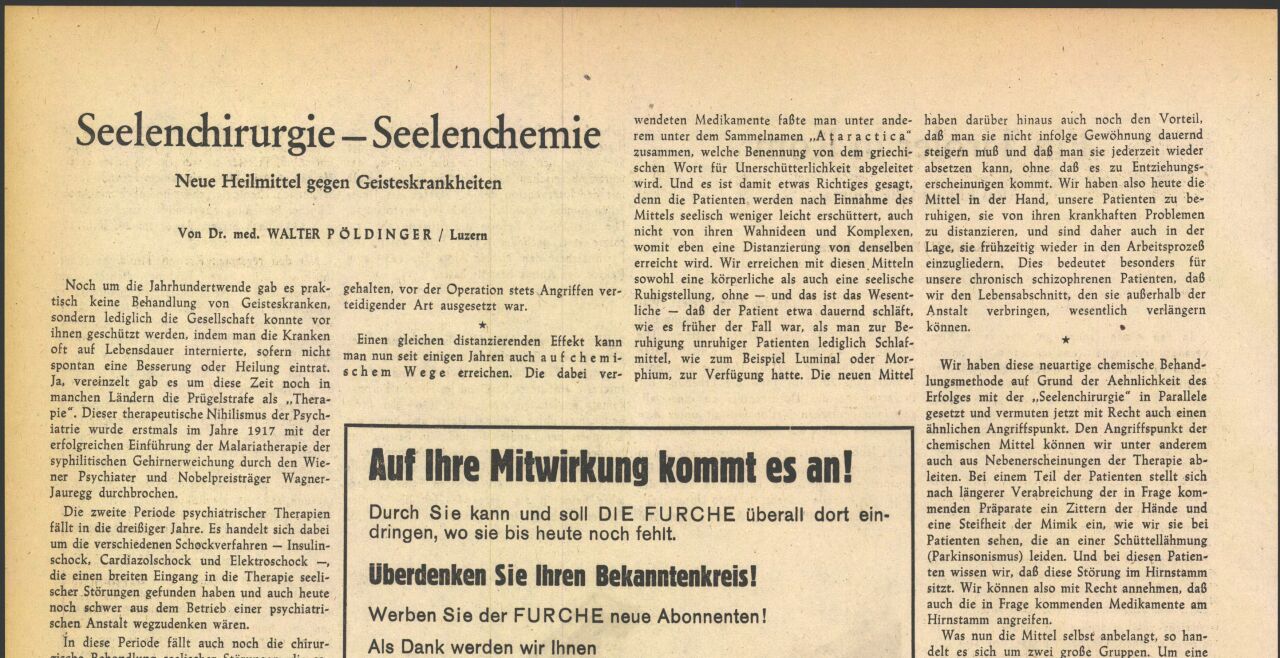
Noch um die Jahrhundertwende gab es prak- ; tisch keine Behandlung von Geisteskranken, sondern lediglich die Gesellschaft konnte vor ihnen geschützt werden, indem man die Kranken oft auf Lebensdauer internierte, sofern nicht spontan eine Besserung oder Heilung eintrat.
Ja, vereinzelt gab es um diese Zeit noch in manchen Ländern die Prügelstrafe als „Therapie”. Dieser therapeutische Nihilismus der Psychiatrie wurde erstmals im Jahre 1917 mit der erfolgreichen Einführung der Malariatherapie der syphilitischen Gehirnerweichung durch den Wiener Psychiater und Nobelpreisträger Wagner- Jauregg durchbrochen.
Die zweite Periode psychiatrischer Therapien fällt in die dreißiger Jahre. Es handelt sich dabei um die verschiedenen Scheckverfahren — Insulinschock, Cardiazolschock und Elektroschock —, die einen breiten Eingang in die Therapie seelischer Störungen gefunden haben und auch heute noch schwer aus dem Betrieb einer psychiatrischen Anstalt wegzudenken wären.
In diese Periode fällt auch noch die chirurgische Behandlung seelischer Störungen, die sogenannte „Seelenchirurgie”, die 1935 durch den portugiesischen Nobelpreisträger Edgar M o n i z begründet wurde.
Verfolgen wir zum Beispiel einmal einen Sinnesreiz, etwa eine Folge von Tönen, der auf uns einwirkt. Durch das Sinnesorgan in Nerven- impulse umgewandelt, gelangen diese über den Hirjjstamm — eine Ansammlung von Nerven- schaltzellen an der Basis des Gehirns — zur Großhirnrinde und so in unser Bewußtsein. Damit wir aber in unserem speziellen Fall die Folge von Tönen als Melodie empfinden, die uns in eine bestimmte Stimmung versetzt und ganz bestimmte Erinnerungen aufkommen läßt, ist es notwendig, daß der Hirnstamm — den man bildlich mit einer Telephonzelle vergleichen könnte — den Sinnesreiz nicht nur zu einem bestimmten Rindenfeld, in unserem Fall der Hörrinde, weiterleitet, sondern auch noch weitere, und zwar rückläufige Verbindungen mit Rindenfeldern äes übrigen Gehirns-hferstellh-jWir 9ehen”- also, daß für typisch menschliche Gefühle,’ wie zum Beispiel jene, die durch das Hören einer Melodie auftreten, über den Sinnesapparat hinaus eine Zusammenarbeit des ganzen Gehirns notwendig ist.
Es kann Vorkommen, daß ein Patient, der an einer fortgeschrittenen Krebsgeschwulst erkrankt ist und wegen dauernder und intensiver Schmerzen immer größere Mengen Morphium verabfolgt bekommen muß, plötzlich über keine Schmerzen mehr klagt. Nach dem Tode zeigt sich bei der Leichenöffnung, daß eine Tochtergeschwulst das Stirnhirn zerstört hat. Wie sind nun diese Feststellungen — das plötzliche Aufhören der Schmerzen und die Tochtergeschwulst im Stirnhirn — in Einklang zu bringen? Wie bei allen Sinnesreizen ist es auch beim Schmerz die Gesamtbeteiligung des Gehirns über die begrenzte Region der Körperfühlssphäre hinaus, die das Wesentliche -des Erlebens — in diesem Fall das „Leiden” — ausmacht. Fällt diese Gesamtbeteiligung durch Ausfall des Stirnhirns weg, so fällt auch das „Erleiden” des Sinnesreizes „Schmerz” weg. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an einen Patienten, bei dem wegen unbeeinflußbarer Schmerzen von seiten einer Krebsgeschwulst die Nervenbahnen des Stirnhirns durchschnitten werden mußten. Während er vor der Operation wimmernd im Bett gelegen ist und angebunden werden mußte, da er sonst sofort versuchte, seinen Schmerzen und seinem Leben ein Ende zu bereiten, indem er mit aller Wucht gegen die Wand sprang, traf ich ihn eine Woche nach der Operation beim Kartenspiel an. Auf die Frage, wie es ihm gehe, antwortete er: „Danke, ganz gut, nur starke Schmerzen habe ich halt.” Sie sehen an diesem Beispiel, wie dem Patienten durch diesen operativen Eingriff nicht das Ursächliche, der Schmerz, wohl aber das „Leiden” an demselben genommen wurde. Das gleiche erreicht man, wenn nun ein Patient nicht an einem körperlichen Schmerz, sondern etwa an Wahnideen — auf Grund derer er sich zum Beispiel in seinem Leben durch Verfolger bedroht fühlt — leidet. Durch eine operative Dur’chschneidung der Verbindungen zum Stirnhirn erreicht man auch bei einem Wahnkranken nicht ein Zusammenbrechen der Wahnideen, aber man erreicht, daß er sich von ihnen distanziert, unter ihnen nicht leidet und damit auch keine Gefahr mehr darstellt für seine Umwelt, die, für vermeintliche Verfolger gehalten, vor der Operation stets Angriffen verteidigender Art ausgesetzt war.
Einen gleichen distanzierenden Effekt kann man nun seit einigen Jahren auch auf chemischem Wege erreichen. Die dabei verwendeten Medikamente faßte man unter anderem unter dem Sammelnamen „A t a r a c t i c a” zusammen, welche Benennung von dem griechischen Wort für Unerschütterlichkeit abgeleitet wird. Und es ist damit etwas Richtiges gesagt, denn die Patienten werden nach Einnahme des Mittels seelisch weniger leicht erschüttert, auch nicht von ihren Wahnideen und Komplexen, womit eben eine Distanzierung von denselben erreicht wird. Wir erreichen mit diesen Mitteln sowohl eine körperliche als auch eine seelische Ruhigstellung, ohne — und das ist das Wesentliche — daß der Patient etwa dauernd schläft, wie es früher der Fall war, als man zur Beruhigung unruhiger Patienten lediglich Schlafmittel, wie zum Beispiel Luminal oder Morphium, zur Verfügung hatte. Die neuen Mittel haben darüber hinaus auch noch den Vorteil, daß man sie nicht infolge Gewöhnung dauernd steigern muß und daß man sie jederzeit wieder absetzen kann, ohne daß es zu Entziehungserscheinungen kommt. Wir haben also heute die Mittel in der Hand, unsere Patienten zu beruhigen, sie von ihren krankhaften Problemen zu distanzieren, und sind daher auch in der Lage, sie frühzeitig wieder in den Arbeitsprozeß einzugliedern. Dies bedeutet besonders für unsere chronisch schizophrenen Patienten, daß wir den Lebensabschnitt, den sie außerhalb der Anstalt verbringen, wesentlich verlängern können.
Wir haben diese neuartige chemische Behandlungsmethode auf Grund der Aehnlichkeit des Erfolges mit der „Seelenchirurgie” in Parallele gesetzt und vermuten jetzt mit Recht auch einen ähnlichen Angriffspunkt. Den Angriffspunkt der chemischen Mittel können wir unter anderem auch aus Nebenerscheinungen der Therapie ableiten. Bei einem Teil der Patienten stellt sich nach längerer Verabreichung der in Frage kommenden Präparate ein Zittern der Hände und eine Steifheit der Mimik ein, wie wir sie bei Patienten sehen, die an einer Schüttellähmung (Parkinsonismus) leiden. Und bei diesen Patienten wissen wir, daß diese Störung im Hirnstamm sitzt. Wir können also mit Recht annehmen, daß auch die in Frage kommenden Medikamente am Hirnstamm angreifen.
Was nun die Mittel selbst anbelangt, so handelt es sich um zwei große Gruppen. Um eine große Gruppe von synthetisch hergestellten Substanzen, die zunächst gegen allergische Krankheiten, wie zum Beispiel den Heuschnupfen, eingesetzt wurden und die man chemisch als Phenothiazine zusammenfaßt. Unter Namen wie „Largactil”, „Nozinan”, „Plegizil”, „Prazine” und „Trilafon”, wurden sie in den Handel gebracht.
Die zweite große Gruppe stammt von einer indischen Pflanze und wurde, ehe man die psychischen Wirkungen entdeckte, zur Behandlung des erhöhten Blutdruckes verwendet. Die Reinsubstanz dieser Pflanze wird als Reserpin oder Serpasil in den Handel gebracht. Da aber gerade bei dieser Gruppe starkes Zittern und eine Steifheit der Gesichtszüge häufig als Nebenerscheinung auftreten, versuchen wir derzeit mit gutem Erfolg ein Kombinationsmittel unter dem Namen „Phasein”, das diese störende Nebenwirkung kaum mehr auftreten läßt.
Während wir zur Bekämpfung von Erregungszuständen schon bisher, wenn auch unzulängliche Mittel, wie schwere Schlaf- und Betäubungsmittel, zur Verfügung hatten, so stan-, den wir den Depressionen, von seltenen Besserungen durch Opium abgesehen, in medikamentöser Hinsicht bisher hilflos gegenüber, so daß wir bei diesen Krankheitsbildern einzig und allein auf die Elektroschocktherapie angewiesen waren. Diese Lage hat sich im letzten Jahr überraschend gebessert, indem zunächst lediglich unter einer Versuchsnummer, später unter dem Namen „Tofranil” ein Medikament herauskam, das depressive Symptome sehr rasch zum Abklingen bringt, wenn auch nur für die Dauer der Wirkung des Medikamentes. Zur Illustration der Wirkung sei hier ein Auszug aus der Krankengeschichte des ersten Patienten wiedergegeben, der mit diesem Mittel behandelt wurde.
Zur Aufnahme lesen wir: „50jähriger Geschäftsmann, der laut schluchzend eingewiesen wird und angibt, er müsse sich das Leben nehmen, denn er stehe vor dem Ruin und habe seine Familie in Schande und Not gebracht. Die begleitende Frau gibt an, daß es mit dem Ge- schäft bestens gehe.”
Bereits zwei Tage nach Beginn einer Injektionskur mit Tofranil lesen wir: ,.Patient wird bei der Visite kartenspielend angetroffen und möchte bald entlassen werden, da er sonst einige günstige Geschäfte versäume.”
Zehn Tage später, unmittelbar nach versuchsweisen Absetzen des Medikamentes:
,Patient liegt im Bett und weigert sich, aufzustehen. Er müsse sterben als Strafe dafür, daß er seine Familie in Not und Elend gebracht habe. Man solle sich nicht um ihn kümmern, denn ihm sei nicht mehr zu helfen.”
Wir sehen also, daß es sich wohl um ein prompt und sehr gut wirkendes Mittel handelt, daß es aber darauf ankommt, daß es auch regelmäßig eingenommen wird. Schon ein kurzzeitiges Aussetzen kann schwerste Folgen haben. Wir können also einen Melancholiker unter diesem Mittel nur dann aus der Anstaltsbehandlung entlassen, wenn wir die Gewähr haben, daß ein Angehöriger, etwa die Frau oder die Mutter, unbedingt auf die Einnahme des Mittels drängt. Denn wir können heute einem Melancholiker wohl seinen Lebenswillen und seine Arbeitskraft wiedergeben, aber nur solange er sich strikte an. die vorgeschlagene Therapie hält.