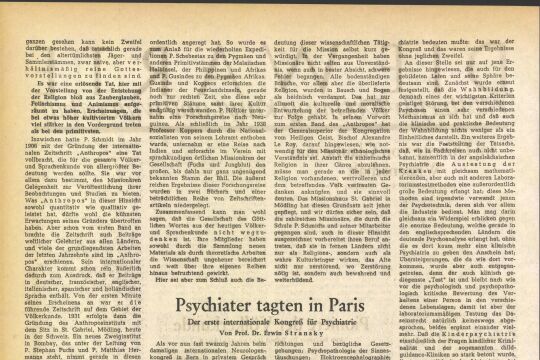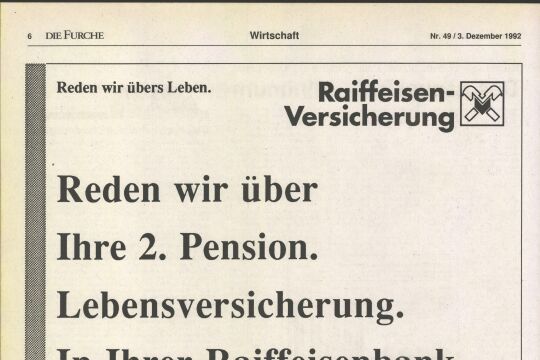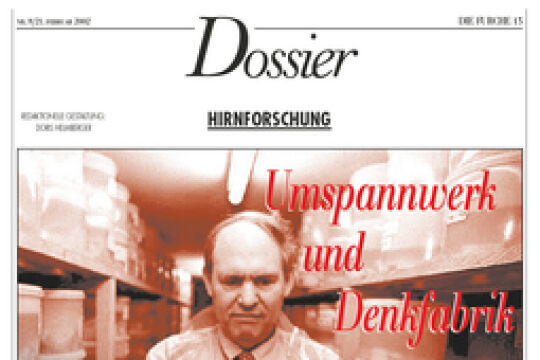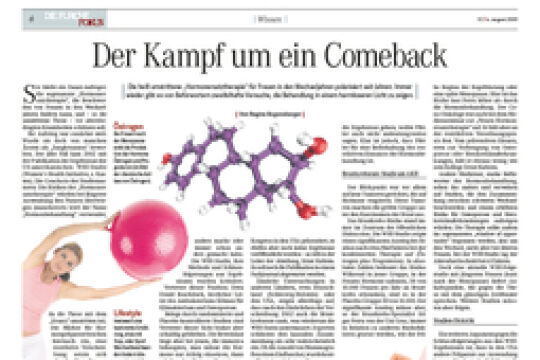Die Forschung in Wien lebt
Die Forschung der Wiener Medizin lebt, vielleicht aktiver denn je. Die Arbeit an den Universitätskliniken ist zumindest vielversprechend.
Die Forschung der Wiener Medizin lebt, vielleicht aktiver denn je. Die Arbeit an den Universitätskliniken ist zumindest vielversprechend.
Wien ist anders. Auch auf medizinischem Gebiet. Da trauert man um die einstige weltberühmte Wiener medizinische Schule. Und bietet im Handumdrehen neue Forschungsergebnisse, die dem Ruf der Fakultät auch heute noch alle Ehre machen.
Es ist schon richtig, daß die Wegbereiter der Medizin heute in Übersee sitzen. Doch der wissenschaftliche Output aus den Wiener Universitätskliniken ist auch nicht ohne und auf manchen Gebieten sogar international richtungsweisend.
Wer weiß beispielsweise, daß es auf das Konto österreichischer Entwicklungsarbeit geht, wenn mehr Frauen als noch vor zehn Jahren nach Brustkrebsoperationen ihre Brust behalten können? Waren es im Jahr 1984 nur 20 Prozent der Frauen, die brusterhaltend operiert wurden, konnte dieser Prozentsatz bis zum Jahr 1990 auf 60 bis 70 Prozent erhöht werden. Umfassende Untersuchungen haben gezeigt: sogar bei größeren Tumoren können Ärzte heute die Brust retten. "Mit Chemotherapie, die noch vor der Operation verabreicht wird, kann der Tumor verkleinert werden und eine brusterhaltende Operation ist möglich", erklären Universitätsprofessor Raimund Jakesz, Vorstand der Chirurgischen Abteilung und Universitätsprofessor Ernst Kubista, Vorstand der Abteilung für Spezielle Gynäkologie.
Welche Bedeutung diesen Forschungen zukommt, zeigt die Tatsache, daß mittlerweile jede neunte Frau in Österreich - und auch im übrigen Europa - damit rechnen muß, an Brustkrebs zu erkranken. Wiener Mediziner entwickelten beim Brustkrebs eine weitere bahnbrechende Therapiemöglichkeit. Dabei geht es um einen möglichst schonenden und effektiven Einsatz der zumeist gefürchteten Chemotherapie. Mit der sogenannten "Sensitivitätstestung" ist es möglich, schon vor einer Chemotherapie bei Brustkrebs festzustellen, ob sie auch wirken wird. Hat man bisher quasi "blind" mit einer Chemotherapie begonnen, so können Ärzte jetzt schon vorher sagen, ob die Behandlung Erfolg verspricht. Dazu der Gynäkologe Universitätsprofessor Ernst Kubista, an dessen Abteilung dieses neue Verfahren entwickelt wurde: "Mit dieser Methode kann für jede Frau die individuell abgestimmte und optimale Therapie ermittelt werden".
Der Vorgang: bei der Operation wird Tumorgewebe steril entnommen, in einer Gewebekultur zum Wachstum gebracht und gegen verschiedene gängige Chemotherapeutika-Kombinationen getestet. "Damit kann man mit rund 90prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, welches Medikament wirkt und welches nicht", erläutert Kubista. Und sofort kann mit einer effektiven Behandlung begonnen werden. "Wird a priori die wirksamste Chemotherapie eingesetzt und somit keine Zeit mit einer unwirksamen Behandlung verloren, ist mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten, daß es auch höhere Heilungsraten gibt", resümiert Kubista.
Internationale Beachtung erlangten auch Wiener Forscher, die sich mit Gendefekten beschäftigen. Der Onkologe Universitätsprofessor Christoph Zielinski forscht an dem sogenannten p53 Gen. Es wird am häufigsten mit Krebs assoziiert. Es handelt sich dabei um ein "Tumor-Suppressor-Gen": Ein intaktes Gen bewirkt, daß veränderte Zellen zugrunde gehen. Ist das Gen jedoch defekt (mutiert), wachsen die Zellen trotz Strahlen- oder Chemotherapie weiter. Erstmalig werden diese Erkenntnisse in der Behandlung von Tumoren im Hals-, Nasen-, Ohrenbereich eingesetzt.
Weltweit führend sind die Wiener in der Darstellung dessen, was sich bei psychiatrischen Erkrankungen im Gehirn abspielt. Universitätsprofessor Siegfried Kasper, Chef der Klinischen Abteilung für Allgemeine Psychiatrie: "Durch die Entwicklung hochsensibler Apparate ist es möglich, sichtbar zu machen, welchen Weg bestimmte Neurotransmitter wie die sogenannten Glückshormone Serotonin oder Dopamin über die Nervenbahnen nehmen, wohin sie verschwinden und welches chemische Ungleichgewicht dafür verantwortlich ist." - Alles Grundlagenforschungen für neue Therapien und Arzneien etwa für Depressionen oder Drogenkrankheiten.
Derzeit laufen auch vielversprechende Untersuchungen über das Alkoholverlangen von Trinkern. Kasper: "Der Mensch verfügt in einem bestimmten Teil seines Gehirns, im Hypothalamus, über eine natürliche Bremse. Wir wollen nun herausfinden, was zur Störung dieses Impulskontrollverhaltens führt und den Heißhunger nach Alkohol verursacht."
Dazu kommen noch eine ganze Reihe von Forschungen über Eßstörungen, Depressionen, Schizophrenie und den Einsatz von Lichttherapie und Schlafentzug, womit die Wiener Psychiatrie von sich reden macht.
An der Klinischen Abteilung für Sozialpsychiatrie und Evaluationsforschung wiederum hat ein Forscher entdeckt, daß Beruhigungsmittel ihre angstlösende, schlafanstoßende, anfallshemmende und muskelentspannende Wirkung über verschiedene Nervenzellrezeptoren ausüben. Dem Forscher ist es gelungen, diese unterschiedlichen Rezeptoren zu isolieren. Diese Untersuchungen machen es möglich, Substanzen zu entwickeln, die jeweils eine gewünschte Wirkung (angstlösend), aber nicht die unerwünschte Wirkung (Müdigkeit erzeugend) haben. Dadurch kann viel punktgenauer therapiert werden, was die Lebensqualität der Betroffenen beträchtlich verbessert.
Ähnliche Spitzenleistungen gibt es auch auf dem Gebiet der Schmerzbehandlung. An der Abteilung für Anästhesie und Allgemeine Intensivmedizin befindet sich das einzige österreichische Studienzentrum für die Erprobung eines speziellen Schmerzmittels. Dabei handelt es sich um einen Eiweißstoff der aus Kalifornien stammenden Meeresschnecke Conus magnus, der für die Behandlung therapieresistenter Schmerzzustände bei Krebs und anderen chronischen Schmerzen eingesetzt wird.
Als weltführend anerkannt ist auch das Zentrum für "Extracorporale Photoimmunotherapie" an der Dermatologischen Universitätsklinik. Bei diesem Vorgang werden die weißen Blutkörperchen außerhalb des Körpers in Gegenwart einer speziellen Substanz mit ultraviolettem Licht (UVA) bestrahlt, und anschließend wieder in den Kreislauf des Patienten rückinfundiert. Zur Anwendung kommt dieses Verfahren zum Beispiel bei Abstoßungsreaktionen nach Transplantationen, aber auch bei entzündlichen Darmerkrankungen.
Ähnliche Forschungserfolge vermeldet die Wiener Medizin auch auf dem Gebiet der Dermatologie mit Arbeiten zur Hautkrebsbehandlung und auch in der Radiologie, wo Spitzenleistungen bei der Diagnose von Veränderungen im Skelett, aber auch im Bereich der Gesichtsknochen erfolgen.
Das - und nicht nur der Charme der alten Donaumetropole - ist auch der Grund, daß Wien nach wie vor der Treffpunkt von Medizinern aus aller Welt ist. Die Forschung der Wiener Medizin lebt, vielleicht aktiver denn je. Und das, obwohl Österreich im internationalen Konzert der Forschungsmächte die dritte Geige spielt. Für Grundlagenforschung gibt der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung ganze 88 Schilling pro Einwohner (1,5 Prozent des BIP) aus, der Schweizer Nationalfonds investiert 424 Schilling pro Einwohner (mehr als zwei Prozent des BIP) und die Deutsche Forschungsgemeinschaft 175 Schilling pro Einwohner (mehr als zwei Prozent des BIP).
Es muß schon auf das Konto eines hohen Engagements und der Kreativität der Forscher gebucht werden, wenn sie trotz der finanziellen Knappheit immer wieder international beachtete Hochleistungen liefern. Erfolgsrezept a la Vienne: nicht mitmischen bei allem, sondern Spezialisierung auf ganz bestimmte Bereiche.
Forschung hat in Wien Tradition. Und ein Ignaz Semmelweiß, der mit seinem Händewaschen das Kindbettfieber besiegte, ein weltberühmter Karl Landsteiner, der Entdecker des Blutgruppensystems oder ein Billroth, dem die erste erfolgreiche Magenteilentfernung gelang, sie alle wären mit Sicherheit stolz auf ihre Schüler anno 1998.
Die Autorin ist Medizinjournalistin bei der Österreichischen Ärztezeitung.
Steigende Qualität der Spitzenmedizin Der sogenannte Impact-Faktor gibt an, wie oft eine veröffentlichte wissenschaftliche Arbeit in anderen Publikationen zitiert wird und ist daher ein international vergleichbares Maß für die Qualität einer Forschungsarbeit. An allen drei österreichischen medizinischen Fakultäten, Wien, Innsbruck und Graz ist der Impact-Faktor steigend - ein gutes Zeugnis für die heimischen Forscher.
Die zehn Arbeiten mit der höchsten Punkteanzahl stammen dabei aus den Wiener Universitätskliniken des AKH, wo pro Jahr rund 1.200 bis 1.400 Publikationen erscheinen. An der Spitze stand 1997 dabei das Institut für Immunologie, gefolgt vom Institut für Molekulare Genetik.
In Graz war 1997 das Institut für Medizinische Biochemie federführend, in Innsbruck das Institut für Pharmakologie. M. Kunit