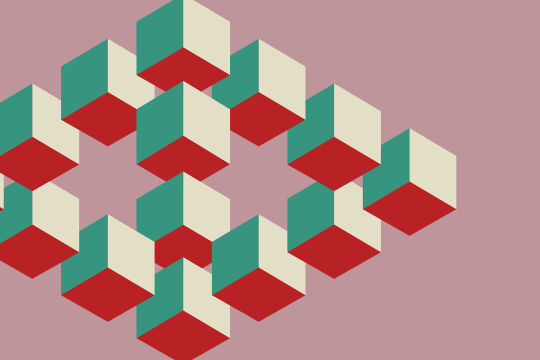Ein zweiter ähnlicher Fall: In der Früh hatte die Frau einen roten Punkt an der Brust festgestellt: Bis sie nachmittags zum Art kommt, ist die Brust auf die doppelte Größe angeschwollen. Die Diagnose: Abszess. Es muss operiert werden. Sie brauche sich aber nicht zu sorgen. Die Sache sei sicher gutartig. Nach der Operation ist alles anders: "Es tut mir leid, das war ein Fehler." Diagnose Krebs, faustgroß. Für die Patientin stürzt an diesem Freitag die Welt zusammen. Es folgen qualvolle Tage bis weitere Untersuchungen am Montag stattfinden.
Katastrophenstimmung aber nicht nur bei jenen, die sich aufgrund einer Fehldiagnose in Sicherheit wiegen. Wer immer persönlich mit Krebs konfrontiert wird, fühlt sich zutiefst in seiner Existenz bedroht. "Als wir die Nachricht bekamen, war unsere erste Reaktion: Alles steht still," erzählt die Frau eines Bekannten, bei dem Leukämie diagnostiziert worden war. "Alles rund um uns wirkte gänzlich unwirklich. Erst nach Tagen begann ich die neue Situation zu erfassen - und nur ganz langsam."
Dass Krebs eine relativ häufige Erkrankung ist, kann als bekannt vorausgesetzt werden. Und dennoch - wer mit dieser Nachricht konfrontiert wird, fällt aus allen Wolken. 1997 mussten sich rund 35.000 Österreicher mit dieser Hiobsbotschaft auseinandersetzen, etwa gleich viele Männer wie Frauen. Tendenz steigend: 14 Prozent plus seit 1983. Am häufigsten betroffen sind Brust, Lunge, Gebärmutter, Magen und Darm.
Der Blick in die Statistik zeigt aber nicht nur die steigende Häufigkeit von Krebserkrankungen, sondern er lässt auch erkennen, dass die medizinischen Möglichkeiten, der Krankheit Herr zu werden, sich deutlich verbessert haben (Seite 14). Betrachtet man nämlich die Entwicklung der Krebs-Todesfälle, so zeigt sich, dass sie im Zeitraum 1985 bis 1998 relativ konstant bei rund 19.000 lagen. Die standardisierten, also auf die Bevölkerung bezogenen Werte zeigen sogar eine fallende Tendenz. Krebs wird also häufiger, seine Diagnose ist jedoch immer weniger oft mit einem Todesurteil gleichzusetzen.
Und dennoch, das Schockerlebnis bleibt kaum jemandem erspart. Wie damit umgehen? Für viele ist es wichtig, sich aussprechen zu können. Idealerweise geschieht dies im Kreis der Familie, mit den vertrauten Menschen. Leider stellt sich nur allzu oft heraus, dass dieser Personenkreis als überfordert ist. "Ich habe wahnsinnig viel Zeit damit verbringen müssen, Leuten zu helfen, mit mir umzugehen," erzählt Ruth Steiner, Begründerin einer Selbsthilfegruppe von Brustkrebs-Patientinnen (siehe Kasten) im Rückblick auf ihre Erfahrungen.
Wie geht man nun aber mit Krebskranken um? "Der Hauptvorschlag: So ehrlich wie möglich sein, so offen wie möglich darüber reden. Denn das Schweigen erzeugt Spannungen," fasst Karin Isak, klinische Psychologin bei der Krebshilfe in Wien (Seite 15) die Erfahrungen ihrer Tätigkeit als Beraterin zusammen. Und eine Krebs-Patientin sekundiert: "Das bisherige Verhalten möglichst natürlich weiterhin fortsetzen."
Das gilt besonders für die Ehepartner, meint Isak: "Es bewegen ja beide tausend Fragen. Durch Schweigen kann es leicht zu Depressionen kommen. Oft trauen sich die Angehörigen nicht, ein Gespräch zu beginnen, weil sie meinen, der Betroffene wolle nicht darüber reden."
Viele verdrängen Und wenn jemand nicht reden will, was vielfach bei Männern der Fall ist? Das müsse man auch zur Kenntnis nehmen. "Man darf den anderen nicht löchern. Man muss sich immer in Erinnerung rufen, dass jede Geschichte individuell sehr unterschiedlich ist,." lautet Isaks Antwort. "Vor allem Männer versuchen oft, die eigene Not auf andere Weise zu kompensieren. Viele stürzen sich in die Arbeit oder in eine sportliche Betätigung, schieben das Problem am liebsten weg." Bei ihnen heiße es: "Lass mich in Ruhe! Ich will gar nicht daran denken." Isaks Rat: "Ich würde empfehlen, den anderen zu fragen: ,Was brauchst Du? Was wünschst Du Dir?'" Frauen wünschten sich erfahrungsgemäß eher, über ihre Not zu sprechen. Daher sind es auch vor allem Frauen, die sich an die "Krebshilfe Wien" wenden.
Sehr viele Patienten fühlen sich von den sich nach der Diagnose überstürzenden Ereignissen total überfahren. Selbst wenn man dazu geneigt hat, aus einer gewissen Sorge heraus die alles entscheidende Untersuchung hinauszuschieben, so soll es dann, sobald die Situation geklärt ist, meist sehr rasch gehen. Man will ja vermeiden, dass der Krebs weiterwuchert.
Vielfach drängen auch die Ärzte. Sie sind gerade in dieser Situation besonders gefordert. "Es war für mich von größter Bedeutung, dass ich mich bei den behandelnden Ärzten geborgen gefühlt habe," erzählt ein Patient, der seit Monaten in Chemotherapie-Behandlung steht. Und Ruth Steiner fasst die Erfahrungen, die Frauen mit den Ärzten machen, so zusammen: "Jene fühlen sich am besten betreut, bei denen der Arzt sich Zeit nimmt - und der offen mit ihnen spricht. Es ist gut, wenn er erklärt, welche Therapie man bekommt, welche Nachwirkungen sich ergeben werden. Leute, die sich gut betreut fühlen, haben einen ganz anderen Weg als die anderen." Und sie ergänzt: "Ich meine, dass eine Frau, die sich nicht gut betreut fühlt, den Arzt wechseln sollte."
Allerdings sollte Ärzte auch Vorsicht bei ihren Prognosen walten lassen, mahnt eine ehemalige Patientin im Rückblick auf ihre Erfahrung vor vielen Jahren ein. Sie konnte nur mit größter Mühe verhindern, dass im Zuge ihrer Gebärmutter-Operation auch die Eierstöcke entfernt wurden - sicherheitshalber.
Für Ärzte sei es allerdings immer wieder eine große Herausforderung, der Alltagsroutine den Kampf anzusagen, gibt der Onkologe am AKH Thoma Schenk zu. Immer wieder müsse man sich in Erinnerung rufen, dass Zeit für ein gutes Gespräch trotz Hektik wichtig ist und dass Verdrängungsprozesse bei den Patienten und ihre manchmal schwer zu ertragende Reaktion verständlich sind.
Ein großes zusätzliches Leid für Krebspatienten bedeutet die Verunsicherung, die ihre Erkrankung in ihrer Umgebung auslöst. "Ein Großteil unserer Freunde und Bekannten hat sich zurückgezogen und das stimmt traurig," beklagt der schon erwähnte Chemotherapie-Patient. "Kaum jemand kam zu Besuch ins Spital. Die Leute wollen entweder nicht stören oder sie sind verunsichert." Dabei hätte schon ein Brief, eine Postkarte Freude bereitet. Es sei so wichtig, jemanden zu haben, der bereit ist, das Leid mitzutragen.
Ähnlich die Erfahrungen von Ruth Steiner: "Man kann sehr viel zerstören, wenn man einen Menschen fallen lässt. Viele Patienten leiden zusätzlich daran, dass sie von ihren Freunden verlassen werden. Das ist eines der größten Probleme. Interessant ist auch, dass es in dieser Situation zu einer sehr hohen Scheidungsrate kommt. Außerdem werden viele nach der Diagnose Krebs gekündigt. Manche Dienstgeber wollen die vorhersehbaren Krankenstände vermeiden. Dabei könnte gerade der Dienstgeber vermitteln: Du bist für uns wichtig, du wirst gebraucht. Das hilft enorm."
Über eines sind sich alle Befragten einig: Die Diagnose Krebs konfrontiert mit existenziellen Fragen. "Diese Erfahrung ist eine Möglichkeit, zum Glauben zu finden," resümmiert Ruth Steiner ihre Erfahrungen. "Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass man sich von Gott enttäuscht abwendet. Es hängt von der geistlichen Begleitung ab. Es gibt ausgezeichnete Krankenhausseelsorger, aber auch noch die alte These: Du hast gesündigt, jetzt musst Du leiden. Aber Gott will nicht, das wir leiden."
"In der Kapelle des AKH wurde mir die Erfahrung geschenkt", berichtet die Frau eines Krebspatienten, "dass nicht nur die Tage, die man als gut erlebt, sich als die guten erweisen. Die schweren Tage haben auch ihren tiefen Wert. Diese Einsicht hat mir eine große Ruhe geschenkt."
Ähnlich auch die Erfahrung von Ruth Steiner: "Ich habe begriffen, dass ich nicht umsonst leide. Mein Leiden wollte ich nicht vergeuden. Und so habe ich mir überlegt: Für wen opfere ich mein Leiden auf? Leiden ist nicht umsonst. Es hat alles einen Sinn."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!











































































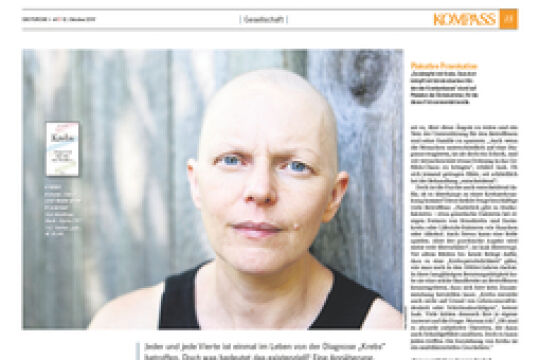




.jpg)