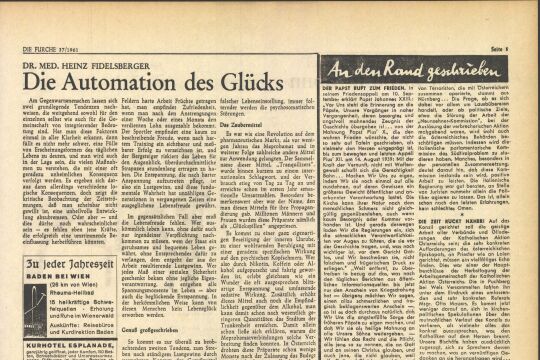Ein „neues” Herz — ein anderer Mensch?
Herzverpflanzungen: Schwere, aber mittlerweile oft praktizierte Eingriffe. Wie verändern sie das Leben der Patienten? Ändert sich deren Persönlichkeit? Ein Untersuchung ist diesen Fragen nachgegangen.
Herzverpflanzungen: Schwere, aber mittlerweile oft praktizierte Eingriffe. Wie verändern sie das Leben der Patienten? Ändert sich deren Persönlichkeit? Ein Untersuchung ist diesen Fragen nachgegangen.
Nachdem Christiaan Barnard am 3. Dezember 1967 die erste Herztransplantation am Menschen erfolgreich durchgeführt hatte, wurde das Verfahren weltweit enthusiastisch aufgenommen. Auch die Fachwelt überschlug sich im Hinblick auf die faszinierenden Möglichkeiten dieser neuen Therapie.
Diese anfängliche Euphorie legte sich jedoch im Hinblick auf die schlechten Überlebensquoten Anfang der siebziger Jahre (Einjahresüberle-bensquote war 20 Prozent), die Anzahl der Transplantationen ging immer mehr zurück, das Verfahren täuschte alle Hoffnungen. Der Hauptgrund für die wenig befriedigenden Ergebnisse lag vor allem in einer früh einsetzenden Abstoßungsreaktion, da der Organismus das fremde Gewebe erkannte und sich dagegen wehrte.
Erst mit der Einführung der Substanz Cyclosporin A in die Therapie
1981 erlebte die Transplantationschirurgie wieder einen bis heute anhaltenden Aufschwung. Diese Substanz wurde als Zufallsbefund aus einem Pilz extrahiert. Die immunantwort-unterdrückende Therapie ermöglichte eine explosionsartig einsetzende Steigerung der Anzahl der Transplan tationen: Im Jahr 1985 wurden weltweit 669 Herztransplantationen durchgeführt, 1990 bereits 3056, und heute hat sich mit 271 Transplantzen-tren und mehr als 30.000 Herztransplantationen weltweit sowohl die Anzahl der Operationszentren als auch die der Herztransplantationen vervielfacht. Die Ein-Jahres-Überlebenszeit liegt heute bei 80 Prozent.
Die erste Herztransplantation in Österreich wurde im Oktober 1983 in Innsbruck durchgeführt. Seither wurden in Österreich (Stichtag 30.4.1997) 862 Herztransplantationen vorgenommen.
Kein „fremdes” Herz
Es sind immer die gleichen Fragen, die zum Thema Herztransplantation gestellt werden. Eine seit über neun Jahren an der Wiener Transplantationsabteilung laufende Studie liefert dazu Antworten:
■ Wie werden die Patienten damit fertig, ein fremdes Herz zu haben?
Gleich vorweg: sie erleben es nicht als „fremd”. Es wird nicht als kälter oder heißer, schwerer oder leichter empfunden als das eigene, sondern als „kräftiger, stärker, voller, genauso wie das eigene Herz vor der schweren Krankheit”. Ein durch seine lange Krankheit schwacher, abgemagerter Patient kommentierte das Gefühl gleich nach seiner Operation launisch als „wie ein Ferrari-Motor in einem alten VW”. Kein Patient spricht vom Spenderherzen als „fremdes Herz”. Es ist das „neue Herz”, das „zweite Herz”.
■ Was denken die Patienten über den Spender?
Im Krankenanstaltengesetz- von
1982;ist die rechtliche Situation der Organentnahme klar geregelt. Darin ist auch festgehalten, daß volle Anonymität zu herrschen hat zwischen Spender- und Empfängerseite. Aber: Wollen die Patienten überhaupt etwas über den Spender wissen? In unserer Studie zeigte sich, daß etwa ein Viertel der Befragten den Spender völlig aus ihrem Denken ausklammerten, ein weiteres Viertel eine enge, innere Beziehung zu dem unbekannten Spender angaben, und die Hälfte der Patienten hatten hinsichtlich des Spenders lediglich großes Interesse, Alter und Geschlecht zu erfahren (und somit die Beruhigung zu erhalten, ein junges, gesundes Herz eines Gleichgeschlechtlichen erhalten zu haben -letzteres ist vor allem für die Männer sehr wichtig). Es ist die Regel, daß religiöse Patienten den Spender ins Gebet einschließen, für ihn Messen lesen lassen.
■ Wird man ein anderer Mensch, wenn man ein neues Herz bekommt?
Drei Viertel der Befragten Patienten (37 Personen) erklärten, sie seien überhaupt nicht verändert („wegen diesem Muskel?”). 20 Prozent (zehn Personen) haben erklärt, sie seien deutlich verändert, dies habe jedoch nichts mit der Implantation des neuen Herzens zu tun, sondern es sei als Folge dieser Grenzerfahrung, die Todesnähe zu sehen. Es hätte einfach ein Wandel der Werte, der Präferenzen, der Prioritäten stattgefunden: Dinge, die früher so überaus wichtig gewesen wären, hätten nun an Bedeutung verloren, und andere, früher vernachlässigte, wären jetzt viel wichtiger. Nur drei Patienten berichteten über klare Veränderung der Persönlichkeit, ihres Fühlens, Denkens und Wollens, und führten dies eindeutig auf das neue Herz zurück („Ich war immer ein nervöser, hektischer Mensch. Jetzt bin ich die Ruhe selbst. Mir scheint, der Mensch, von dem ich das Herz gekriegt habe, war ein ganz ruhiger, bedächtiger Mensch, und seine Persönlichkeit ist auf mich übergegangen”).
■ Wie sieht die Lebensqualität langfristig aus?
Wir haben die Nahuntersuchung zur Lebensqualität der Patientenfamilien mit dem Jahr 1988 begonnen. Für jene 33 Patienten, die von der Erststichprobe von 1988 noch befragt werden können (insgesamt leben davon 40) gilt, daß sich laut Aussagen der Patienten selbst über diesen Zeitraum die körperliche Verfassung optimal erweist: Sie erleben kaum Beeinträchtigungen ihrer Leistung, viele sind berufstätig, stehen voll wieder im Leben. Die erlebten bekannten Nebenwirkungen der (lebenslangen) medikamentösen Begleittherapie wie zum Beispiel Händezittern, Übelkeit, Taubheitsgefühle in Fingern und Zehen sind mit guter Medikamenteneinstellung entweder fast verschwunden oder werden nach so langer Zeit einfach nicht mehr als belastend erlebt: Man hat sich arrangiert.
Dem optimalen körperlichen Zustand hinkt der seelische etwas nach: Das Leben mit der totalen Unvorher-sagbarkeit der Zukunft - die wir ja eigentlich alle haben, sie jedoch kaum zur Kenntnis nehmen - muß neu gestaltet werden, berufliche Möglichkeiten neu ausgelotet, der Platz in der Gesellschaft neu gesucht werden als jemand, der nicht mehr krank, aber auch nicht ganz gesund ist ... Das Ende des ersten postoperativen Jahres ist für die meisten Patienten eine Zäsur; sie feiern am Jahrestag der Transplantation ihren „ersten Geburtstag”. Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Abstoßungsreaktionen wird nun geringer, der Aktionsradius erweitert sich ständig, die Mobilität wird größer, die Kontrollen in der Klinik erfolgen nun in immer größeren Abständen. Unser am längsten trans-plantierter Patient lebt nun schon das 13. Jahr mit seinem zweiten Herz und erfreut sich bester Gesundheit.
■ Ist die Transplantation das Allheilmittel?
Nach erfolgreicher Transplantation scheint der Kampf um das Leben jetzt gewonnen, aber die Bemühungen, gut und erfüllt zu leben, gehen weiter. Was erschwert es denn den Patienten vor allem, auf ihren Platz in der Gesellschaft zurückzukehren?
Die Reaktionen der Mitmenschen, die es den Patienten schwer machen, Selbstwert zurückzugewinnen, wenn sie tatendurstig und nach Bestätigung suchend nach abgeschlossener Beha-bilitation wieder heim kommen. Der Anspruch eines Patienten „Für meine Nachbarn bin ich jetzt eine Mischung aus Wunder und Zombie” ist typisch. Oft herrscht Batlosigkeit und Ungläu-bigkeit, wenn ein schwacher, seit langem kränkelnder Mensch im Spital verschwindet und zwei Monate später kräftig und scheinbar ohne Einschränkungen wieder heimkommt.
Rollen neu definieren
Die Vorstellung vieler Patienten, sie könnten nach erfolgreicher Transplantation heimkommen und dort problemlos wieder anknüpfen, wo sie vor ihrer Erkrankung waren, ist Fiktion. Er steht nun nicht mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Ehefrauen sind oft nicht gewillt, Bollen und Aufgaben, die sie während der Zeit der schweren Erkrankung des Gatten oft widerwillig übernehmen mußten, aus denen sie dann vielfach aber auch persönlichen Gewinn und Aufschwung an Selbstwert gezogen hatten, wieder aufzugeben. Typisch ist der Ausspruch eines Patienten, er habe „ein Hausmütterchen verlassen und eine Familienmanagerin wiedergefunden”. Bollen müssen also neu definiert, Aufgaben neu verteilt werden. Ein schwieriger Weg für die Partnerschaft beginnt genau dann, wenn von allen Seiten nichts als Glück und familiäre Zufriedenheit erwartet wird.
Die Arbeitssuche: Jene Patienten, die nicht das Glück haben, von ihrer Firma weiterbeschäftigt zu werden, landen oft im Out. Unsicherheit, Unkenntnis der realen Gegebenheiten hinsichtlich Spitalsaufenthalte, Kontrolltermine, Krankenstände und ähnliches läßt viele potentielle Arbeitgeber schon von vornherein abwinken. Allen Chefs ins Stammbuch: Es kann ihnen oft nichts Besseres passieren, als ein Mitarbeiter, der lang krankheitshalber vom Arbeitsprozeß ausgeschlossen war, sich nutzlos gefühlt, über wenig Geld verfügt hatte, und der nach der Operation nichts lieber möchte, als endlich wieder eine vollwertige Arbeitskraft zu sein, seine Leistungskraft und Leistungsbereitschaft endlich wieder unter Beweis stellen zu können. Selbstverständlich hilft die Wiener Transplantationsabteilung (und sicher auch andere) jedem Personalchef mit Informationen weiter. Es ist nicht notwendig, daß ein Chef sich so verhält. „.. .als könne das neue Herz jederzeit hier mitten in der Montagehalle aus der Brust rausexplodieren ...!” (Zitat eines Patienten).
Lohnt es sich?
■ Hat sich die Transplantation, dieses äußerst aufwendige Verfahren, aus der Sicht der Patienten „gelohnt”?
Am Ende des ersten Jahres mit dem neuen Herzen wurden die Patienten folgendes gefragt: „Seit Ihrer Transplantation ist jetzt lange Zeit vergangen. Sie haben sicher viele Freuden, aber auch viele Probleme kennengelernt. Hat sich, in Summe gesehen, die Transplantation für Sie „gelohnt”? Würden Sie, wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten und Sie wieder vor der Wahl stünden, sich genauso wieder für den Eingriff entscheiden?”. 47 der 50 Befragten bejahten diese Frage sofort („so oft ja, ja, ja könnten's gar nicht schreiben, Frau Doktor”).
Zwei Patienten, die postoperativ mit schweren Komplikationen zu kämpfen gehabt hatten und deren Aufkommen zuerst mehr als fraglich erschienen war, bejahten sie zögernd: Jetzt in gutem Gesundheitszustand, würden sie sich wieder für den Eingriff entscheiden. Wenn man sie jedoch früher gefragt hätte, hätte die Antwort mit Sicherheit nein gelautet. Nur ein Patient, überraschenderweise ein völlig unauffälliger Patient mit offensichtlich guten Familienbeziehungen und gutem Operationserfolg, würde sich nicht mehr dem Eingriff unterziehen. Er wollte den psychischen Streß der langen Wartezeit nicht mehr, auch nicht um den Preis des Lebens, erleben wollen.
Univ. Doz. Dr Brigitte Bunzel ist Fachpsychologin für Klinische Psychologie an der Universitätsklinik für Herz- und Thoraxchirurgie in Wien.