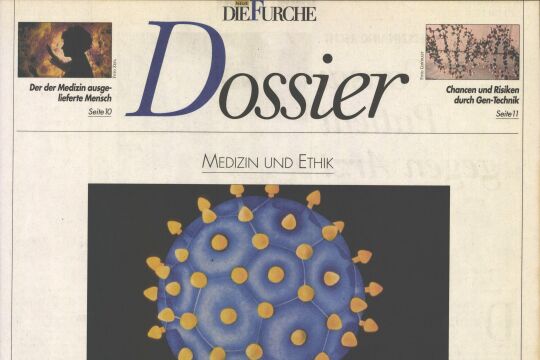Mangelnde Ausbildung, chronischer Zeitdruck und begrenzte Honorierung: Die Rahmenbedingungen für Ärzte, mit ihren Patienten ins Gespräch zu kommen, sind denkbar schlecht.
Für Ärzte ist sie die beste Gelegenheit, Krankengeschichten mit einem Gesicht zu verbinden und die Sichtweise der Betroffenen zu hören. Für Patienten bietet sie die Chance, endlich Auskunft über ihren Zustand zu erhalten. So viel zur Theorie der "Visite" im Krankenhaus. Die Praxis sieht leider anders aus, wusste Ulrike Toellner-Bauer im Rahmen der Alpbacher Gesundheitsgespräche zum Thema "Mündiger Patient - gesprächsfähiger Arzt" zu berichten: "Für jeden Patienten bleiben durchschnittlich rund drei Minuten", kritisierte die Verantwortliche für Pflegedienstleistungen an der Universitätsklinik Köln den Missstand in deutschen und österreichischen Krankenhäusern. Dienstpläne und Arbeitszeiten würden keinen Raum lassen für ein persönliches Gespräch. Zudem sei die Visite meist "ein reines Arzt-Arzt-Forum", so Toellner-Bauer. Kein Wunder, dass Pflegekräfte immer öfter gebeten würden, dem Patienten den Inhalt dieses Fachgeplänkels zu übersetzen. Die Visite als Ort der Kommunikation zwischen Arzt und Patient sei nicht mehr als ein "Kunstfehler", so die Pflege-Expertin. Ihr Fazit: "Das Krankenhaus bietet keinen Ort für ein partnerschaftliches Gespräch."
Harte Bandagen für die Verantwortlichen - und Wasser auf die Mühlen der Patientenanwaltschaft, die schon seit langem die mangelnde Gesprächsfähigkeit und -willigkeit der Ärzteschaft beklagt. "Die Patienten von heute erwarten sich, dass auf ihr Mitbestimmungsrecht Rücksicht genommen wird", stellte die ehemalige Kärntner Patientenanwältin, Doris Lakorny, vor dem Alpbacher Publikum klar. Zudem würden die Patienten in dieser Erwartung durch immer mehr Rechte gestützt.
So wurde etwa die zwischen dem Bund und einzelnen Bundesländern vereinbarte Patientenrechtscharta bereits in Kärnten, Oberösterreich, Niederösterreich und dem Burgenland umgesetzt. Die Steiermark habe die Charta gerade unterfertigt und werde sie in Kürze kundmachen, heißt es in der Patientenanwaltschaft. Auch in Salzburg und Tirol sei demnächst mit ihrer Unterzeichnung zu rechnen. "Damit das Recht des Patienten auf Selbstbestimmung von den Ärzten gewahrt und von den Patienten in Anspruch genommen werden kann, muss der Patient von seinen Ärzten alle ihn betreffenden Informationen erhalten", heißt es in der Charta.
Schock nach Diagnose
Gerade die Art und Weise, wie diese Informationen übermittelt werden, lässt nach Meinung Doris Lakornys jedoch oft zu wünschen übrig: Manchmal versetze die Diagnose des Arztes den Patienten in einen Schockzustand. "Später meint der Arzt dann: Ich habe Ihnen doch alles erklärt - und der Patient kann sich trotzdem an nichts erinnern", weiß Lakorny aus Erfahrung. Dieses fehlende Einfühlungsvermögen des Arztes sei nicht selten die Ursache für den ausbleibenden Behandlungserfolg: "Wenn der Arzt am Patienten vorbeiredet, hat der Patient am Arzt vorbeigelitten."
Gerade die Schulung der Kommunikationsfähigkeit wurde bislang in der Ärzteausbildung sträflich vernachlässigt. Zudem gingen die angehenden Mediziner bisher erst sehr spät mit ihren späteren Klienten auf Tuchfühlung: "Die Studierenden haben im Idealfall frühestens im achten Semester planmäßig den ersten Kontakt mit Patienten", heißt es etwa auf der Homepage der medizinischen Fakultät der Universität Wien selbstkritisch. Höchste Zeit also, die heimische Ärzteausbildung auf neue Beine zu stellen. Tatsächlich wird im Zuge des neuen Medizin-Curriculums an der Universität Wien ein "viel größerer Wert" als bisher auf die ärztliche Gesprächsführung gelegt, erklärt der Leiter dieser Lehrveranstaltung, Oskar Frischenschlager vom Institut für Medizinische Psychologie, gegenüber der Furche. So starte die Ausbildung in ärztlicher Gesprächsführung nun bereits während der Studieneingangsphase. Vor allem werde den Medizinern vermittelt, dass das Gelingen eines Gesprächs wesentlich von emotionalen Aspekten abhänge. Für die derzeit praktizierenden Ärzte kommt diese Reform freilich zu spät, gibt Frischenschlager zu: "Es war eben bisher nicht Teil der Lernziele, mit den Patienten sinnvoll zu kommunizieren."
"Gesundheitstechniker" Arzt
Für Hildegunde Piza ein schweres Versäumnis. Oft genug hätten nicht Ärzte, sondern "Gesundheitstechniker" die Universitäten verlassen, kritisierte die Innsbrucker plastische Chirurgin und Wissenschafterin des Jahres 2000 in Alpbach. Die Folge dieses Missstandes sei das "immer seltener werdende Glück, wenn die Ausstrahlung eines Arztes Vertrauen schafft", so die Spitzenmedizinerin. Der Arzt dürfe aber das Bedürfnis nach Geborgenheit des Kranken in keiner Weise enttäuschen - "auch wenn er dabei gegen die Arbeitszeitregelung verstößt." Oft genug würden aber ambitionierte Ärzte daran gehindert, länger als nötig im Krankenhaus zu bleiben - also auch daran, in einer stressfreieren Phase mit ihren Patienten längere Gespräche zu führen: "Wenn ein Arzt um acht Uhr kommt, muss er das Spital oft um 13 Uhr verlassen", entrüstet sich Piza.
Diesem zunehmenden Zwang zu Effizienz und Kostenminimierung fühlt sich auch Gabriele Kogelbauer ausgesetzt. Als Standesvertreterin der angestellten Ärzte in der österreichischen Ärztekammer beklagt sie die zunehmende "Fließbandarbeit" im Krankenhaus. "Vor einer Darmspiegelung haben viele Leute Angst", weiß die langjährige Internistin an der Wiener Rudolfstiftung. "Aber sie können mich erst zur Untersuchung befragen, wenn ich schon längst fertig bin." Umso mehr fürchtet Kogelbauer die geplante Personalbedarfsberechnung des Wiener Krankenanstaltenverbundes. Diese würde Ärzte dazu zwingen, ihre Leistungen in Minuten anzugeben, so Kogelbauer. Von Seiten des Krankenanstaltenverbundes stellt man derlei Pläne jedoch in Abrede: Bei der Personalbedarfsberechnung sei "keine Minutenmessung vorgesehen". Dem ärztlichen Gespräch werde weiterhin eine "große Bedeutung" beigemessen, stellt man auf Anfrage der Furche fest.
Ähnliche Interpretationsunterschiede bestehen auch für den niedergelassenen Bereich. "Unser Kassensystem ist bei den Arztgesprächen kontraproduktiv", kritisiert Obmann Jörg Pruckner von der Ärztekammer. So dürfe etwa eine "therapeutische Aussprache" nur einmal im Quartal - und auch das nur bei dem fixen Satz von 18 Prozent der Patienten - verrechnet werden, klagt Pruckner und spricht vom "Durchschleusen der Patienten". Ganz anders die Einschätzung der Wiener Gebietskrankenkasse: Ein "therapeutisches Gespräch" sei als Sonderleistung zu betrachten und nicht bei jedem Patienten notwendig. Zudem habe man in der Vergangenheit mehrfach die Tarife für zuwendungsspezifische Leistungen wie etwa Hausbesuche erhöht. In der Folge sei jedoch deren Zahl geschrumpft, rechnet der Pressesprecher der Krankenkasse, Jan Pazourek, vor: "Wir haben unsere Zweifel, ob Geld tatsächlich als Anreiz für Ärzte dient, das zu machen, wozu sie ohnehin verpflichtet sind."
Internet ist kein Ersatz
Dass noch immer zu wenige Ärzte dieser Verpflichtung zum einfühlenden Gespräch nachkommen, ist für Ruth Wodak unbestritten. Allerdings müssten nicht nur die Mediziner lernen, aufmerksam zuzuhören und verständlich zu antworten - auch die Patienten könnten daran arbeiten, genauere Fragen zu stellen. Als teilweise hilfreich erachtet die Wiener Sprachsoziologin die zahlreichen Gesundheitsportale im Internet. Diese könnten kundigen Nutzern durchaus helfen, das Wissen über die eigene Krankheit zu erweitern oder interessante medizinische Studien auszuforschen. Ein Ersatz für die Kommunikation zwischen Arzt und Patient sei das Internet freilich niemals, erklärte Wodak in Alpbach: "Vertrauen bilden, Fragen stellen und Missverständnisse klären kann man halt nur im persönlichen Gespräch."
Die Patientenrechtscharta kann unter www.patientenanwalt.com heruntergeladen werden.
Infos für Angehörige
Die Patientenrechtscharta zu Auskünften gegenüber Angehörigen: "Grundsätzlich darf nur der Patient selbst informiert werden. So ist der Patient automatisch davor geschützt, dass seine Privat- und Intimsphäre durch andere verletzt wird. (...) Ist der Patient hingegen damit einverstanden, dass Angehörige, Verwandte, Freunde oder Bekannte Informationen erhalten, darf der Arzt sehr wohl Auskunft geben. Der Patient kann also so genannte "Vertrauenspersonen" nennen, die im gleichen Ausmaß wie er selbst, informiert werden müssen."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!