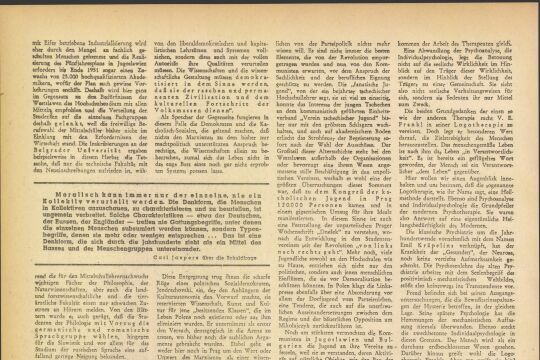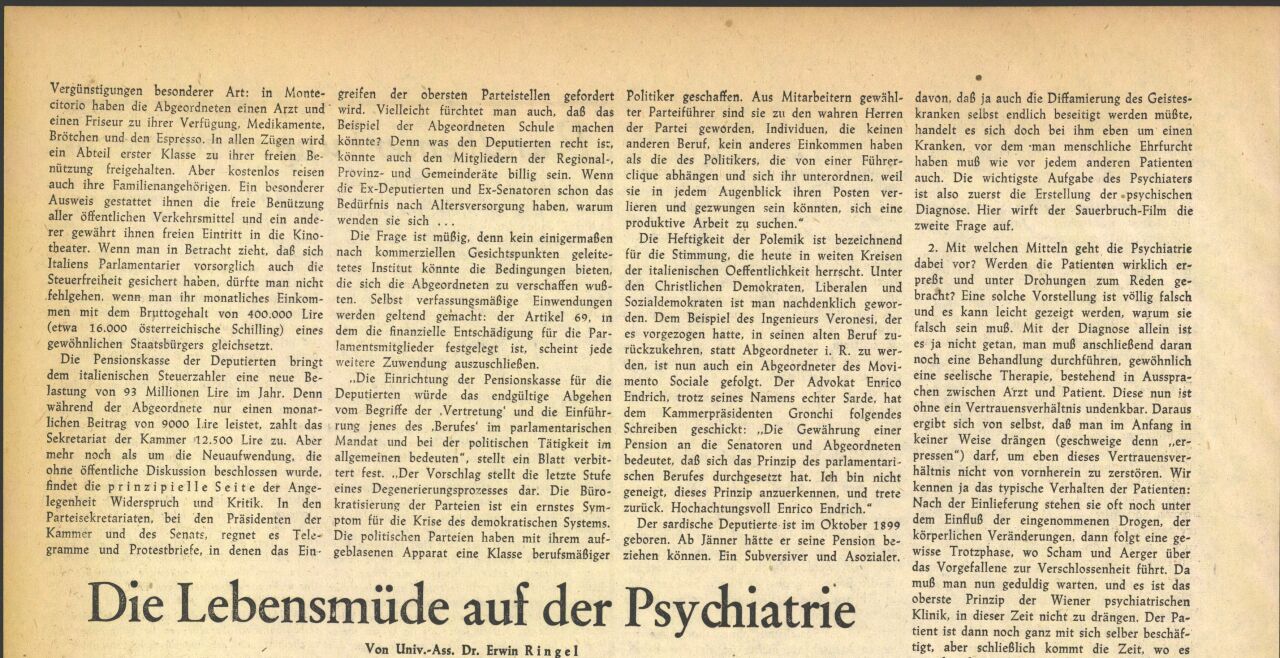
Im „Sauerbruch-Film“ wird etwa folgendes gezeigt: Eine Frau wirft sich in selbstmörderischer Absicht vor die Straßenbahn und zieht sich Verletzungen zu. Sie wird durch die Rettung zur chirurgischen Klinik gebracht, dort lehnt man jedoch, als bekannt wird, daß es sich um einen Selbstmordversuch handelt, die Aufnahme ab und läßt die Patientin auf die Psychiatrie führen. Die Psychiater bemühen sich, in Kontakt mit der neuen Patientin zu kommen, und versuchen, zu erfahren, warum der Selbstmordversuch erfolgte. Die Patientin schweigt beharrlich, worauf die Oberschwester Drohungen gegen sie ausstößt, etwa in dem Sinne: „Wir werden Sie schon zum Sprechen bringen.“ Inzwischen hat sich Sauerbruch, der beim Selbstmordversuch zufällig Augenzeuge war, eingeschaltet und die Patientin in der Psychiatrie aufgespürt. Es findet ein kurzer Kompetenzstreit statt. Der Chef der Psychiatrie betont: Sie ist als Suicidantin zurecht bei uns. Säuerbruch als Chirurg weist auf ihre Verletzungen hin, die zuerst einer chirurgischen Behandlung bedürfen. Er spricht nun seinerseits mit der Patientin und diese eröffnet sich ihm, berichtet über ihr schweres Schicksal, aus dem sie keinen anderen Ausweg gesehen habe, als aus dem Leben zu gehen. Sauerbruch unternimmt dann nicht nur die chirurgische Behandlung, sondern er ist in der Folge auch bemüht, das häusliche Milieu der Patientin zu erforschen, ihre Lebenssituation kennenzulernen und alle Beteiligten dahingehend zu beeinflussen, die Konfliktstoffe aus der Welt zu schaffen.
Dieser Filmausschnitt, in dem die Psychiatrie wirklich nicht allzu gut wegkommt, bietet willkommenen Anlaß, einige Fragen, die in Zusammenhang mit dem Selbstmordproblem stehen und die die Oeffentlichkeit mit Recht interessieren, deshalb auch in aller Oeffentlichkeit zu diskutieren.
1. Hat der Chef der Psychiatrie recht, wenn er im Film erklärt: Als Selbstmörderin gehört sie auf die Psychiatrie? Ist es nicht Sache jedes einzelnen, was er mit seinem Leben macht, darf sich da jemand einmischen? — Jüngst hat Khaum darauf hingewiesen, daß durch Verkehrsunfälle bedeutend mehr Personen sterben als durch alle Infektionskrankheiten zusammen. Eine solche Nachricht wirkt sicher alarmierend. Aber ist es eigentlich nicht-ebenso aufregend, daß auch durch eigene Hand viel mehr Menschen den Tod erleiden als durch Infektionskrankheiten? Das jedoch erschüttert niemanden! Die Nächstenliebe ist heute so weitgehend abgebaut, daß man sich kaum noch um den anderen kümmert. „Das ist seine Angelegenheit, wenn er sich umbringt, Hauptsache, daß er niemanden anderen gefährdet.“ Man schweigt also zu den erschütternden Zahlen — jährlich etwa 1600 Selbstmorde in Oesterreich, von den Selbstmordversuchen ganz abgesehen. — Man geht darüber zur Tagesordnung über. Und doch ist dieser Selbstmord, den manche gar als „die letzte Freiheit, die den Menschen heute noch geblieben sei“, bezeichnet haben, fast immer der Ausdruck einer psychischen Krankheit. Zugegeben sei, daß es in der Welt für einen Menschen katastrophale Situationen geben kann, die den Gedanken an Selbstmord nahelegen. Aber selbst hier kommt es auf die Persönlichkeit an, der dies widerfährt und auf ihre Reaktionsweise.
Wir haben gerade in den vergangenen schweren Zeiten gesehen, daß sich zwei Menschen, die sich äußerlich in der genau gleichen trostlosen Situation befanden, ihrer Stellungnahme nach durchaus nicht gleich verhielten. Man darf eben das große Geheimnis — den Menschen — nicht übersehen. So kann man also keineswegs behaupten, daß es Situationen gibt, die unbedingt zum Selbstmord zwingen. Wohl aber muß festgestellt werden, daß die meisten Selbstmörder schließlich schon bei relativen Geringfügigkeiten das Gefühl haben, es bleibe nur ein Ausweg, nämlich der Selbstmord, daß sie sich in einer krankhaften Einengung zum Selbstmord gezwungen fühlen. Bezeichnend dafür ist, daß die Geretteten, wenn sie später zurückdenken, es nicht fassen können, wie sie „so etwas“ tun konnten. Zu groß erscheint ihnen dann die Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Gegebenheiten und ihrer Reaktion darauf, sie erkennen, daß sie die Dinge viel düsterer gesehen haben, als sie waren.
Diese erwähnte Einengung nun ist außer Zweifel ein Krankheitssymptom, und es ist Aufgabe des Arztes, diese Krankheit zu erkennen und zu bekämpfen. Es kann das eine Geisteskrankheit sein (etwa 15 Prozent aller Selbstmörder sind geisteskrank), in der großen Mehrzahl der Fälle aber handelt es sich um seelische Erkrankungen, um neurotische Verhaltensweisen. — Aus diesen Darlegungen geht eigentlich die Berechtigung, ja die ernste Verpflichtung des Psychiaters, sich mit den geretteten Selbstmordkandidaten auseinanderzusetzen, klar hervor. Es ist eine Tatsache, daß die moderne Psychiatrie ihren Aufgabenkreis den Anforderungen der Zeit entsprechend, weit über die Geisteskrankheiten ausgedehnt hat und es wäre an der Zeit, daß die Oeffentlichkeit nicht in jeden Patienten einen „Geistesgestörten“ sieht, ganz abgesehen davon, daß ja auch die Diffamierung des Geisteskranken selbst endlich beseitigt werden müßte, handelt es sich doch bei ihm eben um einen Kranken, vor dem -man menschliche Ehrfurcht haben muß wie vor jedem anderen Patienten auch. Die wichtigste Aufgabe des Psychiaters ist also zuerst die Erstellung der .psychischen Diagnose. Hier wirft der Sauerbruch-Film die zweite Frage auf.
2. Mit welchen Mitteln geht die Psychiatrie dabei vor? Werden die Patienten wirklich erpreßt und unter Drohungen zum Reden gebracht? Eine solche Vorstellung ist völlig falsch und es kann leicht gezeigt werden, warum sie falsch sein muß. Mit der Diagnose allein ist es ja nicht getan, man muß anschließend daran noch eine Behandlung durchführen, gewöhnlich eine seelische Therapie, bestehend in Aussprachen zwischen Arzt und Patient. Diese nun ist ohne ein Vertrauensverhältnis undenkbar. Daraus ergibt sich von selbst, daß man im Anfang in keiner Weise drängen (geschweige denn „erpressen“) darf, um eben dieses Vertrauensverhältnis nicht von vornherein zu zerstören. Wir kennen ja das typische Verhalten der Patienten: Nach der Einlieferung stehen sie oft noch unter dem Einfluß der eingenommenen Drogen, der körperlichen Veränderungen, dann folgt eine gewisse Trotzphase, wo Scham und Aerger über das Vorgefallene zur Verschlossenheit führt. Da muß man nun geduldig warten, und es ist das oberste Prinzip der Wiener psychiatrischen Klinik, in dieser Zeit nicht zu drängen. Der Patient ist dann noch ganz mit sich selber beschäftigt, aber schließlich kommt die Zeit, wo es aus ihm herausdrängt, wo er die Aussprache, die Möglichkeit der Katharsis sucht. Selbstverständlich muß hier auch den individuellen Wünschen Rechnung getragen werden: Der eine zum Beispiel wird sich leichter einem Mann anvertrauen, der andere eine Aerztin vorziehen. Viele Nuancen gilt es hier zu berücksichtigen, um die günstigsten Bedingungen für die weitere Therapie zu gewährleisten. — Aber, wird man fragen: Wozu denn das alles, wenn doch der Patient nun sowieso bereits gerettet ist? Es ist richtig, daß viele Patienten nachher den Selbstmord als einen Unsinn bezeichnen, daß sie glücklich sind, das Leben „ein zweites Mal geschenkt bekommen zu haben“. Gibt es dann noch eine Wiederholungsgefahr? Diese ist bei Geisteskrankheiten auf alle Fälle gegeben, sie besteht aber in gewissem Sinne auch bei dem Neurotiker. Es sind bestimmte Verhaltensweisen, die sich langsam verstärken und steigern, die schließlich zum Selbstmord führen. Begegnet man nun dem betreffenden Geretteten einige Zeit nach dem Selbstmordversuch wieder, so muß man recht häufig mit Bedauern feststellen, daß er schon wieder die alten Verhaltensweisen zeigt und sich daher neuerlich in die Richtung des Selbstmordes entwickelt. Man darf sich also durch das unmittelbar nach dem Selbstmordversuch geänderte äußere Verhalten nicht täuschen lassen: Die Persönlichkeitsstruktur ist die gleiche geblieben und sie kann nur durch intensive therapeutische Maßnahmen geändert werden. Bedenkt man also die große Wichtigkeit der Diagnostik und der Therapie auf dem Gebiete des Selbstmordes, so muß man sagen, daß der Psychiater hier eine Aufgabe zu erfüllen hat, die seine ernste ärztliche Pflicht ist, und in der ihn niemand ausreichend vertreten kann. — Eine weitere Frage, vor die der Sauerbruch-Film stellt, ist die folgende:
3. Aber die geretteten Selbstmörder brauchen doch oft auch eine körperliche Behandlung. Kann diese auf der Psychiatrie durchgeführt werden? Dazu ist folgendes zu sagen: Sofern es sich um die Bekämpfung der akuten Vergiftungserscheinungen (etwa Schlafmittel, Leuchtgas usw.) handelt, ist heute die Klinik in den modernsten Methoden bewandert und mit allen notwendigen Geräten ausgerüstet. Die Erfolge sind auch dementsprechend gute. Es versteht sich von selbst, daß man, wenn nötig, den Internisten oder den Chirurgen zuzieht und der von dieser Seite notwendigen Behandlung keine wie immer gearteten Hindernisse in den Weg legen wird. Der im Sauerbruch-Film konstruierte Kompetenzstreit scheint heute doch überholt. Die universalistische Betrachtungsweise hat in der Medizin große Fortschritte gemacht, man gibt heute dem Körper, was des Körpers und der Seele, was der Seele ist. Freilich tut es not, immer wieder zu betonen, daß der Selbstmord auch ein seelisches Problem ist, daß nicht nur ein gebrochenes Bein, sondern auch eine gebrochene Seele der Behandlung bedarf.
Schließlich darf auf folgendes hingewiesen werden: Sauerbruch kommt im Film nicht darum herum, Nachforschungen und Bemühungen bei der nächsten Umgebung der Patientin anzustellen. Damit wird dargestellt, daß der Selbstmord — ein besonders komplexes Problem — eben auch eine soziale Seite hat. Die Erforschung, und wenn möglich, Verbesserung des Milieus, also die nachgehende Fürsorge — man könnte von materieller und seelischer Sanierung sprechen — ist heute eine unabdingbare Forderung der Selbstmordprophylaxe. Auch hier nun sind in Wien besonders glückliche Verhältnisse gegeben: Der Psychiatrischen Klinik steht in der Lebensmüdenfürsorge der Caritas eine Organisation zur Verfügung (übrigens die einzige ihrer Art in Europa), die die Nachbetreuung in sachlicher und umfassender Weise durchführt. Sachlich deswegen, weil keine weltanschaulichen Unterschiede gemacht weiden, umfassend, weil hier Psychiater, Psychologen, Fürsorger und Seelsorger (auf die eminente Bedeutung echter Religiosität für die Selbstmordverhütung kann hier aus Platzmangel ebensowenig eingegangen werden wie auf das pastoralmedizinische Problem, vor das der Selbstmord stellt), zusammenarbeiten und jeder auf seinem Sektor den entsprechenden Beitrag zur Beseitigung der Gefahr leistet. Es versteht sich von selbst, daß die Klinik die Gelegenheit, mit einer solchen Organisation zusammenzuarbeiten, gerne wahrnimmt und sie ist sich im klaren darüber, daß nicht zuletzt durch diese Kooperation die erzielten Erfolge in der Bekämpfung des Selbstmordrezidivs so gute sind.
Jüngst schrieb eine Wochenzeitung sinngemäß: Wie lange noch werden die Selbstmörder auf die Psychiatrie kommen? Denken diejenigen, die so schreiben, auch an jene, gar nicht so seltenen Fälle, wo eine Einweisung oder Untersuchung nach dem Selbstmordversuch unterblieb und denen dadurch Gelegenheit geboten wurde, den Selbstmord endlich „erfolgreich“ durchzuführen, verstehen sie, daß die geschmähte Psychiatrie nichts anderes tut, als mit all ihren Kräften eine seelische (oder geistige) Krankheit, die einen tödlichen Ausgang nehmen kann, zu heilen? Ist es nicht doch besser, auf die Psychiatrie zu kommen und schließlich neue Lebensfreude zu gewinnen, als die Psychiatrie zu vermeiden — und zu sterben? Die psychiatrische Klinik ihrerseits tut jedenfalls alles, um eventuelle unangenehme Folgen des Aufenthaltes zu vermeiden, die Umstände während der Beobachtung und Behandlung so günstig als möglich zu gestalten und die Entlassung so rasch zu veranlassen, als es vom ärztlichen Standpunkt aus verantwortbar ist.