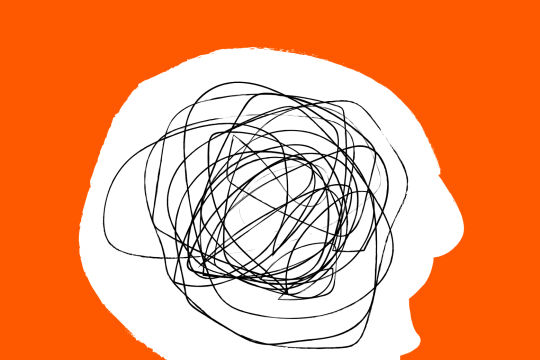Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Störfaktor Alter
Alte und Kranke werden heute abgeschoben und eingeliefert. Gleichzeitig explodieren die Kosten im Gesundheitsbudget. Mehr Familie und weniger Staat als Lösungsmodell?
Alte und Kranke werden heute abgeschoben und eingeliefert. Gleichzeitig explodieren die Kosten im Gesundheitsbudget. Mehr Familie und weniger Staat als Lösungsmodell?
Stundenlang in einem völlig überfüllten Wartezimmer sitzen, aus Langeweile in uralten Illustrierten blättern oder sich umständliche Schilderungen von irgendwelchen Krankheiten irgendwelcher Leute anhören, zwischendurch daran denken, daß man noch dringend einkaufen oder das Auto zum Service bringen oder das Kind rechtzeitig aus dem Kindergarten abholen muß— wer kennt das nicht?
Ist man dann endlich an der Reihe, dauert das Gespräch mit dem Arzt oder der Arztin höchstens einige Minuten, man bekommt ein Rezept oder eine Uberweisung zum Facharzt in die Hand gedrückt, und die medizinische „Betreuung“ ist beendet.
Bedenkt man aber, daß zwischen 50 und 70 Prozent jener Patienten, die eine Allgemeinpraxis aufsuchen, an psychosomatischen Störungen leiden und besonders häufig auftretende Erkrankungen, wie etwa des Herz-Kreislauf-Systems oder der Atemwege, nicht nur durch persönliches Risikoverhalten bedingt, sondern auch Folge gegebener Lebens- und Arbeitsbedingungen sind, dann wird klar, daß diese Art der medizinischen Versorgung - die „Fünf-Minuten-Medizin“ — die komplexen Zusammenhänge zwischen einer körperlichen Erkrankung und der sozialen und psychischen Situation eines Menschen nicht oder nur äußerst unzureichend berücksichtigt.
Das muß jedoch nicht so sein. Dem Umstand, daß die Ursache vieler organischer Erkrankungen in der seelischen und sozialen Befindlichkeit der Patienten zu finden ist, kann durch eine neue, in Österreich noch eher unübliche Form einer umfassenderen medizinischen und psychosozialen Basisversorgung — innerhalb von Praxisgemeinschaften - besser Rechnung getragen werden.
In diesen Praxisgemeinschaften arbeiten Angehörige verschiedener Berufe — Praktische Ärzte und Fachärzte, Physiko-therapeutinnen, Sozialarbeiter (-innen), mobile Krankenschwestern und Psycholog(inn)en — gleichberechtigt zusammen, die in der sonst üblichen ambulanten medizinischen Versorgung weitgehend voneinander unabhängig ihre Patienten betreuen.
In den angelsächsischen Ländern, in Skandinavien und auch in der BRD existieren Praxisgemeinschaften bereits — teilweise — seit den fünfziger Jahren, in
Österreich gibt es nunmehr drei: zwei in Wien und eine in Graz-Liebenau.
Die .jüngste“ wurde im Oktober 1987 im zehnten Wiener Gemeindebezirk gegründet und besteht aus zwei Praktischen Ärzten, einem Sozialarbeiter, einer Physikotherapeutin und einer Assistentin. Eine dritte Praktische Ärztin und eine mobile Krankenschwester arbeiten eng mit der Praxisgemeinschaft zusammen, und ab Anfang des nächsten Jahres wird ihr auch ein Facharzt für Neurologie und Psychiatrie angehören.
„Wir gehen davon aus, daß Krankheit nie eindimensional, als sozusagen rein organisches Problem, zu sehen ist, sondern daß der Lebenszusammenhang der Patienten unbedingt mitberücksichtigt werden muß.“ So formuliert einer der beiden Mediziner, dessen Name nicht genannt werden kann, da Ärzte einem sehr strengen Werbeverbot unterliegen, den Grundgedanken, auf dem die Idee der Praxisgemeinschaft basiert. Und weiter: „Wir versuchen, alle sozialen und psychischen Konflikte, die ein(e) Pa-tient(in) hat, soweit wie möglich zu berücksichtigen. Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, in der Familie, mit dem Partner oder den Kindern, finanzielle Probleme — all das spielt eine Rolle, wenn jemand krank wird.“
Hier wird der Unterschied zur anfangs erwähnten „Fünf-Minuten-Medizin“ deutlich: Der Arzt' nimmt sich Zeit für ein längeres Gespräch mit dem erkrankten Menschen und versucht herauszufinden, welche Sorgen, welche ungelösten Konflikte diesen eigentlich krank gemacht haben.
In der zweiten Wiener Praxisgemeinschaft im zwölften Gemeindebezirk arbeiten seit Herbst 1984 ebenfalls zwei Praktische Arzte gemeinsam mit einer mobilen Krankenschwester, Sozialarbeiterin, Physikotherapeutin, Kinderkrankenschwester und bald auch einer Gynäkologin.
Das „Sozialmedizinische Zentrum Graz-Liebenau“ besteht aus der eigentlichen Praxisgemeinschaft, zu der drei Praktische Ärzte mit Assistentinnen, eine Physikotherapeutin und eine medizinisch-technische Assistentin gehören, dem „Verein für praktische Sozialmedizin“, in dem ein Sozialarbeiter und zwei Psychologinnen Beratung anbieten, sowie einer Familienberatungsstelle.
Natürlich ist auch innerhalb dieser Praxisgemeinschaften die freie Arztwahl garantiert. Regelmäßige Besprechungen des gesamten Mitarbeiterteams führen zu einem permanenten Erfah-rungs- und Informationsaustausch, eine gewisse gegenseitige Kontrolle verbessert die Qualität der medizinischen Arbeit, was zweifellos dem Interesse der Patienten dient.
Nach einer Studie des österreichischen Bundesinstitutes für Gesundheitswesen im Bundeskanzleramt gibt es derzeit in ganz Österreich rund 1900 Ärzte, die in fast 800 Gruppenpraxen zusammenarbeiten. Häufig sind dies Ärzteehepaare, die ihre Praxis meist aus Kostengründen zusammengelegt haben. Dies kann jedoch nicht mit den drei beschriebenen Praxisgemeinschaften und ihrem Anspruch auf ganzheitliche medizinisch-psychosoziale Betreuung erkrankter Menschen verglichen werden.
Die Bevölkerungsentwicklung zeigt ein düsteres Szenario: Unsere Bevölkerung wird weiter schrumpfen, Kinder und Jugend-, liehe werden immer weniger, die Anzahl der über 60jährigen steigt stark und wird sich bis zum Jahre 2030 verdoppeln: Jeder dritte Österreicher wird dann über 60 Jahre alt sein.
Die Kosten für die Krankenhäuser höhlen derzeit bereits die Gesundheitsbudgets der Länder und des Bundes aus. Von den So-
Von ERWIN SCHRANZ zialausgaben wird ein Großteil für Anstalten und Heime verwendet.
Das sind einige nüchterne Zahlen und Fakten. Die Frage drängt sich auf: Wie soll es im Gesund-heits- und Sozialbereich weitergehen? Eine fortgesetzte lineare Ausgabensteigerung ist nicht mehr möglich und auch nicht zu vertreten. Eine optimale Versorgung gerade unserer alten Menschen muß aber weiterhin gewährleistet bleiben.
Wir werden in den nächsten Jahren ziemlich umdenken müssen. Die Entwicklung erfordert es, aber auch grundsätzlich kommen wir damit wieder zu neuen Formen der Begegnung von Mensch zu Mensch und einer anderen, besseren Betreuung der schwächsten Glieder unserer Gesellschaft.
Nicht mehr die Einweisung in ein Altersheim kann der Weisheit letzter Schluß sein, kommt sie doch oft einem endgültigen Abschieben gleich. („Der alte Mensch stört das Famiiierdeben.“) Oder er soll möglichst lange im Spital bleiben („Dort geht es dem Kranken am besten“): Seine Psyche würde aber viel stärker nach seinem Zuhause, den eigenen vier Wänden, der vertrauten Umgebung verlangen als nach einem klinisch noch so sauberen Spitalszimmer, das noch dazu riesige Summen verschlingt.
Allmählich wird allen klar: Der Staat kann nicht alles, weder finanziell und schon gar nicht menschlich. Der persönliche Einsatz der Familie, der Verwandtschaft, der Dorfgemeinschaft kann von der öffentlichen Hand nicht ersetzt werden.
Die kleine, überschaubare Einheit mit der Familie als Kern, die Nachbarschaft und die örtlichen Gemeinschaften müssen wieder voll aktiviert werden. Dazu gehören auch eine geänderte Einstellung, eine kräftige Portion Phantasie und mehr Mut im Sozial-und Gesundheitsbereich.
Auch der Staat weiß inzwischen um seine Grenzen: Statt nur die ständig steigenden Spitalsdefizite abzudecken, wird jetzt durch die Neuregelung des Krankenanstaltzusammenarbeitsfonds (KRAZAF) gesetzlich vorgesehen, daß beträchtliche Mittel durch den Abbau von akuten Spitalsbetten gespart werden und alle alternativen Betreuungsformen wie mobile Dienste und die Hauskrankenpflege ausgebaut werden sollen. Dafür stehen ab dem kommenden Jahr beträchtliche Bundesmittel zweckgebunden zur Verfügung.
Dies ist nur zu begrüßen. Es ist zugleich eine große Chance, daß unsere Gesellschaft menschlich wieder mehr angereichert wird, vor allem aber auch eine Aufforderung an den einzelnen Christen zum Mittun, sich um den Nächsten mehr zu kümmern. Gerade kirchliche Gemeinschaften können hier viel mehr einbringen als manche noch so teure staatliche Einrichtung. Und muß uns nicht die christliche Urgemeinde ein Vorbild sein, wo die Nächstenliebe eine Selbstverständlichkeit war und der Liebesdienst an den Alten und Kranken ein überzeugendes Zeichen des gelebten Glaubens?
Nehmen wir die Herausforderung der Zeit an: Müssen nicht auch wir die drohende Bevölkerungsentwicklung und die nüchternen Zahlen zum Anlaß für einen Neubeginn unserer sozialen Beziehungen und für mehr gelebte Menschlichkeit nehmen?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




























































































.jpg)