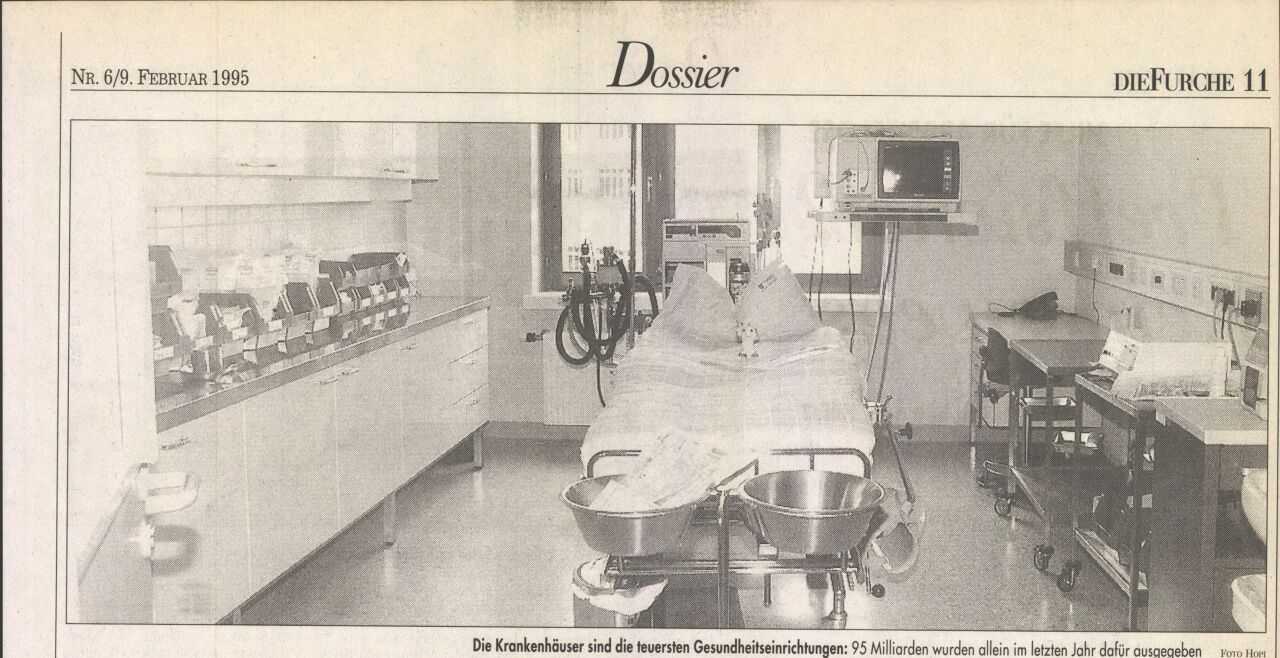
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zu viele Patienten im falschen Bett
Mehr Medikamente, mehr erforschte Krankheiten, neue Behandlungsmethoden und neue Operationstechniken schaffen eine endlose Kostenspirale.
Mehr Medikamente, mehr erforschte Krankheiten, neue Behandlungsmethoden und neue Operationstechniken schaffen eine endlose Kostenspirale.
Die Gesundheit ist den Menschen weit mehr wert als vieles andere. Daß unser Gesundheitssystem in einer akuten Krise steckt, wie die jetzige Spitalsdiskussion zeigt, muß deshalb als Alarmsignal verstanden werden.
In Osterreich gibt es etwa 5.400 Spitalsbetten zuviel, heißt es in der neuen Studie des Gesundheitsministeriums. Doch immer wieder sieht man Bilder von Krankenhäusern, in denen Betten auf dem Gang stehen, und man hört, daß Patienten auf eine Hüftoperation sogar ein bis zwei Jahre warten müssen. Wie reimt sich das zusammen?
Die Zahl der Ungereimtheiten nimmt noch zu. In der neuen Studie wird als eines von den neunzehn Spitälern, die teils aufzulassen, teils mit einzelnen Abteilungtn in andere Krankenhäuser zu übersiedeln wären, das erst vor wenigen Jahren mit einem Aufwand von über 400 Millionen Schilling erbaute Krankenhaus Stockerau angeführt, denn kaum eine Auto-Viertelstunde entfernt befindet sich das Krankenhaus Korneuburg. Die Baukosten können nicht allein die Beibehaltung eines Spitals rechtfertigen. Es kommen ja dazu noch viele Jahre lang die oft sehr hohen Betriebskosten, und weil dafür in vielen Fällen offenbar das Geld bald nicht mehr aufzubringen ist, flammte die Debatte jetzt wieder auf. Freilich sah schon die Spitalsreform von 1988 vieles vor, was auch jetzt wieder gefordert wird.
Offensichtlich gibt es neben Engpässen, von denen viele Österreicher zu berichten wissen, auch Überkapazitäten, Leerläufe, Doppelgeleisig-keiten. Dazu mag der Ehrgeiz mancher Landespolitiker und Bürgermeister beigetragen haben, sicher auch das Streben mancher Primarii, durch hochmoderne, teure Apparate und mehr Krankenzimmer zusätzliche Einkommensmöglichkeiten zu erlangen. Das Spital ist unbestritten die teuerste Gesundheitseinrichtung; Fachleute sagen: „Jedes Bett sucht seine Patienten.”
Vom Bund aus läßt sich da allerdings nichts anordnen oder mit Aussicht auf Erfolg planen, denn obwohl aus dem Bundesbudget erhebliche Mittel nicht nur in die Spitäler, sondem überhaupt ins Gesundheitswesen fließen, sind doch die öffentlichen Spitalserhalter vorwiegend die Länder und Gemeinden, wozu noch private Anstalten kommen. Gesundheitsministerin Christa Krammer mußte deshalb auch einsehen, daß eine Reform nur aufgrund von Verhandlungen mit den Ländern, den Gemeinden und der Sozialversicherung erarbeitet werden könne.
Im vorigen Jahr hatten die rund 330 österreichischen Spitäler Kosten von 95 Milliarden Schilling. Dafür müssen die Krankenkassen, die Privatpatienten (beziehungsweise ihre Versicherungen) und die Spitalserhalter aufkommen. Weil aber deren Finanzkraft sehr unterschiedlich ist, gibt es den Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds, mit der entsetzlichen Abkürzung Krazaf. Er soll nicht nur finanzielle Erfordernisse ausgleichen, sondern auch die zweckmäßige Anschaffung medizinisch-technischer Großgeräte finanzieren, und zwar aufgrund einer bundesweiten Bedarfs- und Standortplanung. Für Herz- und Krebspatienten gibt es noch eine Unterversorgung!
Der Fonds, in den neben den Spitalserhaltern auch der Bund und die Krankenkassen einzahlen, ist offiziell Ende 1994 ausgelaufen. Nun soll er bis zum heurigen Jahresende verlängert werden.
Die seit Jahren angekündigte Umstellung der Kostenrechnung in den Spitälern von den Tagessätzen (die dazu verleiten, Patienten länger als notwendig im Krankenhaus zu lassen) auf die leistungsorientierte Finanzierung ist bisher nicht über einzelne Versuche hinausgekommen. Es scheint da auch mancherlei Widerstände zu geben. Das neue Koalitionsabkommen weist jedenfalls auf das leistungsorientierte Finanzierungssystem ausdrücklich hin. Kritiker der neuen Studie betonen, man dürfe von der Auflassung oder Verlagerung von Spitalsbetten keine großen Kostenersparnisse erwarten. Auf die Finanzierungsprobleme gehe die Studie auch nicht genau ein.
Ein Landespolitiker hat schon vor Jahren glaubhaft dargelegt, daß die Wiener Gemeindespitäler ihre Wäsche bei Privatfirmen billiger waschen lassen könnten als in der kommunalen Spitalswäscherei. Vielleicht gilt ähnliches auch für die Krankenverpflegung. Den 1988 eingeführten Verpflegsbeitrag von 50 Schilling je Tag schaffte man nach kurzer Zeit wieder ab; daß die Verrechnung zu teuer komme, klingt wenig überzeugend; zumutbar ist er - von ganz krassen Sozialfällen abgesehen -zweifellos. Auch ob die Pförtner und Nachtwachen in den Spitälern unbedingt Gemeindebedienstete sein müssen, sei dahingestellt.
Es muß aber auch mit der üblen Praxis Schluß gemacht werden, daß Privatpatienten das Defizit der allgemeinen Gebührenklasse mitfinanzieren müssen, indem man ihnen Leistungen anrechnet, für die ihre Krankenkasse aufzukommen hätte. Der Privatpatient soll nur jene Mehrkosten bezahlen müssen, die er tatsächlich verursacht: für den höheren Komfort, für Sonderleistungen, für Sonderhohorare der behandelnden Ärzte. Schon jetzt können sich vieje Mitbürger die private Krankenversicherung nicht leisten. Die Bereitschaft zur Eigenvorsorge muß aber angeregt werden, auch im Interesse der Spitäler.
Die Fortschritte in der Medizin machten es möglich, daß heute Patienten von Krankheiten geheilt werden können, gegen die man noch vor einigen Jahrzehnten ziemlich machtlos war. Auch werden die Menschen älter als früher. Umso mehr muß die Spitalsbehandlung auf die darauf wirklich angewiesenen Fälle beschränkt werden.
Die Krankenhäuser sind ja nur einer von mehreren Zweigen des Gesundheitswesens. Sollen Spitalsbetten eingespart werden, dann müssen andere Bereiche des ganzen Systems jene Patienten aufnehmen, die derzeit in diesen Betten liegen, woanders aber ebenso gut medizinisch versorgt werden könnten. Etwa alte Menschen, die man auch in Altenoder Pflegeheimen betreuen kann -wenn dort Platz für sie ist. Oder Patienten, die nach Operationen ebenso gut (oder noch besser) in Behabi-litationszentren wieder voll gehfähig gemacht, vielleicht auch in Haus-krankenpflege entlassen werden können.
Dies alles würde bewirken, daß die modernen, besonders teuren medizinischen Apparate besser für die echten Spitalsfälle ausgenützt werden könnten. In einigen Bundesländern haben sich Sozialsprengel zur Betreuung oder Pflege bedürftiger Menschen, die anderswo kurzerhand ins Krankenhaus geschickt werden, bewährt.
Und noch eines betonen die Fachleute: Die niedergelassenen Ärzte sollten in Zukunft wieder eine größere Rolle spielen. Auch durch Gemeinschaftspraxen, in denen Fachärzte verschiedener Richtung zusammenarbeiten, ließe sich manche heute übliche Überweisung ins Spital vermeiden. Weil die praktischen Ärzte die Honorierung ihrer Nachtdienste als untragbar empfinden, werden nachts erkrankte Patienten kurzerhand ins nächste Spital gebracht. Die Ärzte sind unentbehrlich für die Präventivmedizin; wenn diese mehr angewendet wird, können die Spitäler beträchtlich entlastet werden.
Über die unerläßliche Sanierung der Spitalsfinanzen hinaus ist also eine grundlegende Strukturerneuerung im Gesundheitswesen erforderlich. Da einige ihrer Ziele nur mittel-und sogar langfristig zu erreichen sein werden, sind wohl finanzielle und organisatorische Sofortmaßnahmen als Ergänzung nötig. Der politische Wille aller in das Gesundheitssystem einbezogenen Behörden und Organisationen - auch der in die Ausarbeitung der Studie nicht einbezogenen Ärzte und Pflegerinnen! -müßte auf einem Spitalsgipfel bekundet werden, in dessen Auftrag dann unverzüglich, und vor allem für alle verbindlich, konkrete Maßnahmen einzuleiten wären. Konzepte dafür gibt es seit langem; sie wären aufeinander abzustimmen und zu aktualisieren.
Durch die Spitalskrise ist jetzt wieder offenkundig geworden, wie notwendig die Beform ist, auch wenn sie mit dem Verzicht auf liebgewordene Gepflogenheiten, mit Eigenleistungen der Kranken und ihrer Familien, nicht zuletzt gegen den Widerstand von Interessensgruppen und politischen Funktionären durchgesetzt werden muß. Andernfalls wäre der Sozialstaat im Gesundheitsbereich überhaupt in Frage gestellt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!


























































































