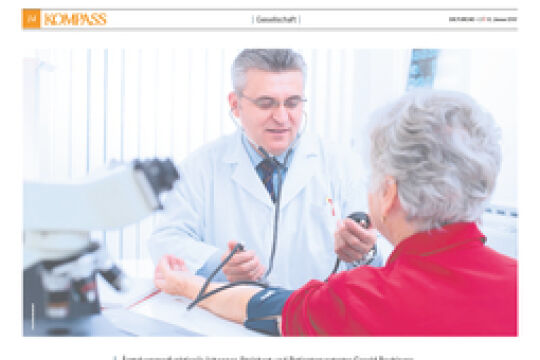Herr und Frau Österreicher gehen zu oft und zu schnell ins Spital. Gesundheitsökonom Christian Köck ortet in einem Übermaß an Betten das Problem.
Christian Köck ist zufrieden - weitgehend. Seit Jahren plädiert der Gesundheitsökonom und Professor an der Universität Witten/Herdecke für eine Finanzierung aller Gesundheitsleistungen "aus einem Topf"; seit Jahren fordert er eine Reduktion von Spitalsbetten; und genauso lange wendet er sich gegen eine Anhebung der Krankenkassenbeiträge - "denn wenn man Reformen will, dann braucht man Reformdruck - und am besten funktioniert das über mangelndes Geld". Die Politik hat sich in letzterem Punkt freilich anders entschieden. Christian Köck trägt's mit Fassung: "Jetzt haben die Krankenkassen eben einen gewissen Spielraum, was auch gut ist, denn dann gibt es nicht die ständige Diskussion über die Insolvenz einzelner Kassen." Die entscheidende Frage für Köck: "Wie groß ist der politische Reformwille?"
Run ins Krankenhaus
Der mit Abstand größte Reformbedarf besteht nach Meinung des Gesundheitsökonomen im Krankenhausbereich. Die Statistik über die Spitalsaufnahmen spricht eine deutliche Sprache: Während hierzulande 31,2 Personen pro 100 Einwohner den Weg ins Krankenhaus beschreiten, sind es im EU-Durchschnitt gerade 19,4 Personen. Länder wie die Niederlande hätten laut Köck sogar unter zehn Spitalsaufnahmen. "Wenn man unsere Krankenhaushäufigkeit um 20 Prozent reduzieren würde, wären wir noch immer EU-Spitze", ärgert sich der Gesundheitsökonom im Furche-Gespräch.
Kein Wunder, dass er sich über das Vorhaben der Regierung freut, die Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung (LKF) zu Gunsten tagesklinischer Leistungen zu korrigieren: "Das ist eine ausgesprochen notwendige und richtige Sache. Die Zahl tagesklinischer Leistungen liegt in Österreich ja weit unter dem europäischen Durchschnitt."
Die häufigen stationären Krankenhausaufnahmen sind für ihn hingegen eine unmittelbare Folge des Zuviels an Krankenhausbetten. "Wir haben mittelfristig sicher ein Drittel Akutbetten zu viel. Einen Teil davon müsste man in Remobilisations- und Pflegebetten umwidmen, aber sicher nicht alle." Tatsächlich kommen in Österreich auf 100.000 Einwohner 694,4 Akutbetten, im EU-Schnitt sind es 424,6. Anders das Bild im Pflegebereich: Hier rangiert Österreich am unteren Ende der Skala.
Ganze Spitäler zu schließen, wäre zwar für Köck ökonomisch durchaus sinnvoll - aber politisch kaum umsetzbar, ist er sich bewusst. Schließlich würden die Krankenhausträger ihr Spital auch als wesentlichen Arbeitsplatzfaktor begreifen. "Ich könnte mir aber vorstellen, dass man in einer Versorgungsregion alle Betten aller Krankenhäuser zusammenrechnet: Dann könnte man Synergieeffekte nutzen, die dann zu einer Nettoreduktion führen - und gleichzeitig zu einer besseren Versorgung der Patienten."
Auch einer Privatisierung öffentlicher Spitäler kann der Gesundheitsökonom einiges abgewinnen - vorausgesetzt, dass die öffentliche Hand die strikte Einhaltung des Versorgungsauftrages und die Qualität der erbrachten Leistungen kontrolliert und falls notwendig mit Pönaleforderungen gegenüber dem Privaten auftritt. Damit könne verhindert werden, dass kranke Menschen durchs Netz fallen.
Im Unterschied zu Michael Heinisch von der Vinzenz Gruppe (siehe unten) pocht Köck jedoch nicht darauf, dass private Eigentümer auch dem Prinzip der Gemeinnützigkeit unterworfen sein müssten: "Viele sagen: Mit Gesundheit darf man kein Geld verdienen. Aber warum erlaubt man dann den Ärzten in einer niedergelassenen Praxis, gewinnorientiert zu arbeiten und als Unternehmer aufzutreten?"
Dass sich im Spitalsbereich - ohne Qualitätsverlust - jede Menge Geld einsparen ließe, hatte Köck schon vor drei Jahren vorgerechnet: Im stationären, akuten Spitalsbereich gäbe es ein Einsparpotenzial von rund zwei Milliarden Euro pro Jahr. Prompt erntete Köck dafür Kritik. Dass seine Kritiker - etwa Hauptverbands-Geschäftsführer Josef Kandlhofer - nun gemeinsam mit dem IHS sogar ein Einsparpotenzial von 2,9 Milliarden Euro orten, sorgt bei ihm für Genugtuung: "Ich glaube, dass eine solche Einsparung realistisch ist - ohne dass es Einbußen in der Qualität gäbe. In bestimmten Bereichen würde ich sogar an eine Verbesserung glauben." So seien die Krankenhausträger zum Zweck der Bettenauslastung angehalten, auch Patienten im Spital aufzunehmen, die sehr gut oder besser anders behandelt werden könnten. "Wir haben eben einen Druck zur Spitalsaufnahme", so Köck.
Kürzer, aber öfter
Dieser Druck wurde durch das - im Jahr 1997 eingeführte - LKF-System noch weiter verstärkt, mit dem statt Spitalstagen einzelne medizinische Leistungen bezahlt werden. Tatsächlich sank dadurch die durchschnittliche Belagsdauer pro Spitalsaufenthalt. Gleichzeitig stieg die Zahl der Spitalsaufnahmen - und der Gesamtkosten, weiß Köck: "Das LKF-System funktioniert eben nur, wenn man klare Kriterien für die Aufnahme festlegt oder die Betten reduziert. Aber die Bettenzahl gleichzulassen und keine klaren Guidelines für die Aufnahme festzulegen, das muss dazu führen, dass das Spital teurer wird."
Es gebe eben einen ökonomischen Grundsatz, der in jedem Fall zutreffe, so Köck: "Man bekommt immer das, wofür man zahlt. Früher haben wir Krankenhaustage bezahlt - und viele Krankenhaustage bekommen. Jetzt zahlen wir für Leistungen, also de facto für Spitalsaufnahmen - und wir bekommen viele Aufnahmen. Das ist wie das Amen im Gebet." DH
Wer zahlt?
Wer was im Spital finanziert, ist nicht leicht zu erfassen: Derzeit fließen rund acht Milliarden Euro - knapp die Hälfte der heimischen Gesundheitsausgaben - in die 145 Fondskrankenanstalten. Diese Spitäler werden von den Landesfonds finanziert, die wiederum von folgenden Quellen gespeist werden: 42 Prozent Sozialversicherung, 50 Prozent Länder, sieben Prozent Bund und ein Prozent Gemeinden. Koordiniert wurden die Gelder bisher von den Landesstrukturkommissionen der Landesfonds, die nun zu Gesundheitsplattformen ausgeweitet werden und auch den niedergelassenen Bereich planen und koordinieren sollen. Insgesamt gibt es hierzulande 310 Spitäler (inklusive Unfall- und Privatkrankenhäuser).
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!