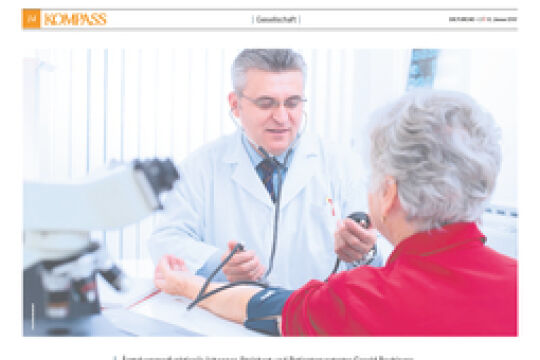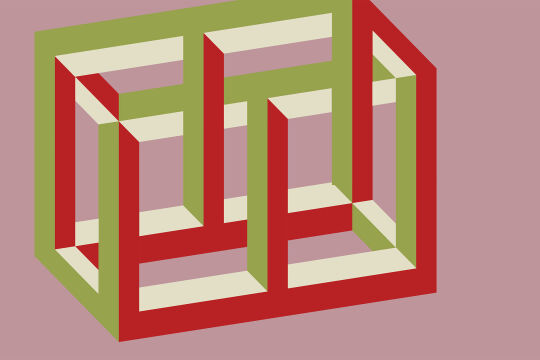Der Gesundheitsökonom Christian Köck über den Mangel an Effizienz im heimischen Gesundheitswesen, das Chaos um die Ambulanzgebühr, die fehlende Qualitätskontrolle der Ärzte und den Einfluss der Lobbys.
Die Furche: Das Gesundheitssystem ist zum Wahlkampfthema geworden. Letzte Woche hat Staatssekretär Reinhart Waneck einen "Nationalen Gesundheitsplan" präsentiert, der die Zusammenlegung der neun Gebietskrankenkassen vorsieht. Außerdem hat er vorgeschlagen, dass Bewohner von Ballungsräumen höhere Kassenbeiträge zahlen sollten. Auch wenn er den zweiten Vorschlag inzwischen relativiert hat: Was halten Sie von diesen Ideen?
Christian Köck: Den Vorschlag mit höheren Beiträgen für Städter halte ich nicht für zielführend. Wenn man davon ausgeht, dass Menschen in Ballungsräumen nicht kränker sind als anderswo, dann haben die Unterschiede in der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen nichts mit dem Gesundheitszustand der Menschen zu tun, sondern mit dem Phänomen angebotsinduzierter Nachfrage. Oft werden ja Leistungen in Anspruch genommen, die keinen Nutzen für den Patienten bringen. Dann sollte man aber nicht die Beiträge erhöhen, sondern versuchen, die unnötigen Leistungen zu reduzieren. Bezüglich der Gebietskrankenkassen ist es schon eine Überlegung wert, ob man neun braucht. Das Argument, man könne dadurch Kosten einsparen, ist aber ein Unsinn. Der Verwaltungsanteil ist in der Sozialversicherung ziemlich schmal. Hier ist relativ wenig Geld drinnen im Vergleich zu dem, was bei den überflüssigen Leistungen zu holen ist.
Die Furche: Sie sprechen von Schnittstellenverlusten in der Höhe von zehn Prozent. Wir sind aber auch konfrontiert mit einer immer älter werdenden Gesellschaft und teuren medizinischen Innovationen. Lässt sich die Effizienz derart steigern, dass wir ohne höhere Kassenbeiträge auskommen?
Köck: Das Gesundheitswesen ist wie ein fettes Schwein, bei dem man vor lauter Speck die Stummelbeine nicht mehr sieht. Wir können lange heruntersäbeln, bevor sich wirklich an der Qualität für den Patienten etwas ändern. Allerdings sind relativ bald die Interessen mächtiger Lobbys betroffen. Es schreien ja nicht die Patienten, sondern die Lobbys unter Benutzung der Patienten. Wenn wir zu einer wirklichen Umverteilung der Mittel kämen, dann müssten wir die Beiträge noch lange nicht erhöhen. Irgendwann wird dann aber unsere Gesellschaft die gesundheitspolitisch einzig spannende Frage beantworten müssen, nämlich: Was ist uns die Gesundheit wert?
Die Furche: Als erstes Beispiel der Umverteilung wurde die Ambulanzgebühr eingeführt, was zu einem Verwaltungschaos geführt hat. Sie haben stets für diese Gebühr plädiert. Glauben sie noch immer an ihre Sinnhaftigkeit?
Köck: Das Problem ist, dass man eine absolut notwendige Methode der Finanzierung von Gesundheitsleistungen, nämlich die durch Selbstbehalte, so schlecht eingeführt hat, dass die Sache an sich diskreditiert wurde. Doch die politische Diskussion dazu ist pharisäerhaft: All jene, die jetzt die Ambulanzgebühr abschaffen wollen, müssten wissen, dass ihr Effekt nicht so gemessen werden kann, dass man die Verwaltungskosten gegen die Einnahmen aufrechnet. Das ist aus ökonomischer Sicht völlig uninteressant. Interessant an einer Selbstbeteiligung ist, dass sie dazu führt, dass die unnötige Nachfrage reduziert wird.
Die Furche: Sie haben statt der Ambulanzgebühr einen generellen Selbstbehalt von 1.000 Euro pro Jahr gefordert - ausgenommen chronisch Kranke und Bezieher von Mindesteinkommen. Würde das nicht dazu führen, dass manche keine medizinische Leistung in Anspruch nehmen, obwohl sie sie bräuchten?
Köck: Die wirklich guten empirischen Befunde sagen, dass man, wenn man diese beiden Gruppen ausnimmt, eine Selbstbeteiligung ohne negative Effekte einführen kann. Bei der "Rand Health Insurance Study" wurden 6.000 zufällig ausgewählte Patienten aus verschiedensten Versicherungsschemata, die sich nur in der Höhe des Selbstbehaltes unterschieden haben, sechs Jahre lang beobachtet, wie sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Und die einzigen, wo es einen negativen Effekt gegeben hat, waren chronisch Kranke und Bezieher von Mindesteinkommen.
Die Furche: Ihr Ziel - und auch Zweck der Ambulanzgebühr - ist es, die Patientenströme vom Spital in die Praxen zu lenken. Müsste nicht zuerst dort das Angebot verbessert werden, damit sich die Patienten lenken lassen?
Köck: Wichtig ist, dass man überhaupt einmal beginnt. Wir könnten auch damit anfangen, dass die Ärzte einen Wochenenddienst machen müssen und dass es Gruppenpraxen und Ärztezentren gibt. Aber das wird nur funktionieren, wenn es eine Finanzierung aus einem Topf gibt. Im Moment ist die Finanzierung so konstruiert, dass ein niedergelassener Arzt viel davon hat, möglichst viele Patienten zu sehen und sie schnell zu einem Spezialisten zu schicken. Der schickt sie dann wieder zurück und dann ins Krankenhaus. Daran haben die Leute natürlich kein Interesse und gehen deshalb gleich ins Spital. Dort erreichen sie an einem Vormittag das, wofür sie sonst eine Woche brauchen.
Die Furche: Demgegenüber wollen Sie - und nun auch die ÖVP - den Hausarzt zum "Gesundheitsmanager" des Patienten machen. Was müsste sich ändern, damit die Hausärzte diese Aufgabe tatsächlich erfüllen können?
Köck: Sie müssten dafür natürlich anders und besser honoriert werden und sollten zusammen mit Spezialisten in Ärztezentren zusammengefasst sein. Erst wenn es unbedingt notwendig ist, sollte man die Patienten ins Krankenhaus schicken. Derzeit gibt es aber überhaupt keinen Anreiz für Ärzte, sich länger mit einem Patienten zu beschäftigen. Man bekommt für einen Krankenschein einen bestimmten Betrag und muss so und so viele Scheine abrechnen, um einen bestimmten Umsatz zu machen. Dann bleiben einem acht Minuten pro Patient. Da kann man keine umfassende Diagnostik machen. Ein wichtiger Schritt wäre ein einheitlicher Gesundheitsfonds wie in Vorarlberg, aus dem sowohl der stationäre als auch der niedergelassene Bereich finanziert wird. Erst dann macht es einen Sinn, Leute aus dem Krankenhaus in die niedergelassene Praxis zu schicken. Und das ist dringend notwendig. In den Niederlanden gehen zehn Prozent der Bevölkerung einmal pro Jahr ins Krankenhaus, in Österreich sind es 24 Prozent. Wir haben eine der höchsten Bettendichten in Europa, ungefähr drei Mal so hoch wie in den Niederlanden. Momentan profitieren aber die Kassen davon, wenn möglichst viele Patienten ins Spital gehen, denn im niedergelassenen Bereich zahlen sie voll, aber im Krankenhausbereich zahlen sie immer nur den selben Anteil in die Ländertöpfe ein.
Die Furche: Tatsache ist, dass die Krankenhauskosten drastisch steigen. Wo liegt das Problem?
Köck: Es gibt drei wesentliche Probleme: Erstens würde man ein Krankenhaus nie im Leben so organisieren, wie es derzeit geschieht. Das ist eine Maschinenbürokratie, bei der an der Spitze alle Kompetenz versammelt ist und nach unten weiter delegiert wird. Eigentlich müsste aber die Kompetenz an der Peripherie liegen und sich an den Prozessen der Patientenbetreuung orientieren. Das zweite Problem ist, dass das öffentliche Eigentum von Spitälern immer schwieriger zu verwalten ist. Wenn große Investitionen nötig sind, um technisch auf dem letzten Stand zu sein, können die öffentlichen Krankenhäuser nicht wie die Privaten auf den Kapitalmarkt gehen und einen Kredit aufnehmen. In Zeiten beschränkter öffentlicher Budgets ist das ein großer Nachteil. Und drittens kann ein öffentlicher Träger mit seiner Verbindung von lokaler Politik und Ärzten nie das tun, was ein Privater kann - nämlich sich die überflüssigen Leistungen anschauen und Druck auf die Ärzte ausüben. Und so gibt es etwa bei privaten Krankenhäusern in Deutschland einen Kosten- und Effizienzvorteil von bis zu 25 Prozent.
Die Furche: Sie haben einen Krankenanstaltenplan für Kärnten entwickelt. Kritiker haben Ihnen "Willkür" und "Kaputtsparen" vorgeworfen.
Köck: Kärnten hat in Österreich die höchste Krankenhausaufnahmerate. Wir haben in einer aufwändigen Analyse eruiert, wie hoch der Bettenbedarf wirklich ist. Immerhin wurde politisch eine Reduktion um 14 Prozent durchgesetzt. Wenn es in anderen Ländern möglich ist, eine gute Behandlungsqualität mit viel weniger Krankenhausaufenthalten zu erreichen, muss es möglich sein, sogar eine Verbesserung herzustellen. Eines wird ja immer vergessen: Wenn in einem Spital alle alles machen, dann machen alle alles selten. Und das ist das Gefährlichste. Man will ja nicht von jemandem behandelt werden, der eine Untersuchung fünf Mal jährlich macht, sondern von jemandem, der sie 50 Mal vornimmt. Das ist ein wesentlicher Qualitätsfortschritt. Abgesehen von den Kosten. Dass die Betroffenen von Willkür sprechen, ist klar. Aber das ist eben Politik.
Die Furche: Politik in Österreich führt auch dazu, dass wir noch immer auf die Einführung der E-Card warten.
Köck: Das ist ein Zeichen für das Grundproblem in der österreichischen Gesundheitspolitik, nämlich die Schwäche des politischen Teils: Wir haben ein System, in dem ausschließlich Interessenspolitik betrieben wird. Es gibt keine Gesundheitspolitik in dem Sinn, dass irgend jemand die res publica ernst nimmt. Natürlich gehört die E-Card so schnell wie möglich eingeführt, denn sie liefert die nötigen Daten, damit das System gesteuert werden kann. Derzeit wissen wir nicht, was bei den niedergelassenen Ärzten gemacht wird. Welcher Patient mit welcher Diagnose wie behandelt wird und wie das optimiert werden kann, kann ich aber nur wissen, wenn ich die Daten zusammenführe. Die Republik ist gefordert, das endlich durchzusetzen und einen glaubwürdigen Datenschutz zu ermöglichen.
Die Furche: In den Debatten um die Reform des Gesundheitssystems taucht oft die Frage auf, wie viel Marktwirtschaft es verträgt. Wofür plädieren Sie?
Köck: Es muss eine staatliche Garantie für die Finanzierung geben. Man kann darüber streiten, ob man eine Versicherungspflicht oder eine Pflichtversicherung haben will. Wesentlicher ist, dass der Staat garantiert, dass jeder Zutritt zur Gesundheitsversorgung hat - unabhängig vom Einkommen. Zweitens muss die öffentliche Hand dafür sorgen, dass es eine flächendeckende Versorgung gibt. Drittens müsste der Staat wesentlich stärker als bisher auf die Qualität achten. Derzeit haben wir ein öffentlich finanziertes Gesundheitswesen und keine Ahnung, wie gut die Krankenhäuser sind. Wir können über jeden Autoreifen etwas erfahren, aber nicht über einen Arzt oder ein Spital. Hier wurde mit der Ärztekammer ein Tatbestand geschaffen, der sich wunderschön Selbstverwaltung nennt. Dadurch bleibt aber die Qualitätskontrolle der Ärzte bei der Kammer. Das gehört ihr weggenommen. Man überlässt ja auch den Fleischhauern nicht die Kontrolle der Wurst, sondern der Lebensmittelbehörde. Tatsache ist, dass drei bis fünf Prozent der Patienten im Spital einen medizinischen Behandlungsfehler erleiden. Das ist unser größtes Qualitätsproblem. Aber wenn man das mit der Ärztekammer besprechen will, heißt es immer: Das gibt's bei uns nicht.
Die Furche: Wie gefallen Sie sich eigentlich als Mediziner in der Rolle des natürlichen Feindes der Ärztekammer?
Köck: Ich finde es einerseits schade, wenn kein Diskurs zu Stande kommt. Aber andererseits denke ich auch daran, was mein amerikanischer Doktorvater gesagt hat: "A man ist known by his enemies."
Das Gespräch führte Doris Helmberger.




















































































.png)