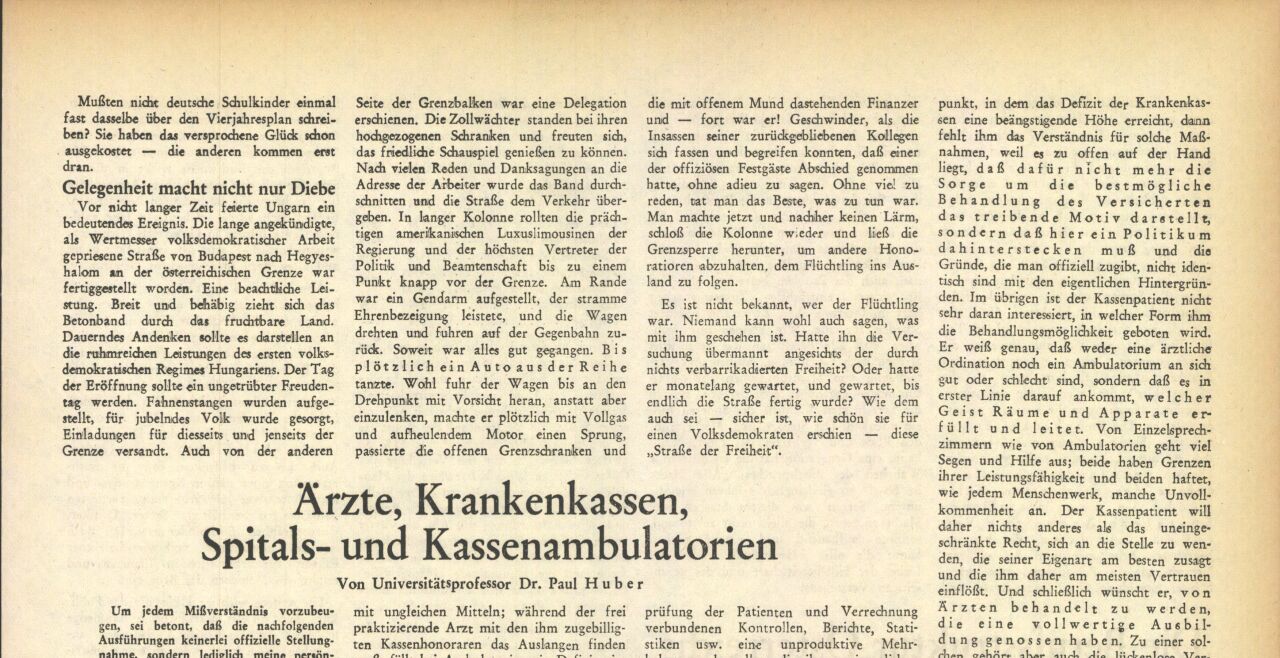
Um jedem Mißverständnis vorzubeugen, sei betont, daß die nachfolgenden Ausführungen keinerlei offizielle Stellungnahme, sondern lediglich meine persönliche Auffassung darstellen.
Als im Sommer dieses Jahres nach langem, erbittertem, aber doch nach den Regeln der Demokratie geführtem Ringen der Gesamtvertrag zwischen der Wiener Ärztekammer und den großen Krankenkassen zustande kam, da konnte man hoffen, daß damit eine Epoche unerfreulicher Zwistigkeiten abgeschlossen und der Weg für eine gedeihliche Zusammenarbeit freigemacht sei. Ein Vortrag, der kürzlich über alle österreichischen Rundfunksender übertragen wurde, beweist aber, daß diese Hoffnung nicht restlos erfüllt ist und daß die Gegensätze zwischen Ärzten und Krankenkassen damit nicht aus der Welt geschafft wurden. Es ist daher wohl besser, wenn einmal in aller Offenheit darüber gesprochen wird, um welche Probleme es dabei geht. Besser jedenfalls, als wenn die Bevölkerung aus einzelnen Schlagwortzeilen oder unvollständigen Wiedergaben willkürlich herausgegriffener und sensationell aufgemachter Einzelheiten nur halb informiert wird. Da der überwiegende Teil der österreichischen Bevölkerung krankenversichert ist und die meisten im Falle einer ernsten Erkrankung auf das angewiesen sind, was ihnen die Krankenkasse zu bieten vermag, ist auch die ganze Bevölkerung an einer rückhaltlosen Besprechung interessiert. Denn das eine ist klar: arbeiten Ärzte und Krankenkassen nicht befriedigend miteinander, sondern gegeneinander, so ist der eigentliche Leidtragende stets der Patient.
In den Verhandlungen zwischen Ärzten und Krankenkassen spielte die Frage der freien Ärztewahl und, mit ihr eng zusammenhängend, die der Kassenambulatorien eine hervorragende Rolle. Das Recht des Patienten, den Arzt seines Vertrauens unter den Vertragsärzten der Kasse frei zu wählen, wurde von der Ärzteschaft als unabdingbare Forderung aufgestellt und auch von der Kasse anerkannt. Die tatsächliche Durchführung dieses Prinzips stößt bei den praktischen Ärzten auf keine nennenswerten Schwierigkeiten, weil der praktische Arzt, der in der Nähe erreichbar ist, die Familien kennt und in allen Nöten zuerst befragt wird, durch keine anderen Institutionen ersetzt werden kann. Nicht so reibungslos spielt sich hingegen die Durchführung bei den Fachärzten ab. Hier besteht die Möglichkeit, daß sich der Kranke entweder an einen frei praktizierenden Facharzt oder an das Fachambulatorium eines öffentlichen Krankenhauses oder schließlich an ein Kassenambulatorium wendet. Die Krankenkassen haben eine Reihe neuer Ambulatorien, zum Teil mit sehr erheblichen Kosten errichtet. Sie machen kein Hehl daraus, daß sie als Ideal der fachärztlichen Behandlung die in den kasseneigenen Ambulatorien betrachten und anstreben; doch haben sie ausdrücklich zugesagt, daß sie in dieser Hinsicht keinen Druck auf die Versicherten ausüben würden. Daß die in der freien Praxis tätigen Vertragsärzte es mit immer geringerer Freude sehen, wenn täglich Tausende krankenversicherte Patienten in Ambulatorien behandelt werden, ist begreiflich und darf keineswegs als Ausdruck materialistischer oder geldgieriger Einstellung angesehen werden; denn es handelt sich hier um einen Konkurrenzkampf mit ungleichen Mitteln; während der frei praktizierende Arzt mit den ihm zugebilligten Kassenhonoraren das Auslangen finden muß, fällt bei Ambulatorien ein Defizit niemals so schwer ins Gewicht, weil sie stets in irgendeiner Form subventioniert sind. Daher ist der Wunsch der in der freien Praxis tätigen Ärzte berechtigt, daß die Ambulatorien zunächst für solche Fälle reserviert bleiben sollen, die mit den Einrichtungen einer Ordination nicht behandelt oder diagnostisch geklärt werden können. Die Ambulatorien sollten demnach die Sprechstunde des Arztes nicht ersetzen, sondern ergänzen. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die meisten Ambulatorien, seien es nun Spitals- oder Kassenambulatorien, über diesen ursprünglichen Zweck hinausgehend, zahlreiche Kranke behandeln, die ebensogut in Sprechstunden behandelt werden und damit einer Reihe von Ärzten eine Existenzmöglichkeit bieten könnten. Daher haben die in der freien Praxis stehenden Ärzte seit Jahren stets gegen die zunehmende Frequentierung der Ambulatorien Stellung genommmen, wobei in früheren Jahren in erster Linie an die Spitalsambulatorien gedacht wurde. Diese wiederholten Mahnungen brachten den Ambulatoriumsärzten immer wieder in Erinnerung, daß man begüterte Patienten, die offensichtlich mißbräuchlich eine Ambulanz für Unbemittelte aufsuchten, abweisen und Dauerbehandlungen nicht ins Uferlose in den Spitalsambulatorien fortsetzen, sondern zur rechten Zeit dem Hausarzt wieder übertragen solle. Sie waren daher in dieser Form vollkommen berechtigt. Bedenklich wurden sie aber dann, wenn manche Gruppen von Ärzten das von ihnen selbst verfochtene Prinzip der freien Ärztewahl verleugneten und die Abweisung aller krankenversicherten Patienten, soweit es sich nicht um dringende Fälle handelte, verlangten. Solche radikale Forderungen konnten sich bis in die allerletzte Zeit nicht durchsetzen, vor allem, weil sich die Patienten eben nicht abweisen ließen. Daß solche überspitzte Forderungen erhoben wurden, ist bei dem großen Überangebot an ärztlichem Nachwuchs verständlich und ließ sich wohl nicht vermeiden. Es hat sich aber sehr zum Nachteil def frei praktizierenden Ärzte geltend gemacht. Als nämlich die Kassenambu- latorien nicht die von den Krankenkassen erhoffte Frequenz aufwiesen, setzten diese bei der Gemeinde Wien durch, daß in den städtischen Spitälern eine zwangsweise erhebliche Einschränkung der Ambu- latoriumsfrequemz verfügt wurde. Krankenkassen und Gemeinde konnten sich dabei darauf berufen, daß damit nur einer alten und wiederholt erhobenen Forderung der frei praktizierenden Ärzte entsprochen wurde. Den Vorteil dieser mit allen Mitteln der modernen Bürokratie erzwungenen Einschränkung haben aber jetzt nicht die praktizierenden Ärzte, sondern die Kassenambulatorien.
Damit ist eine Situation entstanden, die wohl keinen der Beteiligten befriedigt; die praktizierenden Ärzte nicht, weil sich der Kampf gegen die Spitalsambulatorien letzten Endes gegen sie selbst gewendet hat. Die an den Spitälern tätigen Ärzte nicht, weil die behördlich verfügte Einschränkung des Ambulatoriumsbetriebes ihnen einen unentbehrlichen Teil ihrer Ausbildungsmöglichkeiten nimmt; das übrige Ambulanzpersonal nicht, weil einerseits die mit der Überprüfung der Patienten und Verrechnung verbundenen Kontrollen, Berichte, Statistiken usw. eine unproduktive Mehrbelastung darstellen, die ihrem eigentlichen Aufgabenbereich ferne liegt, vor allem aber, weil jeder, der sich aus freiem Herzen dem Krankendienst widmet, nur mit innerstem Widerstreben hilfeheischende Menschen wegschickt, anstatt sich ihrer anzunehmen. Am wenigsten befriedigt sind natürlich die Patienten selbst, weil sie sich plötzlich des von ihnen so freudig begrüßten Rechtes auf die freie Wahl der Behandlungsstelle weitgehend wieder beraubt sehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß die Krankenkassen selbst sich restlos über eine Regelung freuen, bei der sie so viel inneren Widerstand fühlen müssen.
Der Versuch, die Patienten von der freigewählten Behandlungsstelle ihres Vertrauens abzuhalten, muß aber, wie jeder Versuch einer Zwangsbewirtschaftung, zu einer Art „Schwarzhandel” führen. Der Kranke, der um Leben oder Gesundheit bangt, findet irgendwie Mittel und Wege, dorthin zu gehen, wo er die beste Hilfe zu finden hofft. Darüber möge sich niemand einer Täuschung hingeben.
Wenn wir aus diesem Dilemma einen befriedigenden Ausweg finden wollen, so ist es wohl am besten, darauf zu hören, was der schlichte Mann von der Straße darüber denkt. Er will in erster Linie, daß man ausreichende Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt und wird es daher gewiß dankbar begrüßen, wenn ihm die Krankenkasse solche dort schafft, wo sie bisher nicht zur Verfügung standen. Wenn er aber hört, daß neue Behandlungsstellen errichtet oder ausgebaut werden, während gleichzeitig den schon bestehenden und gut eingerichteten die volle Ausnützung ihrer Leistungsfähigkeit verboten wird, und das in einem Zeitpunkt, in dem das Defizit der Krankenkassen eine beängstigende Höhe erreicht, damn fehlt ihm das Verständnis für solche Maßnahmen, weil es zu offen auf der Hand liegt, daß dafür nicht mehr die Sorge um die bestmögliche Behandlung des Versicherten das treibende Motiv darstellt, sondern daß hier ein Politikum dahinterstecken muß und die Gründe, die man offiziell zugibt, nicht identisch sind mit den eigentlichen Hintergründen. Im übrigen ist der Kassenpatient nicht sehr daran interessiert, in welcher Form ihm die Behandlungsmöglichkeit geboten wird. Er weiß genau, daß weder eine ärztliche Ordination noch ein Ambulatorium an sich gut oder schlecht sind, sondern daß es in erster Linie darauf ankommt, welcher Geist Räume und Apparate erfüllt und leitet. Von Einzelsprechzimmern wie von Ambulatorien geht viel Segen und Hilfe aus; beide haben Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit und beiden haftet, wie jedem Menschenwerk, manche Unvollkommenheit an. Der Kassenpatient will daher nichts anderes als das uneingeschränkte Recht, sich an die Stelle zu wenden, die seiner Eigenart am besten zusagt und die ihm daher am meisten Vertrauen einflößt. Und schließlich wünscht er, von Ärzten behandelt zu werden, die eine vollwertige Ausbildung genossen haben. Zu einer solchen gehört aber auch die lückenlose Verfolgung möglichst vieler Krankheitsfälle vom ersten Frühstadium bis zur endgültigen Heilung. Wenn man den Spitalsärzten die Möglichkeit nimmt, Patienten auch nach der ersten Hilfeleistung in größerer Zahl ambulatorisch weiterzubehandeln, nimmt man ihnen damit einen unersetzlichen Teil ihrer Ausbildung. Alle berufenen Stellen können daher nicht eindringlich genug davor gewarnt werden, einer solchen kurzsichtigen Regelung ihre Zustimmung zu geben. Aber auch der Patient, der am Tag nach der dringlichen Öffnung eines Abszesses oder der Einrichtung eines Knochenbruches vom Arzt oder Kassenbeamten darüber aufgeklärt wird, daß für weitere Behandlung ein anderer Arzt zuständig sei und er nicht mehr dorthin gehen dürfe, wo man sich in der ersten Stunde der Not seiner liebevoll angenommen hat, wird diese Eröffnung nur mit verständnislosem Kopfschütteln quittieren.
Sollen Ärzte und Krankenkassen zum Nutzen der Versicherten einträchtig Zusammenarbeiten, dann ist es aber auch notwendig, daß man endlich aufhört, Mißtrauen zu säen. Wir alle wissen, daß die Verheerungen des Krieges auf seelischem Gebiet noch größer sind als die auf materiellem. Daß das allgemeine Sinken der Moral auch am Ärztestand nicht spurlos vorübergegangen sein kann, ist selbstverständlich; ebenso, daß wegen der hohen Verantwortung, die diesem Beruf innewohnt, jeder Einzelfall sich besonders tragisch auswirken muß.
Solche Einzelfälle berechtigen aber noch lange nicht zu Angriffen gegen den ganzen Stand. Ebenso sinnlos ist aber auch das zur Mode gewordene gedankenlos\e Schimpfen auf die Krankenkassen. Wer mit seiner Kasse wegen eines unerfüllt gebliebenen Wunsches hadert, möge sich daran erinnern, daß in der Zeit vor der obligatorischen Krankenversicherung eine länger dauernde Krankheit des Familienerhalters oder gar eine Serie von Krankheitsfällen, in der Familie zumindest schwere materielle Sorgen, oft eine wirtschaftliche Katastrophe mit sich brachten. Und wer wie ich, seit mehr als zwanzig Jahren Tag für Tag sieht, wie viel unbeschwerter die Kassenpatienten einen längerdauernden Krankenhausaufenthalt hinnehmen als die „Selbstzahler”, der wird einer verantwortungslosen Hetze gegen die Kassen stets ent- gegentreten. Die Krankenkassen soll ten aber ihrerseits wieder nicht vergessen, daß sie diese Leistungen nicht vollbringen könnten, wenn für die Behandlung gerade der schwersten Fälle nicht in den öffentlichen Spitälern Ärzte zur Verfügung stünden, die bei unbegrenzter Arbeitszeit und bei völligem Verzicht auf ein Privatleben, dabei kärglichster Besoldung, ihre ganze Kraft und ihr ganzes Können den Kranken widmen, ohne daß den Krankenkassen über die täglichen Verpflegsgebühren hinaus auch nur ein Groschen an Operations- oder sonstigen Behandlungskosten erwachsen würde. Die Ärzte aber, die nach Beendigung ihrer Spitalsausbildung in die Praxis hinaustreuen, sollen sich daran erinnern, daß für die meisten von ihnen die Kassenhonorare die wesentlichste materielle Existenzgrundlage bilden werden. Wie immer man demnach auch das Problem betrachtet, das eine ist sicher: einträchtige Zusammenarbeit liegt im Interesse aller, Zwietracht bedeutet Schaden für alle. Wir können nur wünschen, daß alle Beteiligten das gefährliche Streben nach Gewinnung, Ausbau und Verteidigung von Machtpositionen zurückstellen mögen gegenüber dem Streben, sich in die berechtigten Wünsche des anderen hineinzudenken. Das Streben nach Macht trübt den Blick und verhärtet das Herz. Wohl kaum eine Generation hat die erschütternde Wahrheit des Bibelspruches: „Alle Macht ist böse!” so eindringlich erfahren wie die unsere. Setzen wir diesem Streben jene Macht entgegen, die allein nicht zerstörend, sondern aufbauend und einend wirken kann: die alles bezwingende Macht der Liebe, der Hilfsbereitschaft und des gegenseitigen Verstehens!



































































































