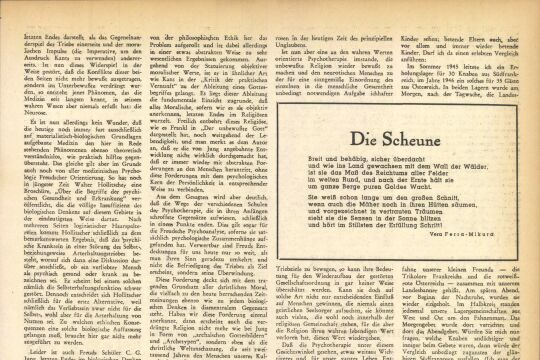Julya Rabinowich: Schwestern des Orakels
„Mutmacherinnen“: Zugunsten der Österreichischen Krebshilfe gestaltete Julya Rabinowich gemeinsam mit der Fotografin Sabine Hauswirth Portraits von zwölf willensstarken Frauen.
„Mutmacherinnen“: Zugunsten der Österreichischen Krebshilfe gestaltete Julya Rabinowich gemeinsam mit der Fotografin Sabine Hauswirth Portraits von zwölf willensstarken Frauen.
Wenn alles, das man für sicher und tragfähig hielt, zerbricht, wenn der Boden unter den Füßen schwindet, und alles, was bis dahin gewohnt und alltäglich war, wie Glasperlen einer zerreißenden Glasperlenkette auseinanderstrebt – was würdest du dann tun? Weglaufen? Weinen? Schreien? Stillsein?
Diese Frage hat mich verfolgt, als ich für das Projekt „Mutmacherinnen“ zwölf Frauen portraitieren durfte, die allesamt Krebspatientinnen waren. Manche geheilt, manche bereits metastasiert und manche im Schwebezustand dazwischen.
Es war diese Frage, die die Betroffenen umtrieb, und jede von ihnen beantwortete diese existentielle Frage sehr unterschiedlich. Von Wut, Resignation, Trennung über aufblühende Kreativität und neuglückende Liebe war alles dabei. Die Lösungsansätze waren so einzigartig wie die Frauen selbst. Was sie allerdings einte, war ihr unglaublicher Mut und die Widerspenstigkeit, die Entscheidung, zu bleiben. Die Entscheidung, dem Leben Schönheit und Glück herauszureißen, mit einem Lächeln und mit blutigen Krallen. Selten habe ich eine so geballte Ladung Widerborstigkeit dem Schicksal gegenüber kennengelernt. Sie kämpften um ihre Familien, sie kämpften um sich. Sie kämpften um die Verbundenheit untereinander. Ein hauchzartes Netzwerk hatte sich zwischen ihnen gespannt, zart wie Spinnweben und belastbar wie Drahtseile.
Verletzliche Amazonen
Vier Wochen sollte die Arbeit dauern. Wir – die Fotografin Sabine Hauswirth, Chefin der Krebshilfe Doris Kiefhaber und ich – hatten zwölf Patientinnen ersucht, ihre Geschichte zu teilen. Durch den Coronaausbruch verschob sich das Prozedere entscheidend: Ich konnte nun nicht mehr selbst interviewen. Das übernahm die langjährige Vertraute Doris Kiefhaber. Im Endeffekt war das vermutlich die bessere Herangehensweise: Die Intimität, die zwischen der Gruppe entstanden war, hätte ich in der kurzen Zeit niemals auch nur gestreift. Die starken schwarzweißen Portraits von Sabine Hauswirth waren die Grundlage für meine Arbeit: Sie fingen sowohl das Verletzliche als auch das Amazonenhafte der Frauen ein. So lernte ich sie von einer ganz anderen Seite kennen, als die harten biografischen Fakten hergegeben hätten. Die Jungen. Die Alten. Die Alleinstehenden. Die Mütter. Die Hausfrauen. Die Berufstätigen.
Eine davon: zwei Kinder, jung, Hochzeit vor der Tür. Dann: Chemo und Angst. Eine Witwe, über die im Dorf getuschelt wurde und die sich ihres Haarverlustes schämte – bis sie die selbstbewusst kahlköpfige Sabine Oberhauser im Fernseher des Dorfcafés sah und sich vor erstauntem Publikum die Perücke vom Kopf riss. Als beeindruckender Befreiungsschlag. Die Frau, deren Mann nach der schockierenden Diagnose nur sagte: „Wieso muss das immer mir passieren?“, als wäre die Krankheit in seiner Brust gefangen und nicht in ihrer. Oder die Frau, die nach zwei gescheiterten Beziehungen dem neuen Partner nach erneuter Rückkehr der Krankheit unter Tränen sagte, er solle sich eine gesunde Frau suchen – und der entrüstet über ein solches Ansinnen reagierte, blieb und durch Dick und Dünn mit ihr ging.
Und dann noch die Frau mit dem Holztäfelchen, auf dem „Alles wird gut“ eingebrannt stand, und die sich wie eine Ertrinkende in stürmischen Fluten an dieses Brettchen geklammert hatte, bis alles tatsächlich wieder gut war. Oder die Tochter jener Mutter, die Brustkrebs überlebt hatte, während die Tante den Kampf verlor. Deren Mantra es war: wie die Mutter werden, nicht wie die Tante. Und natürlich jene Mutmacherin, die ihre Furcht und ihre Verzweiflung in Aktivität und Leidenschaft transformierte und nun die Obfrau der Gruppe „Meta Mädels“ ist, die Frauen vernetzt, betreut, aufbaut: Sie sind alle am selben Seil und jede kämpft mit den anderen gemeinsam. Keine soll allein bleiben.
Allesamt sind sie Schwestern des hämmernden Orakels, jenes Ortes, der den geschundenen Körper durchleuchtet und vermessen und sein weiteres Schicksal verkünden soll: mit Schrecken und Hoffnung erwartete Termine. Die Angehörigen zeigten sich in diesen schweren Stunden mitfühlend oder grausam. Ja, es ist tatsächlich so, wie Tolstoi in „Anna Karenina“ festhält: Alle glücklichen Familien ähneln einander, nur die unglücklichen sind so unterschiedlich in ihrem Unglück. Die Interviews führten mich über eine gewundene Treppe steil hinab, dorthin, wo man dunkle Ecken meiden möchte. Dorthin, wo man nicht zu genau hinsehen will.
Diese unerträgliche Ungewissheit des Seins erschüttert sogar noch als Echo in vermeintlicher Sicherheit. Erschüttert nur beim Hinsehen. Beim Lesen der Selbstbeschreibungen. Bei vielen hatte es eher unauffällig, eher harmlos begonnen. Etwas getastet, sich oft nichts dabei gedacht. Oder gedacht und verdrängt. Oder gar nichts getastet, bis der Krebs in den inneren Organen verheerende Schäden anrichtete. Ich las Tag für Tag diese Geschichten von Fehldiagnosen und Heilungen, von der Wahl der Waffen, von Erfolgen und Rückschlägen erneut, ich musste ja intensiv in sie eintauchen, um auf die für meinen Text wichtigsten Aspekte zu kommen. Forschte in den Gesichtern nach, diesen schön geschminkten, ins beste Licht gerückten Gesichtern jener Frauen, von denen ich gleichzeitig wusste, was für quälende Behandlungen sie über sich ergehen hatten lassen, um jede Chance auszuschöpfen: geschnitten, verkocht, bestrahlt. Und jeden Tag kam eine Tonne Dankbarkeit und ein Schuss Hypochondrie hinzu.
Das Wissen um unsere Endlichkeit
Am Ende dieser Arbeitsphase hatte ich mich zu sämtlichen Kontrollterminen der Gesundenuntersuchung angemeldet: von Ultraschall bis Mammographie. Es wäre mir beinahe unredlich vorgekommen, diese Vorsorge auszulassen. Immerhin leben wir in einem Land, in dem diese Untersuchungen immer noch leicht zugänglich und möglich sind. Es ist ein Privileg, das ich umso mehr als Privileg zu schätzen gelernt habe.
Wir wollen über unsere Endlichkeit meist nichts wissen, und wenn die Erkenntnis dieser Endlichkeit nur sanft unser Bewusstsein streift, ist dieser Augenblick schwer zu ertragen. Der Weg der Mutmacherinnen führte aber ohne Ausnahme genau an diesen Punkt. Hindurch durch Verzweiflung, Schock und das Sich-darüber-Erheben. Auf alle wartete der Abgrund, Vertigo und die Entscheidung, nicht hinabzufallen. Nicht jetzt. Nicht hier. Nicht heute. Das Leben der Frauen war ein beständiger Tanz an dieser Kante, ein ritueller, ein meditativer, ein leidenschaftlicher und aufbäumender Tanz. Spuren zu hinterlassen, hatte sich die Gründerin der Frauengruppe gewünscht. Ja. Diese Spuren sind da. Die Mutmacherinnen haben Mut gemacht. Nicht nur sich selbst, sondern auch vielen anderen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!