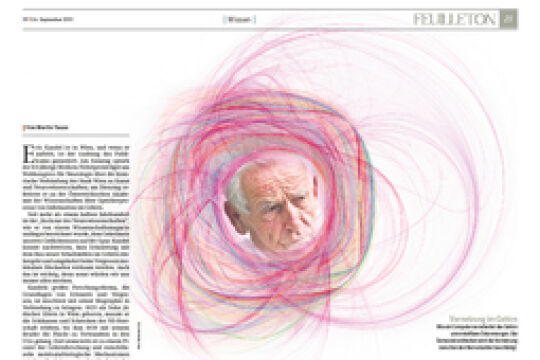Ein Durchbruch in Wien
Begabte Kinder, schrieb der bekannte Wiener Neurologe und Psychiater Professor Walter Birkmayer vor Jahren in der Wiener Klinischen Wochenschrift, würden „stets von mehreren Vätern für sich reklamiert“. Man muß ihn ergänzen: Die Wunderkinder der modernen naturwissenschaftlichen Forschung haben fast immer tatsächlich ein ganzes Team.von Vätern. Das fünfte Internationale Parkinson-Symposion, das kürzlich in Wien stattfand, machte die österreichische Öffentlichkeit aber mit der ihr bestenfalls nur andeutungsweise bekanntgewordenen Tatsache vertraut, daß ein medizinischer Fortschritt von besonderer Bedeutung zwar ebenfalls eine Reihe von Urhebern hat, diese aber ebenso neidlos wie einstimmig dem Wiener Birkmayer einen besonders hervorstechenden Anteil an der gemeinsamen Vaterschaft zuerkennen.
Begabte Kinder, schrieb der bekannte Wiener Neurologe und Psychiater Professor Walter Birkmayer vor Jahren in der Wiener Klinischen Wochenschrift, würden „stets von mehreren Vätern für sich reklamiert“. Man muß ihn ergänzen: Die Wunderkinder der modernen naturwissenschaftlichen Forschung haben fast immer tatsächlich ein ganzes Team.von Vätern. Das fünfte Internationale Parkinson-Symposion, das kürzlich in Wien stattfand, machte die österreichische Öffentlichkeit aber mit der ihr bestenfalls nur andeutungsweise bekanntgewordenen Tatsache vertraut, daß ein medizinischer Fortschritt von besonderer Bedeutung zwar ebenfalls eine Reihe von Urhebern hat, diese aber ebenso neidlos wie einstimmig dem Wiener Birkmayer einen besonders hervorstechenden Anteil an der gemeinsamen Vaterschaft zuerkennen.
Das Kind hat längst einen Namen. Es handelt sich um die Behandlung der Parkinsonschen Krankheit mit L-Dopa, kombiniert mit einer als Decarboxylasehemmer bezeichneten Substanz. Da mit Hilfe dieser neuen Therapie nicht nur das Schicksal von Millionen Betroffenen wesentlich erleichtert, sondern zugleich auch ein bedeutender biochemischer Fortschritt vollbracht wurde, kann man ohne Übertreibung von einer medizinischen Großtat und von einem sehr deutlichen Lebenszeichen der so oft totgesagten Wiener Medizinischen Schule sprechen.
Und dies, obwohl die Parkinson-sche Krankheit nach wie vor nicht geheilt werden kann. Doch ebenso, wie ja auch die Rehabilitation eines Querschnittgelähmten — wo sie möglich ist — keine Heilung, aber' seine Wiedereingliederung in die Gesellschaft bedeutet, kann auch die neue Parkinson-Therapie am schicksalhaften Fortschreiten und Ausgang der Krankheit nichts ändern, aber das Leben des Kranken verlängern, vor allem aber wesentlich erleichtern und seine Umgebung entlasten.
Man schätzt die Zahl der Parkinson-Kranken auf der Welt auf acht bis zehn Millionen, rund 1,5 Millionen in den USA, 150.000 bis 200.000 in der Bundesrepublik (bei jährlich rund 800 Neuerkrankungen), 10.000 Parkinson-Kranke in der Schweiz und ebenfalls annähernd so viele in Österreich. Während früher ein erheblicher Prozentsatz der Kranken innerhalb von fünf Jahren nach Ausbruch der Krankheit schwer körperbehindert oder verstorben war, können durch die neue Therapie 30 Prozent für viele Jahre ihre Berufstätigkeit wiedererlangen und jeder zweite wenigstens so weit gebracht werden, daß er in der Lage ist, sich selbst zu versorgen.
Der Morbus Parkinson wurde bereits 1817 von dem englischen Arzt J. Parkinson erstmals beschrieben. Kennzeichnend für das Frühstadium sind eine starke Herabsetzung des Mienenspiels im Gespräch, eine Erweiterung des Lidspalts in Verbindung mit Verminderung der Blinzelbewegungen („starrer Ausdruck“), Rückgang der Mitbewegungen (etwa beim Gehen), vornübergeneigte Haltung, vor allem aber starke Bewegungsarmut, etwa ruhiges Liegen der Hände auf den Knien, während der Patient lebhaft seine Symptome beschreibt. Das für die Parkinson-Krankheit typische Zittern der Hände tritt oft erst in einem späteren Stadium auf.
Viele Parkinson-Erkrankungen werden zunächst mit „Rheumatismus“ oder „allgemeinen Alterserscheinungen“ verwechselt, bis die für die Krankheit typischen Zeichen erkennbar werden: ein typischer Widerstand beim Bewegen der Gliedmaßen durch den Arzt, Zittern, Bewegungsarmut beziehungsweise -verlangsamung, bis zur Unfähigkeit, bestimmte Bewegungen auszuführen, zum Beispiel zu gehen oder zu schreiben, manchmal aber auch die Unfähigkeit, stehenzubleiben, wenn man einmal im Gehen begriffen ist.
Parkinsonismus tritt meist im vorgeschrittenen Alter auf, er ist im wesentlichen eine Abbaukrankheit des Gehirns bei vollkommen unbeeinträchtigter intellektueller und schöpferischer Leistungsfähigkeit. Seit die Berufsfähigkeit oft medikamentös wiederhergestellt werden kann, gibt es parkinsonkranke Orchestergeiger, ja sogar Chirurgen, die in der Lage sind, ihren Beruf noch jahrelang auszuüben. Die mittlere Lebenserwartung liegt bei zehn bis fünfzehn Jahren — wobei die Geschwindigkeit, mit der die Krankheit fortschreitet, oft von Fall zu Fall außerordentlich verschieden ist.
Die Behandlung, die den Kranken nicht heilen, ihm aber anstelle von Qualen ein menschenwürdiges und erfülltes Dasein über viele Jahre hinweg ermöglichen kann, ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung. Am wichtigen ersten Schritt zur Behandlung mit L-Dopa hat Professor Birkmayer wesentlich mitgewirkt, der entscheidende weitere Schritt vorwärts gelang dem Wiener im Alleingang.
Seine zentrale Entdeckung ist nicht nur für die Parkinson-Kranken von
Bedeutung, sondern auch für das Verständnis der biochemischen Grundlagen zentralnervöser Störungen. Für den Nicht-Arzt sind diese Forschungen aber auch als Beispiel für die stufenweise Lösung eines naturwissenschaftlichen Problems im Zusammenwirken verschiedener Fachgebiete (Neurologie, Anatomie, Biochemie, Chirurgie) interessant.
Am Beginn steht eine Entdeckung der Neurochemie . als eines jungen Zweiges der Biochemie. Skandinavische Wissenschaftler (Carlsson, Bertler, Rosengren) stellen fest, daß bio-gene Amine (körpereigene chemische Ammoniak-Abkömmlinge) im Gehirn ungleich verteilt sind. Es gibt zum Beispiel Hirnareale, in denen verhältnismäßig hohe Konzentrationen von Adrenalin, Noradrenalin oder Serotonin gemessen werden können, während in den Basalgang-lien des Gehirns Dopamin in hoher Konzentration vorkommt.
Diese Entdeckung gibt Forschern, die sich mit dem Morbus Parkinson befassen, wertvolle Denkanregungen. In Montreal stellt Barbeau erhöhte Dopaminmengen im Harn von Parkinson-Kranken fest. In Wien gibt Birkmayer den Anstoß zu neuro-anatomischen Untersuchungen von Ehringer und Hornykiewicz. Auf Grund älterer Forschungen (Vogt, Tretjakow), die bei Parkinson-Kranken degenerative Veränderungen in den Basalganglien des Gehirns festgestellt haben, wendet man sich speziell diesen Hirnarealen zu. Ehringer und Hornykiewicz erbringen den Nachweis, daß die Basalganglien an Parkinson verstorbener Patienten einen deutlich herabgesetzten Do-pamingehalt aufweisen.
Die direkte Verabreichung von Dopamin scheitert. Es stellt sich heraus, daß Dopamin die Bluthirnschranke nicht überschreitet, also überhaupt nicht ins Gehirn gelangt. Die biologische Vorstufe des Dopamin hingegen, L-Dopa (linksdrehendes Dioxyphenylalanin), gelangt sehr wohl ins Gehirn und wird dort (durch Decarboxylase, Abbau von Carbonsäuren unter CO2-Abspaltung) zu Dopamin verarbeitet.
Daß es offenbar so ist, wurde gleichzeitig und unabhängig voneinander in Wien und Montreal nachgewiesen. In beiden Städten ergab die L-Dopa-Therapie positive Effekte, vor allem, was die Akinese, die Unfähigkeit zu willensmäßig ausgelösten Bewegungen, oder solche Bewegungen zu stoppen, betraf (eines der schwerwiegendsten Parkinson-Teilsymptome).
Bei der reinen L-Dopa-Behandlung wird aber ein großer Teil davon nicht im Gehirn, sondern in anderen Organen (Darmwand, Leber, Niere) in Dopamin verwandelt, geht der Therapie verloren und verursacht so schwerwiegende Nebenerscheinungen, daß in manchen Fällen die Behandlung sogar abgebrochen werden muß. Die Wiener Arbeitsgruppe sucht nun nach Möglichkeiten, den sehr schnell abflauenden L-Dopa-Effekt zu verlängern. Depotformen können nicht hergestellt werden. Die Idee, durch Beigabe von Ferment-Hemmern den Abbau des im Gehirn aus dem L-Dopa produzierten Dopamin zu bremsen und so die Wirkung zu verlängern, bewährt sich nur bei einem Teil der Patienten und wird wieder aufgegeben.
Die entscheidende neue Anregung kam von unerwarteter Seite. Die Pharmafirma Roche hatte eine Substanz namens Ro 4-4602, die durch ihre außerordentliche Hemmfähigkeit für Decarboxylase aufgefallen war, zur klinischen Erprobung freigegeben. Natürlich dachte niemand daran, sie Parkinson-Kranken zu verabfolgen, da ja deren Behandlung gerade auf dem Aufbau von Dopamin aus L-Dopa durch Decarboxylase beruhte. Vielmehr wurde Ro 4-4602 auf etwaige blutdrucksenkende Eigenschaften (die sich nicht ergaben) untersucht, und später, auf der Spur möglicher psychotroper Effekte, Patienten verabreicht, die an Cho-rea-Huntington litten, einer durch ein Höchstmaß von Bewegungsunruhe gekennzeichneten Krankheit. Man erwartete, daß der Decarboxylasehemmer den biogenen Amin-gehalt im Gehirn senken und eine beruhigende Wirkung entfalten werde. Zu Professor Birkmayers Uber-raschung war genau das Gegenteil der Fall.
Da Chorea-Huntington in gewisser Beziehung genau das Gegenstück der Parkinsonschen Krankheit darstellt, beschloß Birkmayer, zu versuchen, ob Ro 4-4602 etwa auch bei Parkinson-Patienten das Gegenteil dessen, was man sich nach dem damaligen Wissen ausrechnen konnte, auslösen würde. Zum größten Erstaunen der Wissenschaftler trat genau dies ein. Ro 4-4602 hatte eine deutlich bessernde Wirkung auf die Parkinson-Symptome, und vor allem, wenn man die Substanz zusammen mit L-Dopa verabfolgte, einen erstaunlichen, die L-Dopa-Wirkung erhöhenden Effekt.
Während nun die L-Dopa-Behandlung nach gründlichster Prüfung auf breiterer Basis angewendet wurde, suchten die Forscher die biochemische Wirkungsweise der L-Dopa-Kombination mit einem Decarboxylasehemmer zu klären. Barthplini und der Forschungsdirektor von Roche, Pletscher, fanden die Erklärung. Ebenso wie Dopamin kann auch der Decarboxylasehemmer die Bluthirnschranke nicht überwinden und nicht in das Gehirn eindringen. Hingegen verhindert er den Abbau von L-Dopa zu Dopamin überall dort, wo er nicht erwünscht ist. Dadurch wurden die negativen Nebenwirkungen der L-Dopa-Behandlung drastisch vermindert, und gleichzeitig kam man mit einer viel geringeren Dosis aus, da ja L-Dopa außerhalb des Gehirns nicht mehr durch Decarboxylase verlorenging. Die Vorteile sind gewaltig. Früher konnte wegen der Nebenwirkungen vielen Parkinson-Kranken nicht die notwendige L-Dopa-Menge verabfolgt werden, überdies zog sich die Ermittlung der günstigsten Erhaltungsdosis oft über Monate hin. Die Dosen können nun schneller erhöht werden, der Behandlungseffekt tritt schneller ein.
Das neue Kombinationspräparat (Madopar), das in Form von Kapseln eingenommen werden kann, wurde jahrelang klinisch erprobt, bevor es für die allgemeine Anwendung freigegeben wurde. Für den Parkinson-Kranken ist es das Kernstück einer Therapie, in der viele Faktoren zu berücksichtigen sind. Das typische Parkinson-Zittern zum Beispiel kann auch heute noch oft nur durch eine neurochirurgische Operation, den stereotaktischen Eingriff, behoben oder gebessert werden. Diese 1947 erstmals ausgeführte Operation wurde bislang in über 25.000 Fällen durchgeführt und durch die Entwicklung hochpräziser Zielgeräte (die Operation beruht auf der Unterbrechung der extrapyramidalen Bahnen im Cerebralkern durch nadeiförmige Elektroden) verbessert werden. Sie hat aber durch die medikamentöse Behandlung einiges von ihrer Bedeutung verloren. Trotzdem ist die Zahl jener Fälle, in denen die operative Beseitigung des Zitterns beispielsweise zur Wiederherstellung der Berufsfähigkeit wesentlich ist, noch immer so groß, daß die Weiterentwicklung der neurochirurgischen Techniken — etwa durch Professor Jean Siegfried in Zürich — auch für die Parkinson-Kranken wichtig ist.
Noch immer weiß man nicht sehr viel darüber, welche Faktoren die Parkinsonsche Erkrankung auslösen. Viren können sie verursachen — als Folge von Gehirnhautentzündungen, auch auch Virusgrippen. Die Grippe-Epidemie im Anschluß an den Ersten Weltkrieg hatte gehäuftes Auftreten von Parkinson-Erkrankungen, oft mit jahrzehntelanger Verzögerung, zur Folge. Morbus Parkinson kann auch als Folge von Vergiftungen auftreten — nach Kohlen-monoxyd- oder Manganvergiftungen. Die peruanischen Mangan-Bergarbeiter sind die einzige bekannte echte Risikogruppe. In der Mehrzahl der Fälle aber ist die Krankheit auf altersbedingte degenerative Veränderungen des Gehirns zurückzuführen.
Es ist durchaus möglich, daß die Entdeckung der Kombinationsbehandlung einst als Meilenstein in die Geschichte der Neurologie und Biochemie eingeht. Schon heute ist abzusehen, daß die Spur sehr viel weiter führt — bis zum besseren Verständnis psychischer Störungen und anderer neurologischer Krankheitsbilder. Die Wirkung von L-Dopa auf gehemmte Depressionen wurde schon vor Jahren untersucht, wofür vor allem die bei der L-Dopa-Behandlung auftretenden psychischen Nebenwirkungen (Steigerung verschiedener psychosomatischer Funktionen) den Anstoß gaben. Die Rolle der biogenen Amine bei depressiven Erscheinungsbildern wird heute von zahlreichen Forschern untersucht — Fortschritte in dieser Richtung wären um so wichtiger, als, unter anderem Birkmayer zufolge, Depressionen heute in außerordentlich starker Zunahme begriffen sind. Wohl durch den Streß. Ob auch am Entstehen von Morbus Parkinson Streß beteiligt sein kann? Niemand kann es bejahen, niemand mit Sicherheit verneinen.