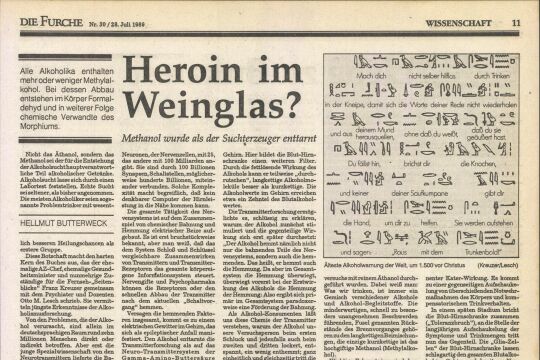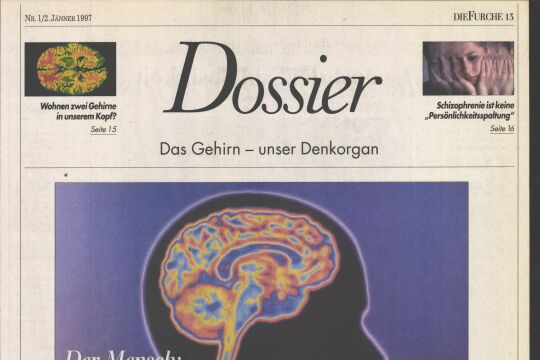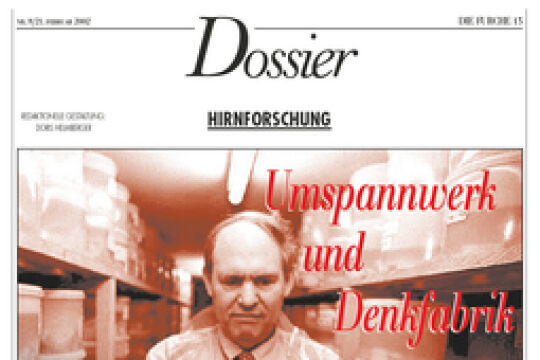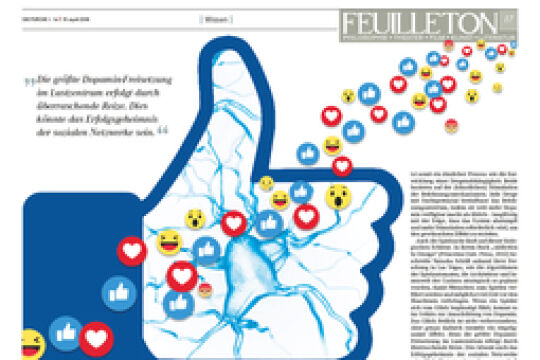Angst zu haben, macht biologisch Sinn: Gefahren werden so früher erkannt. Ängste können aber auch krank machen – zum Beispiel zu Verzweiflung und Depression führen. Die neurobiologischen Grundlagen der Angst versteht die Wissenschaft immer besser. Und auch, was im Gehirn vorgeht, wenn wir keine Angst haben und uns sicher fühlen.
Eine Maus nähert sich einer Katze und schnüffelt neugierig-dreist an ihrer Schnauze. Es waren ungewöhnliche Bilder, die japanische Forscher vor rund einem Jahr der (Fach-)Öffentlichkeit präsentierten. Der Grund für das widernatürliche Verhalten der Maus war, dass die Forscher durch einen gentechnischen Eingriff Riechzellen in einem bestimmten Teil der Nasenschleimhaut deaktiviert hatten. Als Folge davon blieb die angeborene Abneigung gegenüber Feinden aus. Was dann die Katze mit der furchtlosen Maus anstellte, ist nicht überliefert. Es ist dennoch anzunehmen, dass das fehlende Panikverhalten für den Nager auf Dauer kein Überlebensvorteil gewesen sein dürfte. Angst- und Panikreaktionen machen folglich biologisch Sinn. Dass sie tief in der Natur verankert sind, sollte nicht überraschen. Und dass nicht alles Angstverhalten in den Genen festgeschrieben ist, sondern sich auf neuartige Gefahren neue Ängste entwickeln lassen, ist in diesem Sinne auch eine wertvolle Fähigkeit.
Andererseits können erlernte Ängste auch zu einem ernsthaften Problem werden, wie das Beispiel Mensch auf vielerlei Weise veranschaulicht: Manche fürchten sich nicht nur vor Schlangen, sondern auch vor kleinen Mäusen. Bei vielen ruft allein die Vorstellung, mit einem Flugzeug reisen zu müssen, Todesfantasien hervor. Rein statistisch gesehen, ist das Leben in einer Stadt weitaus gefährlicher – aber kaum ein Fußgänger ängstigt sich beim Überqueren einer Straße etc.
Gelernte Angst, gelernte Sicherheit
Während viele Angststörungen mit Psychotherapien und/oder Medikamenten zum Teil bereits erfolgreich behandelt werden können (siehe auch Artikel unten), fällt auch ein immer helleres Licht auf die zugrundeliegenden neurobiologischen Prozesse. Was im Gehirn genau abläuft, je nachdem, ob Mäuse Angst oder aber Sicherheit erlernt haben, hat vor Kurzem etwa die heimische Forscherin Daniela Pollak herausgefunden, wobei sie ihre Experimente im Labor des Nobelpreisträgers Eric Kandel in New York durchführte.
Analog zu Pawlows berühmten Hunden wurden die Labormäuse dabei „sicherheitskonditioniert“, wie Pollak im Gespräch mit der FURCHE erklärt: Die Mäuse bekamen in unregelmäßigen Abständen einen leichten, für sie unangenehmen Elektroschock durch den Fuß. Wenn aber ein bestimmter Ton eingespielt wurde, passierte ihnen mit Sicherheit nichts. Die kleinen Nager lernten auf diese Weise, mit dem Ton ein Gefühl von Gefahrlosigkeit zu assoziieren – und fühlten sich folglich entspannt.
Diese „gelernte Sicherheit“ – so der Fachausdruck – lässt sich auch in anderen Kontexten quasi per (Ton-)Knopfdruck reaktivieren. Pollak konnte zum Beispiel zeigen, dass damit einer Depression, die oft mit einer ganzen Reihe von Ängsten einhergeht, erfolgreich entgegengewirkt werden kann. Aber können Mäuse überhaupt depressiv sein? Dazu die Forscherin: „Es gibt Tests, die einen vergleichbaren Zustand bei Mäusen hervorrufen und von der Pharmaindustrie verwendet werden, um Medikamente mit anti-depressiver Wirkung für den Menschen zu finden.“ Einer dieser Tests ist der sogenannte aufgezwungene Schwimmtest. Dabei werden die Mäuse in einen Glaszylinder gebracht, der mit Wasser gefüllt ist. Die Mäuse können schwimmen, aber der unangenehmen Situation nicht entkommen. Sie versuchen es trotzdem und geben früher oder später ihre Ausbruchsversuche auf. „Das wird in Analogie gesetzt zum menschlichen Verhalten. Depressive Menschen denken ja oft, es bringt eh nichts. Sie sind verzweifelt und haben aufgegeben“, erklärt Pollak. Tatsächlich haben die Mäuse, die den Sicherheitston hörten, beim Schwimmtest länger durchgehalten und sich mehr angestrengt. „Wie wenn man ihnen ein Antidepressivum verabreicht hätte“, fügt die Forscherin hinzu.
Eine weitere Überraschung brachte die molekularbiologische Analyse. Denn viele der gängigen Antidepressiva – wie etwa Prozac – greifen in den Serotonin-Haushalt ein.Genauer gesagt: Sie hemmen die Wiederaufnahme und damit den Abbau des „Glücksstoffs“ Serotonin. Die Verabreichung eines Serotonin-Blockers hatte auf das Verhalten der sicherheitskonditionierten Mäuse aber keine Wirkung. Folglich musste der Lernprozess über einen anderen biochemischen Pfad laufen. Pollak meint zu dem Ergebnis: „Das bedeutet auch, dass es zu den bisherigen pharmakologischen Antidepressiva Alternativen geben könnte, die auf diesem anderen Signalweg eingreifen.“ Im Mandelkern, der als „Sitz der Emotionen“ eine wesentliche Schaltstellenfunktion im Gehirn hat, wurde die Wissenschafterin dann fündig: Zwei Botenstoffe – Dopamin und ein kleines Neuropeptid namens Substanz P –wurden durch die Sicherheitskonditionierung verändert. Von Dopamin war schon bisher bekannt, dass es eine Schlüsselrolle bei all den Dingen spielt, die uns Vergnügen bereiten: Ein geschmackvolles Essen oder aber auch Drogen wie Kokain beeinflussen die Ausschüttung dieses „Genuss-Hormons“.
Von der Maus zum Menschen
Pollak stellte nun fest, dass im Mandelkern die Zahl der Dopamin-Rezeptoren bei den Mäusen, die ein Sicherheitsgefühl gelernt hatten, kleiner war. Doch warum sollte es weniger Andockstellen für das „Genuss-Hormon“ geben? „Weil es nicht so viele davon braucht, wenn so schon genug Dopamin vorhanden ist. Die umgekehrte Beobachtung ist übrigens aus einigen Studien über Stress und Angst bekannt. Da wird die Produktion an Dopamin-Rezeptoren hinaufreguliert, weil mehr Rezeptoren helfen sollen, mehr von dem – nur spärlich vorhandenen –Dopamin zu binden.“
Ob die Sicherheitskonditionierung beim Menschen ähnliche oder gar die gleichen molekularen Schaltkreise benutzt? Pollak hofft, demnächst darüber Auskunft geben zu können. Eine entsprechende Studie, bei der moderne bildgebende Verfahren einen Blick ins Innere des menschlichen Gehirns gewähren, ist als Publikation in Vorbereitung. Erste Ergebnisse vorweg bekanntzugeben, ist in der Wissenschaft nicht gestattet. Die Forscherin lässt sich denn auch nichts entlocken. Ihr Mentor Eric Kandel wäre aber wohl ziemlich überrascht, wenn es anders wäre. Der US-Spitzenforscher hat Lernprozesse an Aplysia, einer einfachen Meeresschnecke, veranschaulicht. Ein radikal reduktionistischer und fruchtbarer Ansatz, der ihm immerhin den Nobelpreis einbrachte. Mit Vorliebe zitiert Kandel dazu den Physiker Victor Weisskopf: „Die Natur verwendet gerne immer wieder dieselben alten Tricks.“