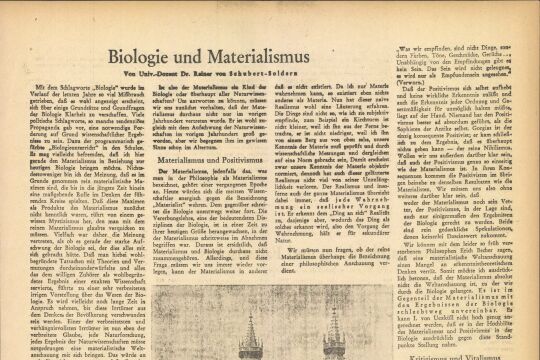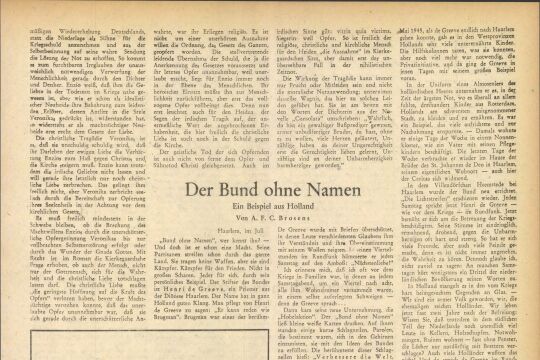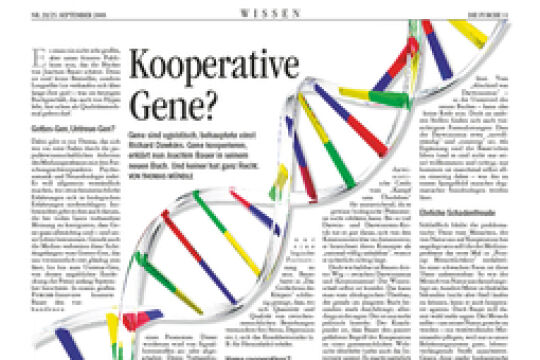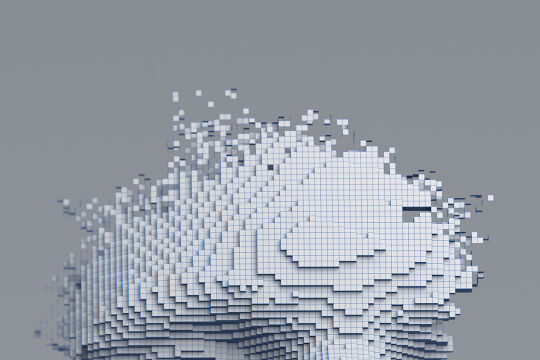Wozu hat der Pfau solange Schwanzfedern, daß seine Flugfähigkeit beeinträchtigt wird? Wozu hat der Argusfasan so lange Schwungfedern, daß er gar nicht mehr fliegen kann? Warum leistet sich die Evolution den gigantischen Aufwand der sexuellen Vermehrung? Kann man lebende Systeme im Computerspiel erzeugen? Warum sind wir zu Verwandten netter als zu Fremden? Warum kollabieren Ökosysteme, obwohl wir alles geplant haben und nur das Beste wollten? Warum ist es erfolgreicher, zu kooperieren, als den Nachbarn auszubeuten? Auf diese und ähnliche Fragen sucht die mathematische Spieltheorie Antworten zu geben. Karl Sigmund, Professor für Mathematik an der Wiener Universität, hat diese Antworten in einem neuen Buch dargestellt.
Warum die Spieltheorie, könnte man fragen. Kann man solche Fragen nicht in der Biologie, Evolutionstheorie, Feldforschung, durch Beobachtung „in freier Wildbahn” beantworten? Wer das Sozialverhalten eines Wirbeltieres, sei es Fisch, Amphib, Vogel, Beptil oder Säuger, in konkreten Sozietäten untersuchen will, wird rasch bemerken, daß ihn eine bestimmte Eigenschaft dieser Systeme zur Verzweiflung bringt: ihre Komplexität. Das gleiche Problem hat der Molekularbiologe, der versucht, die Biochemie einer Zelle zu verstehen, der Anatom, der die Entwicklung des Schultergürtels bei Wirbeltieren „erklären” möchte, ganz zu schweigen vom Neurophysiologen, der wissen möchte, was „Sehen” bedeutet. Um dieser Schwierigkeit zu entgehen, verwendet die Naturwissenschaft einen „Trick”: die Modellbildung.
Wir tun in all unseren Vorstellungen ständig dasselbe. Wir untersuchen nicht eine Gesellschaft, sondern das Modell, das wir uns von ihr machen, untersuchen auch nicht die Evolution unserer Vorfahren, sondern die Theorien, die wir über ihre Entwicklung aufstellen. Selbst im Alltag denken wir immer in Modellen. Das schöne schlanke Mädchen am Titelblatt oder in der Werbung heißt nicht zufällig „Model” - es ist die schematisierte Zusammenfassung des gerade gängigen Idealbildes. In der Naturwissenschaft, besonders bei dynamischen Systemen, sind Modelle zunächst Gedankenexperimente, in denen dem Phänomen des Spieles eine wesentliche Rolle zukommt. Betrachten wir zwei Beispiele.
Der Aufwand, den die Natur im Zusammenhang mit der sexuellen Vermehrung entwickelt, scheint zunächst absurd. Bleiben wir beim Menschen. Umständliche und energieverzehrende Rituale der Werbung und des Flirt-Verhaltens entstehen, die Natur muß auf der einen Seite die Sexualität durch einen enormen Lustgewinn gleichsam „erzwingen” (sonst wäre das Verhalten nicht viel interessanter als in der Nase des Nachbarn zu bohren) und andererseits mit einem Gebirge von Konsequenzen des Sozialverhaltens die eben der notwendigen Neigung entsprechende beliebige Sexualität verhindern. Die Folgen dieses Dilemmas sind so alt wie die Geschichte des Menschen. Man könnte fragen: Wozu das Ganze?
Betrachtet man die Möglichkeiten, genetische Information weiterzugeben, vor Störungen zu schützen und möglichst rasch und effizient an das Milieu anzupassen, in einem Modell, so wird deutlich, daß der Vorteil der zweigeschlechtlichen Vermehrung alle Nachteile bei weitem überwiegt. Dabei sieht alles zunächst ganz anders aus, denn Fortpflanzung heißt ja, aus einer Zelle zwei zu machen. Sexualität aber bedeutet zunächst, aus zwei Zellen eine zu machen, nämlich eine Zygote, in der jeder Elternteil nur noch mit 50 Prozent seiner genetischen Information „im Spiel” ist. Würden sich die Weibchen ungeschlechtlich vermehren, könnten sie 100 Prozent ihres Genoms an ihre Nachkommen weitergeben.
Wozu die Verschwendung von Information? Wir müssen dem Modell aber eine wesentliche Tatsache hinzufügen, nämlich, daß die Gene einer Population nicht ewig gleich bleiben, sondern ständig zufälligen Mutationen unterliegen, von denen manche einen Vorteil bedeuten, die meisten aber schädlich sind. Jetzt sieht die Sache schon anders aus. Es ist nämlich nur durch sexuelle Fortpflanzung möglich, erfolgreiche Mutationen relativ rasch zu verbinden - und ebenso, negative Mutationen zu entfernen. Daher ist es die Rekombination der genetischen Information, die für die Population einen „eugenischen” und einen hygienischen Gewinn gewaltigen Ausmaßes bedeutet. Der hygienische Gewinn besteht darin, daß man durch Rekombination das Immunsystem ständig leicht variieren kann und damit der Evolution von Parasiten und Viren immer „einen Schritt voraus” ist. Sex ist, wie man nachrechnen kann, allen anderen Strategien weit überlegen.
Jetzt kehren wir vom spieltheoretischen Modell in die (zum Beispiel menschliche) Wirklichkeit zurück. In naiver Weise könnte man nun dem Slogan folgen: „Sex is good for your health”. In einigen Dimensionen ist das richtig, aber wie erklärt man es einem AIDS-Kranken? Wir erkennen hier eine entscheidende Eigenschaft aller Modelle, daß sie nämlich immer nur einen Teilaspekt der gesamten Wirklichkeit darstellen und verständlich machen können, aber nie das Ganze. Sie zeigen aber auch die Ambivalenz aller evolutionären Strategien, denn wenn sich Weibchen nur asexuell vermehren, sind sie ein genetisch wehrloses Ziel aller Parasiten und Viren, vermehren sie sich sexuell, können sie von den Männchen ausgebeutet werden. Und daß sie deshalb auf komplexeren Ebenen Gegenstrategien entwickeln, ist ja nicht unbekannt.
Nehmen wir ein anderes Beispiel. Warum soll man in einer Gesellschaft kooperieren, statt alle anderen auszubeuten? Es gibt in der Natur ja zahlreiche Parasiten, die von der Ausbeutung leben, es gibt Raubfische, die sich als Putzerfische tarnen und ungeschoren bis in die Kiemen des ahnungslosen Großfisches vordringen, dem sie -ein Stück Kieme herausbeißen. Es gibt auch in der Natur genügend Beispiele dafür, wie man den anderen „übers Ohr haut”. Bei jungen Pavian-Männchen kommt es oft vor, daß einer den dominanten Besitzer eines brünftigen Weibchens in einen Streit verwickelt, während der andere inzwischen mit dem Weibchen kopuliert - beim nächsten Mal tauschen die beiden ihre Bollen.
Zum koonerativen Verhalten sind zahlreiche Modelle entwickelt worden, deren berühmtestes das sogenannte Gefangenendilemma ist. Karl Sigmund schildert auf ebenso amüsante wie lehrreiche Weise den Verlauf dieser Spielstrategie. Das Bemerkenswerte an diesem Modell ist, daß es folgendes zeigt: In dem Moment, da eine Aussicht auf Wiederholung des Spieles besteht, wenn es also nicht bloß eine einzige Entscheidung gibt, kooperativ zu sein oder nicht, setzt sich die kooperative Strategie durch. Warum das so ist und von welcher Art die Faktoren sind, von denen es abhängt, das in Sigmunds Buch nachzulesen, ist höchst empfehlenswert.
Es enthält viele Beispiele, die zeigen, wie man mit dem Instrument der mathematischen Spieltheorie an biologische Fragestellungen herangehen kann. Wer sich die Mühe macht, sich mit diesem Thema zu beschäftigen (wobei die Mühe gar nicht so groß ist), wird Erstaunliches erfahren. Zum Beispiel, daß die Selbstreproduktion lebender Systeme gar kein so unfaßbares Rätsel ist, wie man in der Biologie lange meinte (und meint), welche Funktion die Beißhemmung der Wölfe oder der Geschlechterkrieg zwischen männlichen und weiblichen Fischen hat, daß man die Ausbreitung einer Mutation unter Zuhilfenahme der Analogie mit dem Lotteriespiel beschreiben kann oder welche Struktur die Zusammenhänge in einem ökologischen System haben. Und vieles mehr.
Es darf aber auch, nun einmal umgekehrt, der Biologe dem Mathematiker gegenüber auf etwas hinweisen, was übrigens Karl Sigmund selbst genau sieht. Nämlich, daß all diese Modelle nicht imstande sind, die jeweilige ganze und konkrete Wirklichkeit darzustellen. Die besten heute verfügbaren Rechner und Programme reichen nicht einmal aus, die Vorgänge in einer einzigen lebenden Zelle vollständig zu beschreiben und zu simulieren. Wie sollen sie also Aussagen begründen können über Kultur, Moral, Ethik, Religion und so fort? Wenn also Karl Sigmund im Kapitel über die Kooperation beim Thema „... dann halte die andere Wange hin” von den „überspannten Lehren des Evangeliums” schreibt, wäre es der Sache nützlicher gewesen, die eigenen Erkenntnisse (nachzulesen etwa auf Seite 12 seines Buches) zu berücksichtigen und die Kirche im Dorf zu lassen.
Das soll aber das Buch nicht abwerten. Es ist, im Gegenteil, ein äußerst instruktives und spannend lesbares Beispiel für die wichtige Erkenntnis, daß die Naturwissenschaft nicht von „der Natur” handelt, sondern daß wir uns immer Modelle bilden müssen, um, wie Albert Einstein sagte, „dem Alten auf die Schliche zu kommen.” Man lernt in diesem Sinne sehr viel aus Karl Sigmunds Buch.
Der Autor ist Biologe,
Mitautor von Rupert Riedl („Biologie der Erkenntnis”), Hochschullehrer für Biologie in Linz sowie Autor des Buches „Wie kam der Apfel auf den Baum?” und zahlreicher Arbeiten über Evolutionstheorie und evolutionäre Erkenntnistheorie.