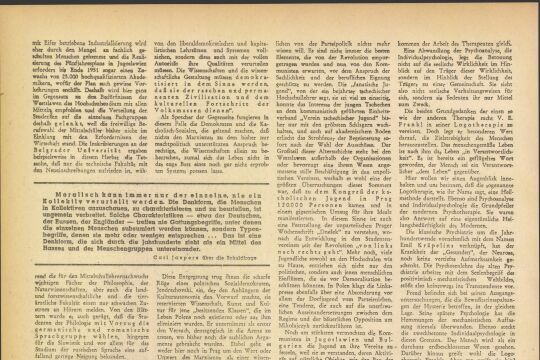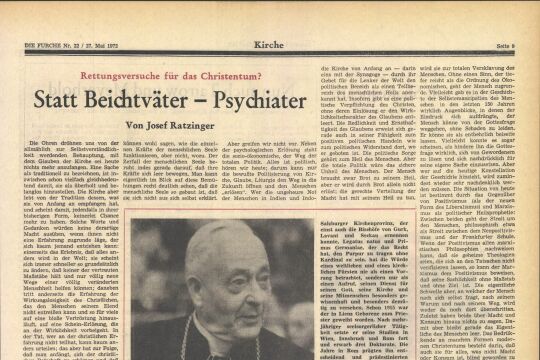Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Mensch — Ebenbild Gottes oder Nebenprodukt der Evolution?
Was ist der Mensch? Das ist die Frage. Ist sie es wirklich? Sind wir nicht nach den vielerlei „Kränkungen“, die die Wissenschaft unserem Selbstverständnis zugefügt hat, abgeklärt genug, uns endlich nüchtern einzuschätzen? Welchen Sinn soll diese Frage angesichts der Uberfülle wissenschaftlicher Auskünfte noch haben — außer den, die Erforschung des Menschen in Bewegung zu halten?
So mancher fragt sich, welchen Wert denn die alten Aussagen über den Menschen angesichts der diversen kopernikanischen Wenden überhaupt noch haben sollen. Der Mensch — Ebenbild Gottes? Erzählt nicht schon Nietzsche von der hochmütigsten und verlogensten Minute der Weltgeschichte, in der in irgendeinem abgelegenen Winkel des Weltalls kluge Tiere das Erkennen erfanden und nach einem Atemzug wieder zu verschwinden hatten, ohne daß irgend etwas Bedeutendes passierte? Kommt diese Fabel nicht den sogenannten Tatsachen näher?
Wird nicht von (naturwissenschaftlicher Seite versichert, die Rede von der Gottes-ebenbildlichkeit des Menschen sei eine Überheblichkeit, eine Selbstverherrlichung und ein billiger illusionärer Trost, mit dem sich der Mensch über seine geringe Rolle in der Gesamtevolution hinwegtäuscht? Hinter dieser Versicherung steht die Uberzeugung, illusionslos werde über den Menschen erst im Kontext der Evolutionstheorie geredet. Diese wird denn auch zuweilen als Lehrmeister von Versöhnlichkeit, Bescheidenheit und sogar Hoffnung empfohlen.
Der Mensch - Ebenbild Gottes, der Mensch — eine Nebenrolle in dem kosmischen Geschehen. Eine Gegenüberstellung, deren allemal noch zu beobachtende Beliebtheit jedoch nichts an ihrer Gedankenlosigkeit ändert. .Es ist nämlich gedankenlos, die Frage nach der Rechtmäßigkeit und den Voraussetzungen solch einer Alternative erst gar nicht zu stellen und zu vergessen (oder zu verschweigen), daß fachwissenschaftliche (also auch: evolutionstheoretische) Aussagen sich einer methodischen Abstraktion verdanken, und sich mit fachwissenschaftlichen (!) Mitteln über das methodisch Ausgeblendete prinzipiell nichts mehr ausmachen läßt. Die Wissenschaft verdankt ihren Erfolg unter anderem der Tatsache, daß sie auf das Stellen gewisser Fragen verzichtet.
Freilich: Solche Fragen kann und will der Fachwissenschaftler als Mensch keineswegs unterlassen, wenn er nämlich ernsthaft über sich und sein Tun nachdenkt, sind es doch zumeist gerade jene Fragen, die eben unser unverkürztes Menschsein betreffen. Hier gilt es aber intellektuell redlich zu bleiben: Nicht darum hat es zu gehen, kritiklos einem metaphysischen Einheitsbedürfnis nachzugeben und auf dem Weg einer Totalisierung abstrakt-methodischer Aussagen zu befriedigen, sondern den rechten Ansatz für jene bewußt von der Fachwissenschaft nicht gestellten Fragen zu gewinnen.
Es gilt für viele ausgemacht, daß die Frage nach dem Menschen zuallererst eine genetische, das heißt eine nach der evolutiven Herkunft des Menschen ist. Dem ist zu widersprechen: Bevor man nach der Herkunft fragt, hat man sich darüber Rechenschaft zu geben, was alles zu demjenigen gehört, um dessen Herleitung es zu tun ist — von der weitergehenden Frage einmal abgesehen, was denn dergleichen wie „Herleitung“, „Herkunft“, „Entstehen“ sein könnte. Eine Unterbestimmung des zu Erklärenden geht mit einer Unterbestimmung seiner Herkunft einher.
Zuerst ist zu fragen, ob das Vorverständnis von Menschsein, welches die genetische Frage bereits leitet, uns Menschen überhaupt angemessen ist, das heißt, ob es auch wirklich all das zur Sprache bringt, was unser unverkürztes Menschsein ausmacht. Darüber kann eine evolutive Herleitung naturgemäß nichts sagen. Ausgangspunkt für die Frage nach der Herkunft ist nicht der berühmte Urknall — oder was auch immer aufgrund des neuesten astrophysi absehen Forschungsstandes an .eine Stelle treten mag —, sondern wir selbst, die wir in der Erschlossenheit unseres Daseins leben, die auch noch unser eigenes Nicht-dagewesen-Sein umfaßt.
Was es heißt, Mensch zu sein, das läßt sich nicht auf dem Weg des Verfahrens von Versuch und Irrtum lernen — dergleichen kommt immer schon zu spät —, das ist uns vielmehr bereits uranfänglich anvertraut. Dabei stehen wir vor der Aufgabe, diese uranfängliche Selbsterschlossenheit weiter aufzuschließen und auszulegen im Rückgang und Rückbezug auf die ursprüngliche Erfahrung unseres Daseins — dem Staunen, daß es uns gegeben ist, zu sein, andere zu deren Sein freigeben zu dürfen, daß uns je und je der Raum geöffnet ist, dem Anruf des Guten tätig entsprechen zu können.
Selbsterschlossenheit ist nicht zu verwechseln mit einer Gefangenschaft in einer sogenannten Bewußtseinsimmanenz. Wir sind uns ja so gegenwärtig, daß uns darin jeweils anderes gegenwärtig ist und dies wiederum aus einem Beziehungsgeflecht von letztlich allumfassender Weite: Wir leben im verstehenden Bezug zum Ganzen des Seienden und sind die weit-offenen Wesen. Wir können nach schlechthin allem fragen. Dabei sind die Fragen, die wir stellen, gar nicht das erste, sondern vielmehr dies, das die Dinge von ihnen selbst her zu verstehen geben. Die Sprachlichkeit des uns Vorgegebenen (zu dem auch wir selbst gehören) ist das erste, unser vernehmendes Zur-Sprache-Bringen ist das zweite — freilich nicht hintereinander, sondern im Zumal, eines geschieht als das andere, das Zusprechen des Vorgegebenen ereignet sich als unser Ansprechen.
In einem ursprünglichen Sinn sind wir Menschen die dialogischen Wesen, diejenigen, welche die Sprache der Wirklichkeit zu vernehmen imstande sind. Wir sind die Wesen, welche mit dem Logos begabt sind — nicht mit einer freischwebenden Vernunft.
„Die“ Vernunft denkt nicht, sondern es sind je wir als konkrete leibhaftige Personen, die dazu aufgerufen sind: Die Vernunft denkt so wenig wie das Gehirn, der Erkenntnisapparat, der Weltbildapparat. (Mit dieser schlichten Tatsache wäre endlich einmal im Kontext von Problemstellungen wie „Vernunft und Evolution“ und ähnlichen ernst zu machen.)
Genaugenommen geht es gar nicht um „den“ Menschen. So gesehen ist schon die Frage „Was ist der Mensch?“ irreführend. Wir sind nicht Exemplare eines Gattungsallgemeinen. So erfahren wir uns auch nicht — wenn wir nur unserer Erfahrung Raum zu geben bereit sind, und nicht irgendwelche Theorien gescheiter sein lassen als unsere Erfahrung. (Theorien, in denen wir uns nicht wiedererkennen können, die uns einreden, wir seien gar nicht die, als die wir uns erfahren, sind als das zu nehmen, was sie sind: als leere Konstruktionen. Nicht aber hat die Konsequenz in einem theorie-konformen Verhalten zu bestehen.) Wir erfahren uns als Wesen von personaler Einmaligkeit und Unvertretbarkeit, begabt mit einer Würde, die keiner sich selbst gegeben hat und die auch keiner dem anderen schaffen kann.
Bleibendes Geheimnis
Würde ist niemals das Resultat einer kollektiven Anstrengung — dauere sie auch Äonen. Man kann Würde nicht herbeischaffen, man kann sie nur achten oder mißachten und in letzerem Fall schuldig werden. Kinder kommen zwar nicht zu ihrem Dasein, wenn ihre Eltern es nicht wollen, aber deswegen sind sie kein Produkt, das in der Disposition ihrer Erzeuger steht. Dem Zeugungsakt entspringt etwas erfahrbar Unableitbares: ein personales Wesen, das sich selbst erschlossen ist und bei aller Prägung durch naturale wie geschichtliche Vorgegebenheiten diese dennoch transzen-diert. Mit jedem Kind kommt etwas irreduzibel Neues in die Welt Es kommt freilich darauf an, dieses Neue auch in der Fülle seiner Dimensionen in den denkenden Blick zu bekommen! Mit dem Verweis auf die Eltern ist die Frage nach der Herkunft eines Menschen keineswegs schon beantwortet. Es steht ja nicht der Mensch in Frage, sondern jeweils du selbst, ich selbst, es geht je um deine, je meine Herkunft. Für das Du-Sein ihres Kindes kann sich kein Elternpaar als alleinigen Ursprung einsetzen. Zum Du-Sein gehört ja je meine Herkunft.
Es geht um die Herkunft einer namentlich zu nennenden Person in eben ihrer unvertauschbaren personalen Einmaligkeit. Für das Du-Sein ihres Kindes können sich deshalb die Eltern nicht als alleinigen Ursprung einsetzen. Zum Du-Sein gehört ja die rätselhafte Erschlossenheit des eigenen Nicht-dagewesen-Seins sowie des künftigen Nicht-mehr-Da-seins. Erst wenn all die genannten Bezüge bedacht sind, läßt sich in aller Behutsamkeit die Frage nach dem Woher unserer selbst stellen. Sie hat die Aufgabe, eben all die Bezüge verstehbar zu machen, in denen wir, die wir nach unserer Herkunft fragen können, uns erfahren.
Eine solche Frage ist freilich keine fachwissenschaftliche, kann sie auch gar nicht sein, weil sie dem bleibenden Geheimnis unseres Menschseins nachdenkt. Je tiefer in dieses hineinzuführen —. nicht von ihm wegzukommen, was ohnehin nicht geht - ist ihr Beweggrund. Dazu bedarf es allerdings der Bereitschaft zur Offenheit für das, was sich zeigt, und .zur Schau des Wirklichen — jener Schau, der auch der Lobpreis der Psalmisten entsprungen ist: „Ich schaue den Himmel, das Werk Deiner Finger, den Mond und die Sterne, die Du geschaffen. Was ist der Mensch, daß Du seiner gedenkst?“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!