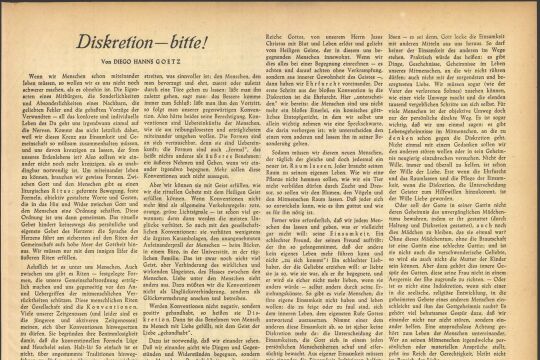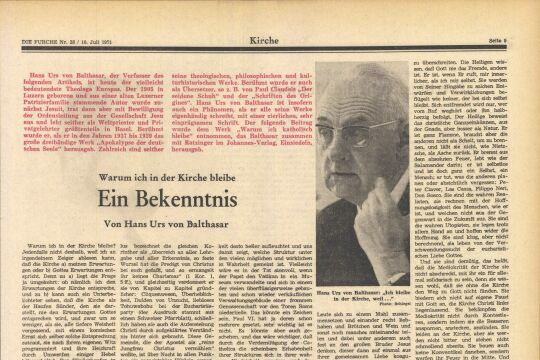Wem dient die Literatur?
Die Generalversammlung des polnischen Schriftstellerverbandes hat nach einerstürmischen Sitzung in diesen Tagen Jan JozefSzczepanski zum neuen Präsidenten gewählt. Der 1919 in Warschau geborene, auch im deutschen Sprachraum bekannte Schriftsteller bedankte sich mit einer mutigen Rede. Im Folgenden bringt di FURCHE, leicht gekürzt, ein Essay aus seinem Band,, Vor dem unbekannten Tribunal" (Suhrkamp- Verlag, Frankfurt/Main).
Die Generalversammlung des polnischen Schriftstellerverbandes hat nach einerstürmischen Sitzung in diesen Tagen Jan JozefSzczepanski zum neuen Präsidenten gewählt. Der 1919 in Warschau geborene, auch im deutschen Sprachraum bekannte Schriftsteller bedankte sich mit einer mutigen Rede. Im Folgenden bringt di FURCHE, leicht gekürzt, ein Essay aus seinem Band,, Vor dem unbekannten Tribunal" (Suhrkamp- Verlag, Frankfurt/Main).
Wem dient Literatur? Was soll sie sein?
Joseph Conrad hat ihre Funktion bestimmt als „der sichtbaren Welt Gerechtigkeit widerfahren lassen“. Der sichtbaren, also nur der den menschlichen Sinnen zugänglichen. Anscheinend legt diese zweifellos mit Nachdruck erwähnte Begrenzung ganz nüchtern die Prozeßbedingungen fest, läßt allein die Zeugnisse nachprüfbarer Konkreta zu und schließt jegliche metaphysischen Spekulationen aus. Doch Conrads Formel garantiert keineswegs jene ruhige Selbstgewißheit, die man sich durch den Aufenthalt in einem bekannten und genau inventarisierten Raum aneignet. Man weiß vor allem nicht, welcher Rechtskodex hier die Basis der Gerechtigkeit ist und wo die Berechtigung des Richters ihre Quelle hat. Denn wenn er Urteile über die Dinge der sichtbaren Welt fällt, muß er selbst über dieser Welt stehen - wie jeder Richter außerhalb des Prozesses steht, den er entscheidet - und zudem mit einem untrüglichen Maßstab für Wahrheit und Lüge versehen sein. Ist das Beziehen einer solchen Position keine Usurpation? Auf jeden Fall eine Mission impossible, was Conrad im übrigen bestimmt sehr genau wußte. Doch wußte er auch, daß die Usurpation die Berufung des Künstlers ist.
D ie Codices, nach denen wir leben sowohl die in Paragraphen gefaßten Rechtsvorschriften als auch die in Versen niedergeschriebenen der offenbarten Wahrheiten -, werden im Dienst der Alltagsgeschäfte trivialisiert. Es gab stets (und wird stets geben) das Gefühl für die Bruchstückhaftigkeit dieser Normen, ja für ihre Starrheit angesichts des unberechenbaren und nie bis ins Letzte erfaßbaren Elements der Wirklichkeit. Die Literatur muß sie in Frage stellen, und sei es nur, weil eine ihrer ersten Pflichten der Kampf um die Souveränität des Menschen ist, weil sie ihn herausholen muß aus der Sklaverei der Pakte, die er immer wieder -je nach den Umständen - mit sich selbst und mit der Welt schließt. Jeder weiß, wozu Pakte dienen. Sie schaffen den Anschein eines Sinnes unserer Existenz. Sie sind eine Art Bühnenkulisse, ein künstlicher Horizont; er verhüllt den wahren Horizont, zu dem aufzublicken wir nicht den Mut haben. Um uns im Leben sicher zu fühlen, begrenzen wir unseren Gesichtskreis und bemühen uns, diesen kleinen Ausschnitt möglichst eng mit Pflichten, Verboten und Feststellungen zu besetzen, die keine weiteren Fragen erfordern. Das ist unsere sichtbare Welt. Aber wenn in dieser Welt etwas Wichtiges geschieht, wenn darin dramatische Veränderungen vorgehen - und wir Menschen ha*- ben die Ehre einer anderen Geschichte als der biologischen Fortdauer der Arten -, dann deshalb, weil wir nie bis zum Schluß daran glauben können, daß unsere Fiktionen allein Rechtsgültigkeit besitzen können.
Welche Gerechtigkeit meinte Conrad? Er beanspruchte doch nicht das Recht, sich auf Mächte zu berufen, die seiner Erfahrung unzugänglich waren. Das hätte ihm seine Redlichkeit nicht erlaubt. Andererseits indessen erlaubte ihm sein Gefühl für Würde, dieses geheimnisvolle und erhabene Erbe
des Menschen, nicht, mit dem Leben in einer trivialen Welt einverstanden zu sein. Die Parabel der Reise durch unermeßliche Räume, immer angewiesen auf die Launen blinder Naturkräfte, war für ihn keine rhetorische Fiktion. Er wußte sehr wohl, was menschliche Kleinheit ist, und wußte auch, daß diese Kleinheit in sich die Chance der Größe birgt. „Der sichtbaren Welt Gerechtigkeit widerfahren lassen“ - das verstand er als Beurteilung ihrer Angelegenheiten vom Standpunkt dieser Chance aus. Doch was ist das Wesen dieser Chance? Worauf beruht sie?
Hält man Conrads Entscheidung ein, die Grenzen der sichtbaren Welt nicht zu überschreiten, kann man feststellen, daß das Wissen um die Existenz dieser Grenzen für ihn eine grundsätzliche Sache gewesen sein muß. Die Seefahrt- Analogie erweist sich hier erneut als hilfreich. Die Einsamkeit des Seemanns inmitten eines gleichgültigen Ozeans konnte kein sinnloses Verirrtsein bedeuten. Sie war eine Probe. Eine Probe auf Sinn und Ordnung, die wir in uns tragen, ohne ihr Wesen zu kennen. Es ist etwas, das wir mit den Wörtern Ehre, Treue und Mut benennen, nicht aber mit dem Wort Nutzen.
In Conrads Formel Präzision zu suchen, scheint ein hoffnungsloses Unterfangen. Doch steckt in ihr der blendende Glanz der Intuition. Denn er hat sie als Ganzes aus tiefster, persönlicher Erfahrung abgeleitet. Aus jenem Bewußtsein der Konfrontation. Und er hat wohl nichts anderes als dieses Bewußtsein zum Ausgangspunkt seines Kodex gemacht. Der sichtbaren Welt Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, besteht folglich darin, sie in der dramatischen Perspektive jener Proportion zu bemerken, die, unsere unendliche Geringfügigkeit enthüllend, dem Menschen Demut gebietet und ihm zugleich das Recht zum Stolz verleiht.
Auf die Frage, ob ich gläubig sei, konnte ich weder mit einem schlichten Ja noch mit einem schlichten Nein antworten. Das macht mich verlegen, weil wir im allgemeinen annehmen, solche schlichten Bejahungen oder Verneinungen seien Beweise für unsere innere Reife. Ich hege jedoch den Verdacht, daß sie sehr viel öfter ganz einfach Resignation bedeuten, die Wahl einer vereinbarten Konvention anstatt einer Überzeugung. Man akzeptiert sie wie Ausweise eines Verbandes oder einer Partei, weil der Mensch irgendwo hingehören muß, um nicht der Vereinsamung zu verfallen. Sehr oft also ist der Charakter dieser Optionen ausschließlich gesellschaftlich oder politisch, womit man nur einverstanden sein kann, wenn man gleichzeitig mit der Zufälligkeit unserer Existenz einverstanden ist. Doch auch wenn man es im Namen der Vernunft ablehnt, sich für irgendeine Seite zu entscheiden (da ja eine Aussage über Dinge, die die Möglichkeiten unserer Vernunft überschreiten, ein sinnloses Unternehmen sei), bedeutet das eine Kapitulation, die von Kleinmütigkeit und Bequemlichkeit diktiert wird. Das Bekenntnis „credo quia absurdum“ erfordert eine heroische Demut, zu der wir immer weniger fähig sind, und Conrads stolzes „Handle so!“, verbunden mit dem Verzicht auf das Recht zu metaphysischen Tröstungen, geht über die Kraft der meisten von uns. Außerdem untergräbt der moderne wissenschaftliche Skeptizismus, als Einstellung weit über die Kreise hinaus verbreitet, die sich wirklich mit der Wissenschaft befassen, sowohl den Glauben wie auch den programmatischen Unglauben. Wir leben in Zeiten einer großen Enttäuschung.
Ja, wir sollten doch die glücklichen Erben der Hoffnungen jener aufgeklärten Propheten sein, die die Bande des dunklen Aberglaubens der Vergangenheit zerbrachen und der Vernunft Altäre errichteten. Unsere Zeiten sind die
Zeiten, da sich ihre Utopien erfüllen sollten. Muß man hier wiederholen, daß weder die Erforschung der Geheimnisse des Atommodells noch das Verlassen der Bahn unseres Planeten uns klargemacht hat, wer wir eigentlich sind und welchen Sinn unsere Existenz hat? Und daß unsere herrlichen Errungenschaften uns noch nicht die Kunst gelehrt haben, ein Leben zu führen, wie es vernünftigen Wesen gemäß ist?
W ir sprachen über die Literatur. Über ihre Berufung. Und hier, im Bereich dieser Fragen, dieser Verunsicherungen, sind wir dem Kern der Sache wohl am nächsten. Darum lenkt die Frage, ob ich gläubig sei, nicht vom Thema ab. Zumal sie keine formal bestimmte Denomination betraf. Es geht nicht um die Heilige Dreifaltigkeit, die Unbefleckte Empfängnis oder die Auferstehung des Leibes, um keines von jenen Dingen, über die der Verstand (und mit ihm auch der gute Wille) des modernen Christen stolpert, sondern um etwas Universales und im Menschen Ursprüngliches. Um eine elementare, keiner Reduktion unterliegende Haltung. Ich glaube, diese Situation ist in gewissem Umfang typisch. Die Ära der auserwählten Völker, des ausschließlichen Erbes einziger und unerschütterlicher Wahrheiten geht endlich zu Shde. Unsere zerstrittene Welt mit ihren fanatischen Antagonismen ist jedoch schon zu klein, um sich der Erosion des Relativismus mit Erfolg zu widersetzen. Haben wir vielleicht alle ein wenig teil an einer richtigen Vorahnung? Oder sind vielleicht die Wahrheiten der anderen wahrer als unsere?
Wir drängen uns heute nicht danach, Gesetze zu geben oder zu richten oder auch nur zu belehren. Vielleicht weil man in letzter Zeit zu oft versucht hat, uns allerlei Botschaften in den Mund zu legen, und sicher auch, weil unsere Zeit immer schneller läuft und die Anstrengung, die nötig ist, um uns in der Strömung zu halten, die Einnahme einer hieratischen Haltung erschwert. Wir gehören mehr zur Gattung der nervösen und eingeschüchterten Zeugen; Wir spüren, daß die Welt ohne unsere Aussagen die Form verliert. Ohne sie platzt die Kontinuität der Erinnerung (trotz der Archive voll registrierter Fakten), stirbt die Phantasie ab, durch die wir in der Wirklichkeit verständliche Muster erkennen, und bleiben die utilitären Erfordernisse des Augenblicks die einzige moralische Sanktion. Doch die Last der Verantwortung schreckt uns.
]ßezeugen heißt, sich um die Feststellung der Wahrheit zu bemühen. Wäre sie bekannt, wären wir nicht nötig. Und wir sind nicht nötig - sowohl für jene, die meinen, Mühe lohne sich nicht, als auch für jene, die glauben, sie besäßen die Wahrheit, und die von uns nur Bestätigungen erwarten. Wir müssen die Lächerlichkeit riskieren, denn wir kennen Unsere Ratlosigkeit und verlieren dennoch nicht die Hoffnung.
Ich schreibe diese Worte nicht ohne Furcht und mit einem vorsichtigen Zögern, weil ich mich wie jemand fühle, der in einem dunklen Zimmer eingeschlossen ist, langsam auf den Zehen vorangeht und Wände und Gegenstände mißtrauisch abtastet. Ich weiß um die Unverschämtheit, deren ich mich schuldig mache, wenn ich bei der Darstellung dieser Situation die Mehrzahl benutze. Und dennoch liefert die Literatur, die ein Zeugnis für unsere Zeiten ablegt, immer wieder Beweise Tür diese angespannte Erwartung. Zusammen mit Samuel Beckett warten wir auf Godot. Jeder auf seine Weise. In Demut oder Erregung, in Hoffnung oder Angst, mit Resignation, Ungeduld, Verzweiflung oder Zorn - und häufig mit dem Lächeln der Herausforderung oder des Spotts.