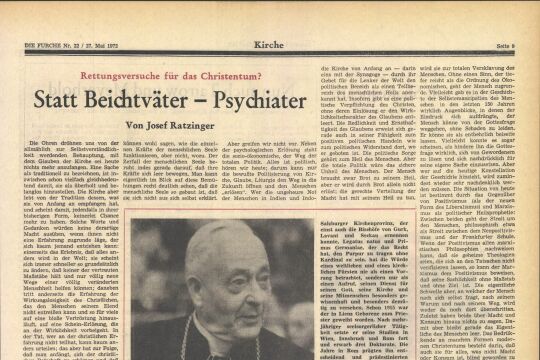Wo immer das Rätsel der Zeit in unser Bewußtsein tritt, befallt uns Unsicherheit und eine letzte Unruhe. Die Konstanten unserer Weltorientierung, Zahl und Idee, Wort und Verstand, lassen uns im Stich. Hinter all diesen Identitäten und Verläßlichkeiten, die sich wie in einem letzten kristallinischen Punkt in der unauslöschlichen Selbstgewißheit des Ich, des Jetzt, des Hier zusammenziehen, kommt alles ins Schwanken.
Da schweift Erinnerung ins Dunkel der Vergangenheit, Hoffnung tastet in das Dämmern einer ungewissen Zukunft, es ist ein ständiges Wechseln von Helligkeiten und Schatten, ein ungewisses Flimmern - und das soll „Ich“ sein, dieser Eine, mit mir selber identisch, diese einmalige Person! Und Person heißt: für sich stehen, für sich einstehen, stehen. Stehen, wo alles fließt, wo nicht ein Haar auf unserem Kopfe dasselbe bleibt - was sage ich: nicht ein einziges Stückchen unserer eigenen Leibmaterie das gleiche bleibt im Stoffwechsel des Lebens, und die eigene Biographie erst recht nur in einzelnen Lichtflecken in uns hell wird, wie Schaumkronen über einer ungewissen Tiefe. Und vollends, wie ist dies bißchen Individualgeschichte eingebettet und bis zur Unkenntlichkeit eingeschmolzen in unser gesellschaftliches Dasein und seinen geschichtlichen Stromlauf?
Schon in unserem Sein für andere, für unsere Nächsten, und erst recht im Rollenspiel des gesellschaftlichen Daseins, sehen wir uns durchaus nicht so, wie wir sind, und wenn wir uns selber begegneten - so wie wir im Zeitalterder Reproduzierbarkeit unsere eigene Stimme im Radio zu unserem Erschrecken und mit Befremdung hören können -, wir würden uns nicht erkennen, wir würden uns ableugnen. Ist es doch schon ein langer Bildungsprozeß, daß wir lernen, den anderen oder das Vernünftige gegen unsere eigenen Vorurteile und Interessen überhaupt wahrzunehmen - uns selber lernen wir nie wirklich kennen.
Und doch, gerade weil wir nicht dieses seiner selbst gewisse Selbst sind, auf das wir uns so gern berufen wie auf eine letzte Instanz aller Gewißheit - gerade weil wir dahintreiben alle unterschiedslos, von dem lautlosen Strömen der Zeit ständig versetzt, sind wir selbst auf Unterscheiden aus. An dem einen liegt uns mehr als an dem andern, und wir halten mit Entschiedenheit an ihm fest.
Das aber heißt: als die Unterscheidenden sind wir immer zugleich die Scheidenden. Das prägt aufs tiefste unsere eigene Daseinserfahrung als Erfahrung unserer Zeitlichkeit und Endlichkeit. Stets sind wir die Scheidenden: „So leben wir und nehmen immer Abschied.“ Denn Wählen ist immer Scheiden, Aufgeben von etwas zugunsten von etwas anderem. Auf dem Grunde der inneren Gewißheit unserer selbst liegt daher eine letzte besorgte Ungewißheit, die in der besonderen Zeitlichkeit entspringt, die die unsere ist. Unserer Auszeichnung, wählen zu können, entspricht die Vagheit unserer Wünsche und das Schwanken unserer Vorlieben und unserer Vorzugswerte. Ständig müssen wir wählen, und wählen heißt: es nicht beim Alten lassen, sondern ungewiß Neues wählen.
Das Gleichgewicht, das alle Ordnungsformen durch waltet, scheint auch noch unser Lebensbewußtsein zu beherrschen: wo Zukunft dahinschmilzt, türmt sich Vergangenheit zu dem Riesengebirge eines unbetretbaren Damals. Aber wie ungleich sind dennoch die Horizonte unseres Bewußtseins: die Offenheit der Zukunft ist die Helle unseres Daseins selber, das Leben von Erinnerungen ist wie ein Träumen, das sich selbst vergißt. Die Offenheit für das Neue, das Leben in Erwartung ist unsere ständige Gegenwart, Erinnerung meint ein dem Vergessen gelegentlich abgewonnenes Damals.
Wenn Jungsein und Altsein solche Horizonterfahrungen sind, so heißt das zugleich, daß Jugend und Alter nicht durch den Kalender ihre Bestimmtheit gewinnen. Jungsein heißt Offensein, für den anderen, für das andere. Das schließt ein, daß alt und jung relativ sind und daß diese Relativität keine quantitative ist, also nicht wie großklein, lang-kurz, viel-wenig, die auf meß- und zählbare Quantitäten beziehbar sind und an ihnen ihre Relativität verlieren. Die Relativität von alt und jung ist von unaufhebbarer Art.
Das gilt nun erst recht für die Relativität von alt und neu, die nicht wie die von alt und jung eine vorgegebene Horizontverschiebung artikuliert, sondern Begegnungsqualitäten bezeichnet, die sich in jedem Augenblick unserer Welterfahrung bilden. Das Neue ist das, was in jedem Augenblick geschieht und als Jetzt eben“ erfahren wird. Unaufhaltsam sinkt alles andere in die Gleichgültigkeit des bereits Bekannten oder Gewohnten zurück. Aber gerade das macht die Erfahrung des Neuen - wie die des von ihm beschatteten Alten - zutiefst zweideutig, daß alles Neue unaufhörlich veraltet. Es ist das Rätsel der Zeit, daß sie das reine Vergehen ist und selber kein Entstehen kennt.
Damit relativiert sich Altes und Neues ganz und gar. Es gibt die Abwertung des Neuen und des Neuerers. Nicht minder entschieden ist auch die Gegenhaltung, zum Beispiel die Ablehnung antiquierter Ideale.
Es gibt gute Argumente für beides. Die Lobredner des Alten können sich darauf berufen, daß es sich bereits bewährt hat, nichts Unbekanntes, Unerprobtes ist, wo doch das Neue immer etwas Gewagtes sei. Umgekehrt bildet die Beharrlichkeit des Alten oft den unvernünftigsten Widerstand gegen jede Neuerung und enthält ihr die Bewährung vor, die sie vielleicht glänzend bestünde. Das geschichtliche Leben der Menschen scheint zwischen diese Extreme eingelassen und ist immer aufs neue ihr Ausgleich.
„Immer aufs neue“: Die Wendung verrät uns: Nicht das Alte und das Neue stehen zur Wahl, sondern dieses oder jenes, das etwas verspricht und weil es etwas verspricht. Es kann auch etwas Altes sein. Es ist in Wahrheit nie die Wahl zwischen dem Alten und dem Neuen: nicht als das Alte steht das Alte zur Wahl. Als das Alte ist es vielmehr in die Selbstverständlichkeit seines Gewohntseins eingegangen.
Nur im Lichte neuer Möglichkeiten kann es überhaupt als Gegenmöglichkeit zur Wahl gestellt werden und zum Bewußtsein kommen. Es wäre ein Irrtum, sich die Wahlsituation so vorzustellen, als ob es nicht immer um Möglichkeiten des Zukünftigen ginge, ganz gleich, ob es sich um die Erhaltung des Alten, das das Neue niederhält, oder um die Verwerfung des Alten zugunsten des Neuen handelt: Eben das ist die Erfahrung, die die Zeit für uns ist, daß ihre beiden Dimensionen, Zukunft und Vergangenheit, nie Gegenwart sind, das heißt aber, daß sie nicht wie zwei gleiche Möglichkeiten vor uns stehen. Das eine ist das Mögliche, das Vergangene ist das ganz und gar Unmögliche. Selbst ein Gott kann das Geschehene nicht ungeschehen machen. Was vor uns steht, ist das, was uns bevorstehen mag. Selbst wenn es etwas Altbekanntes ist, was bevorsteht, ist es nicht mehr das Gewohnte und Bekannte, sondern erscheint in einem neuen Licht.
Hier entspringt die bekannte Dialektik der Rückkehr. Für das geschichtliche Wesen gibt es kein Zurück. Auch Rückkehr ist kein bloßes Zurück, und ebenso ist Wiederholung keine Wiederkehr des Gleichen. Darin liegt, daß die Relativität des Alten und Neuen noch weit radikaler ist als die von alt und jung.
Wir sahen ja: auf das Neue ist die offene Erwartung gerichtet, das Alte sinkt in die Selbstverständlichkeit des Gewohnten herab, auch wenn das jeweils Neue rasch veraltet und das Alte sich als „beständig“ erweist. Was hält sich in diesem Fluß? Was läßt sich nicht durch das Neue, nur weil es neu ist, verdunkeln und umgekehrt was wird nicht verworfen, nur weil es nicht das Alte ist?
Das, was wir Kultur nennen, ist der unablässige Versuch, auf diese Frage praktische Antworten zu geben. Kultur ist nicht, ohne daß sie solche Antwort ist. Da sind zwar die dauerhaft scheinenden Ordnungsformen unseres Lebens, Staatsordnung und Rechtsordnung, Wirtschaftssystem und die Einrichtung unserer Arbeitswelt, und daneben die Freizonen von Kult und Feier, von Kunst und Spiel. Aber all das hat nicht als solches Bestand und bedeutet nicht als solches einen sicheren Halt im Flusse der Zeit.
Alles ist in Wahrheit veraltet, das nicht in jedem Augenblick neu ist und aufs Neue seinen Bestand beweist. Restauration und Revolution haben beide Unrecht. Es gibt nicht das Alte, das gut ist, weil es alt ist, und nicht das Neue, das gut ist, weil es nicht alt ist, wohl aber gilt: Beides, das Alte und das Neue, drängen sich ständig vor und verstellen sich gegenseitig.
Das war immer so. Keine Neuerung setzt sich ohne Widerstand durch. Ja, am Ende muß man sagen: je geringer der Widerstand ist, den das Neue findet, je schneller das Neue sich durchsetzt, desto schneller eilt es selber zum Veralten.
Das Neue scheint geradezu aus dem Alten seine Kraft zu ziehen, so daß es Bestand gewinnen kann. Das zwingt zu nachdenklichen Überlegungen. Wir leben in einem Zeitalter der technischen Multiplikation alles Neuen - in dem auch das Alte mit Neuheitswerten aufgeputzt wird, die nicht die seinen sind - und in einem Zeitalter der Allvergegenwärtigung auch des Fernsten, das wie das Neueste auf uns zukommt.
Alle Maßstäbe haben sich verändert. Die industrielle Revolution wird zum Weltenschicksal. Traditionen lösen sich auf, ohne daß Neues als Überzeugendes eintritt. Das Neue wird vielmehr zur Wiederkehr des Gleichen, auch wenn und gerade wenn es einer ungehemmten Freiheit des Experimentierens entspringt. Die Welt wird sich überall immer ähnlicher. Ist eine Nivellierung aller Lebensformen im Werden? Oder wird sich unter der Oberfläche der technischen Uniformität neuer Ausgleich zwischen Altem und Neuem, neue „Kultur“ bilden? Wir wissen nicht, wie die Menschheit mit der Einrichtung des Lebens auf diesem Planeten fertigwerden wird. Aber ich meine, eins können wir wissen, daß die produktiven Antworten, die die Zukunft auf diese Frage bringen mag, davon abhängen, daß diese Zukunft aus ihrer eigenen Vergangenheit kommt.
Man mag über Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben noch so kontroverse Gedanken haben; mancher mag sich zurücksehnen nach der rührenden Unschuld des Sich-Selberwol- lens, die uns an älteren Zeichen und Bildern so ergreift; mancher mag umgekehrt den Druck der Vergangenheit ganz abwerfen wollen und wie von neuem zu beginnen meinen - es hilft nichts.
In der neuen Bewußtheit, die das Alte als Altes wahrzunehmen weiß und Neues als Neues, stehen wir mitten innen. Umrahmt von altem Gemäuer, erfüllt von alten Klängen, gepackt von alten Spektakeln blicken wir alle nach vorn, dem neuen Tag entgegen: „Ein jeder sei auf seine Weise ein Grieche, aber er sei es!“ - das war die klassische Lösung, die der Streit zwischen dem Alten und dem Neuen am Ende des 18. Jahrhunderts fand, In unserer ins Maßlose veränderten Welt wird der Streit zwischen dem Alten und dem Neuen freilich unter anderen Maßstäben ausgetragen. Aber die Lösung bleibt die gleiche „Ein jeder sei es!“
Hans-Georg Gadamer. 1900 in Marburg geborener Philosoph, lebt in Heidelberg und war dort ab 1949 Nachfolger von Karl Jaspers.