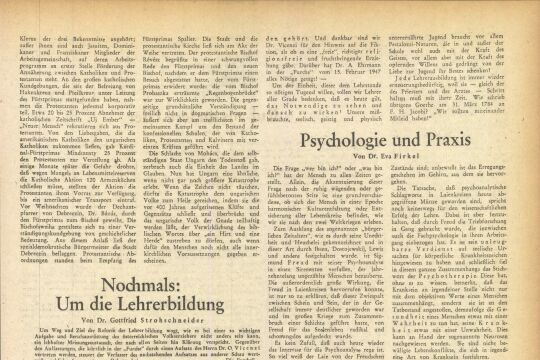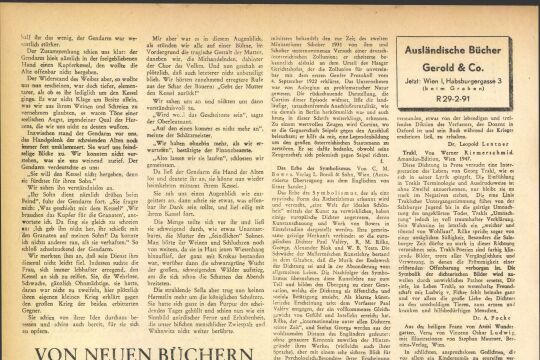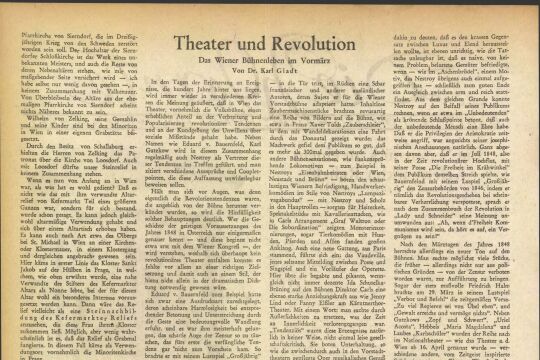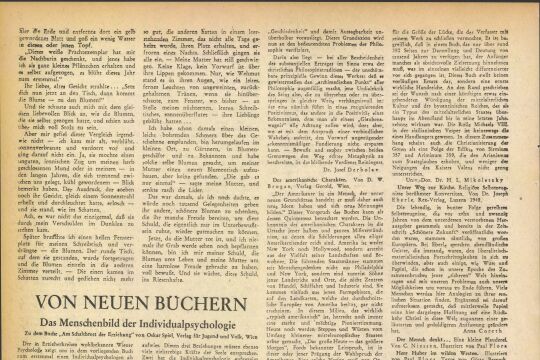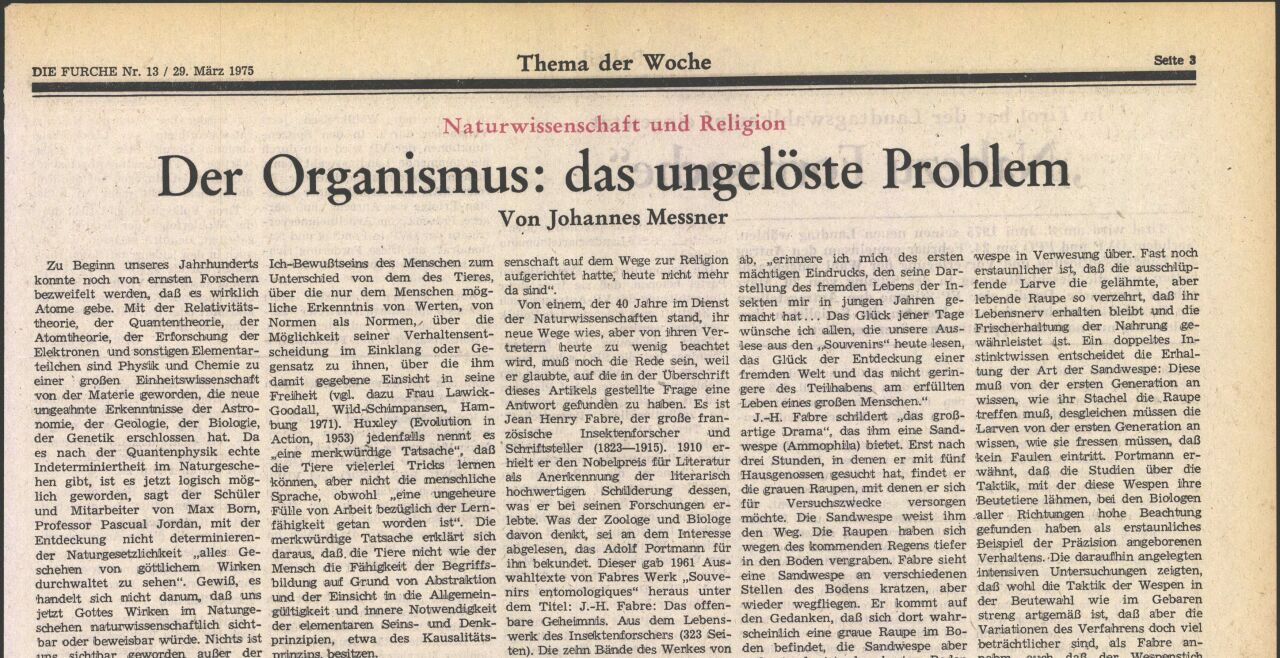
Zu Beginn unseres Jahrhunderts konnte noch von ernsten Forschern bezweifelt werden, daß es wirklich Atome gebe. Mit der Relativitätstheorie, der Quantentheorie, der Atomtheorie, der Erforschung der Elektronen und sonstigen Elementarteilchen sind Physik und Chemie zu einer ' großen Einheitswissenschaft von der Materie geworden, die neue ungeahnte Erkenntnisse der Astronomie, der Geologie, der Biologie, der Genetik erschlossen hat. Da es nach der Quantenphysik echte Indeterminiertheit im Naturgeschehen gibt, ist es jetzt logisch möglich geworden, sagt der Schüler und Mitarbeiter von Max Born, Professor Pascual Jordan, mit der Entdeckung nicht determinierender Naturgesetzlichkeit „alles Geschehen von göttlichem Wirken durchwaltet zu sehen“. Gewiß, es handelt sich nicht darum, daß uns jetzt Gottes Wirken im Naturgeschehen naturwissenschaftlich sichtbar oder beweisbar würde. Nichts ist uns sichtbar geworden außer der mathematischen Gesetzlichkeit der Wahrscheinlichkeit von Quantensprüngen. Das ist eine Gesetzlichkeit von hoher mathematischer Schönheit und Harmonie — man kann in ihr, wie Kepler, einen Ausdruck göttlichen Schöpferwillens sehen, aber man muß es nicht — jedenfalls nicht im Sinne eines Müssens aus logischer, denkgesetzlicher Notwendigkeit.
Ebenso kann man (ahne es logisch zu müssen) in der übermächtigen Fülle' ständig neuer indeterminierter Entscheidungen göttliches Wirken, göttliche Fügung und Herrschaft sehen — „creatio continua“. Pascal Jordan steht in der Reihe derer, die selbst Bedeutendes zur letzten Entwicklung der naturwissenschaftlichen Erkenntnis beigetragen haben. Noch immer gehören allerdings Na_ turwissensichaftler, besondere in So-wjetrußländ und Kontinentalchina, zu den härtesten Geignern des Got~ tesglaubens. Andere wallen sich eine neue Religion eben mit einem wis-senschaftsgläulbigen (szientisttschen) Humanismus schaffen. Der jüngst verstorbene Engländer Professor Julian Huxley, 1948 Generaldirektor der UNESCO, kommt in seinem Buch „Evolution, the modern Syntihesis“ (1. Auflage 1942), in dem er den Stand der Evolutionstheorie zusammenfaßt, zum Ergebnis, der Mensch sei eine hochentwickelte Art der Wirbeltiere, der evolutionäre Humanismus könne zum Kern einer neuen Religion werden, mit der Pflicht des Menschen zur Fruchtbarmachung seiner noch unerschlossenen Kräfte. Die Evolution sei genau so ein Produkt blinder Kräfte wie das Fallen eines Steines zur Erde. Wir selbst seien es, die in die Evolution einen Sinn hineinlegen müssen. Ein anderer Neodarwinist, Professor D. M. S. Watson, sagt näherhin: „Evolution selbst wird von den Zoolagen nicht angenommen, weil ihr Vorkommen beobachtet oder durch logisch zureichende Argumente belegt ist“, sondern weil keine andere Erklärung glaubhaft sei, die einzig mögliche andere Erklärung, die besondere Erschaffung (des Menschen), sei klarerweise unglaubhaft (British Association für the Advan-cement of Science, Report on the 97th Meeting).
Katholischerseits ist die Haltung gegenüber der Evolutionstheorie keine andere als die jener Wissenschaftler, die nach ihrer Begründung fragen. Nach dem Stand der heutigen Kenntnis der Tatsachen- und Ursachenzusammenhänge ist die Evolutionstheorie eine Hypothese, für die keine zwingend beigründenden Tatsachen nachweisbar sind. In der Entwicklungsreihe, die nach der Evolutionstheorie vom Menschenaffen zum Menschen führt, fehlt vor allem das Sprechvermögen. Angesichts der begrenzten Erfolge, Schimpansen die Taufostummensprache beizubringen, bleiben Fragen offen wie die über den fehlenden Zusammenhang ihres Sprechens mit dem Erkennen 'Und Verstehen der Dinge der Außenwelt, über die andere Art des Ich-Bewußtseins des Menschen zum Unterschied von dem des Tieres, über die nur dem Menschen mögliche Erkenntnis von Werten, von Normen als Normen,, über die Möglichkeit seiner Verhaltensentscheidung im Einklang oder Gegensatz zu ihnen, über die ihm damit gegebene Einsicht in seine Freiheit (vgl. dazu Frau Lawick-Goodall, Wild-Schimpansen, Hamburg 1971). Huxley (Evolution in Action, 1953) jedenfalls nennt es „eine merkwürdige Tatsache“, daß die Tiere vielerlei Tricks lernen können, aber nicht die menschliche Sprache, obwohl „eine ungeheure Fülle von Arbeit bezüglich der Lernfähigkeit getan worden ist“. Die 'merkwürdige Tatsache erklärt sich daraus, daß. die Tiere nicht wie der Mensch die Fähigkeit der Begriffsbildung auf Grund von Abstraktion und der Einsicht in die Allgemeingültigkeit und innere Notwendigkeit der elementaren Seins- und Denkprinzipien, etwa des Kausalitäts-prinzips, besitzen.
Wer das Geistige aus dem Biologischen abzuleiten versucht, müßte die Tatsache erklären, daß, wie der englische Nabelpreisträger,, der Ner-venphysiolQge Charles Sherrington (Man on his Nature, 1952) es ausdrückte, im Einzelmenschen „der Geist ex nihilo wieder da zu sein scheint bei jeder Wiederholung des Somatischen, nachdem dieses ein gewisses Entwicklungsstadium erreicht hat“. Der Naturforscher, der mit biologischen Kategorien' an die Untersuchung der menschlichen Natur herangeht, findet eine Reihe von Tatsachen, denen zufolge er im Menschen etwas anderes zu sehen genötigt ist als im Tier. Nach dem Baseler Zoologen und Biolqgen Adolf Portmann (Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen 3. Auflage „1969) sind solche Tatsachen die für den Menschen nach der Geburt erforderliche lange Zeit bis zur Vollentwicklung der für ihn artgemäßen Haltung und Bewegung das Vorhandensein psychischer Vorgänge des Verstehens im Kleinkind vor der Befähigung zu deren Ausdruck in Worten, der Mangel einer dem Menschen zugeordneten Umwelt, die sich zu schaffen aber der Mensch kraft seiner geistig-schöpferischen Anlage befähigt ist. Man habe diese Unterschiede kaum beachtet, „weil man eben im Affenkind vor allem das sehen wollte, was sich als Vorstufe einer Menschwerdung deuten ließ“. Die Faktoren, die für die Entwicklung des Menschen bestimmend sind, haben, sagt Portmann,, in der Evolutionstheorie 'keinen Platz: das Tier finde sich in seiner Entwicklung immer in der gleichen Ausgangssituation, anders der Mensch, der über die Wortsprache und die Tradition verfügt.
Für das kausalgesetzlich deterministische Denken erschien noch um die Jahrhundertwende die den Menschen auszeichnende Willensfreiheit als etwas naturwissenschaftlich Unmögliches. Der in unserem Jahrhundert erzielte Fortschritt der naturwissenschaftlichen Erkenntnis ließ einen der Großen in ihrem Bereich, James Jeans (Physics and Philosophy 1942) vorsichtiger urteilen: „Die klassische Physik schien das Tor zu irgendeiner Art von Willensfreiheit völlig zu versperren; die neue Physik tut kaum so; sie scheint fast nahezulegen, daß das Tor aufgeschlossen werden könnte — wenn wir nur den Türgriff zu finden vermöchten.“ Die Willensfreiheit ist nur als WUlens-kausalität zu erklären.. Vielleicht liegt dieser Türgriff nicht weit von jenem zur religiösen Frage. Über neue Perspektiven in letzterer Hinsicht unterrichten die eingangs erwähnten Sätze aus dem Büch von Pascual Jordan „Der Naturwissenschaftler vor der religiösen Frage, Abbruch einer Mauer“. Seit 1963 in fünf Auflagen erschienen, befaßt es sich nicht mit der religiösen Frage selbst. Jordan beschränkt sich streng auf seine Zuständigkeit als Naturwissenschaftler, sein Zweck ist, „darzulegen, daß alle Hindernisse, alle Mauern, welche die ältere Naturwissenschaft auf dem Wege zur Religion aufgerichtet hatte, heute nicht mehr da sind“.
Von einem, der 40 Jähre im Dienst der Naturwissenschaften stand, ihr neue Wege wies, aber von ihren Vertretern heute zu wenig beachtet wird, muß noch die Rede sein, weil er glaubte, auf die in der Uberschrift dieses Artikels gestellte Frage eine Antwort gefunden zu halben. Es ist Jean Henry Fabre, der große französische Insaktenforscher und Schriftsteller (1823—1915). 1910 erhielt er den Nabelpreis für Literatur als Anerkennung der literarisch hochwertigen Schilderung dessen, was er bei seinen Forschungen erlebte. Was der Zoologe und Biologe davon denkt, sei an dem Interesse abgelesen, das Adolf Portmann für ihn bekundet. Dieser gab 1961 Aus-' wahltexte von Fabres Werk „Souvenirs entomologiques“ heraus unter dem Titel: J.-H. Fabre: Das offenbare Geheimnis. Aus dem Lebenswerk des Insektenforschers (323 Seiten). Die zehn Bände des Werkes von Fabre, die in 40 Jahren seiner Insektenforschung .entstanden sind, fassen viertausend Seiten. Gegenstand von Fabres Forschen war, sagt Portmann, die Strenge des instinktiven Verhaltens, dessen Vererbung von einer Generation zur anderen,die der Arterhaltung dienende sinnvolle Fügung aller Geschehnisse des Insektenlebenis. Das Entstehen der höhen Ordnung, die er fand, mit der Mutation und Selektion zu erklären, schien Fabre unimöglich. Darwin selbst hat ihn den unübertroffenen Beobachter genannt, war aber auch beunruhigt über seine Einwände gegenüber der Selektion. Die Kritik hat, sagt Portmann, im halben Jahrhundert seit seinem Tode manche Revision von Einzelheiten gebracht; das sollte uns bei einem Lebenswerk, dessen Publikation sich über vierzig Jahre erstreckte, nicht wundern; in den Anmerkungen habe er, wie Portmann vermerkt, da und dort auf spätere Korrekturen an Fabres Werk hingewiesen. Fabres Berichte bauen auf einer sorgfältigen Beobachtung auf, „entspringen zugleich aber auch der Überzeugung von der durch den Schöpfungsplan fixierten Eigenart jeder tierischen Lebensform. So sucht und findet er vor allem das artgemäß Konstante, das Unabänderliche der Instinkthandlungen. In unseren Tagen habe die Entwicklungstheorie ihre Stunde, bemerkt Portmann, und helfe uns, neue Möglichkeiten für das Verständnis der Lebensformen durchzuproben, wir werden aber darüber nicht vergessen, daß auch die Konstanz der Vererbung, die Bewahrung des Bestehenden eine Tatsache ist, und werden daher der Denkart Fabres ihr Recht zugestehen müssen. Mit seiner Forschung, die das Gebaren ins Zentrum rückt, habe Fabre einer neuen Forschungsrichtung den Weg bereiten helfen: noch bevor das Wort Verhaltensforschung in Gebrauch war, das heute diesen Zweig der Biologie benennt, habe J.-H Fabre Verhaltensforschung betrieben. „Wie gut, schließt Pontenann sein Schlußkapitel ab, „erinnere ich mich des ersten mächtigen Eindrucks, den seine Darstellung des fremden Lebens der Insekten mir in jungen Jahren gemacht hat... Das Glück jener Tage wünsche ich allen, die unsere Auslese aus den „Souvenirs“ heute lesen, das Glück der Entdeckung einer fremden Welt und das nicht geringere des Teilhaber am erfüllten Leben eines großen Menschen.“
J.-H, Fabre schildert „das großartige Drama“, das ihm eine Sandwespe (Ammophiia) bietet. Erst nach drei Stunden, in denen er mit fünf Hausgenoasen gesucht hat, findet er die grauen Raupen, mit denen er sich für Versuchszwecke versorgen möchte. Die Sandwespe weist ihm den Wag. Die Raupen haben sich wegen des kommenden Regens tiefer in den Boden vergraben Fabre sieht eine Sandwespe an verschiedenen Stellen des Bodens kratzen, aber wieder wegfliegen. Er kommt auf den Gedanken, daß sich dort wahrscheinlich eine graue Raupe im Boden befindet, die Sandwespe aber außerstande ist, den harten .Boden aufzugraben, also tut er es vorsichtig mit seiner Messerspitze und findet überall, wo die Sandwespe am Werke war, eine graue Raupe im Boden. Er überläßt eine der Raupen der Sandwespe und schildert in vier Abschnitten seine Beobachtungen: Die Sandwespe packt die Raupe mit den gebogenen Zangen ihrer Kiefer im Nacken. Ihr Stachel erreicht die Gelenkstelle, die den ersten Ring der Raupe vom Kopf trennt, „in der Mitte, wo die Haut etwas zart ist“. Die Sandwespe läßt nun ihre Beute liegen und ergeht sich in ausgelassener Freude über den errungenen Sieg über den Riesen. Sie packt nun die Raupe und sticht in den zweiten Rin£ dann in den nächstfolgenden Ring, immer auf der Bauchseite. „So werden drei Brustringe mit Füßen, die zwei folgenden,, die keine haben, und die vier folgenden mit Scheinfüßen einer nach dem anderen gestochen. Im ganzen also neun Stiche.“ Nach dem ersten Dolchstoß ist der Widerstand der Raupe belanglos. Zuletzt öffnet die Sandwespe ihre Kieferzangen weit, packt den Kopf der Raupe und drückt ihn zusammen, doch ohne ihn zu verletzten, •mit ausstudierter Langsamkeit, damit nicht der Tod des Beuteltieres riskiert wird. Die Sandwespe läßt dann ihr Opfer liegen und kehrt zum vorbereiteten Nest zurück, wo Sie im Hinblick auf die Einlagerung des Wilds noch einige Verbesserungen vornimmt. „Diese Beobachtung der einen Sandwespe dauerte unausgesetzt von ein Uhr mittags bis um sechs Uhr abends.“
Die Sandwespe schleppte die Raupe in den mit erstaunlichem Raffinement gebauten Unterschlupf. Sie ist gelähmt, alber nicht getötet, denn auf sie legt die Sandwespe ihr Ei. Der aus dem Ei ausschlüpfenden Larve soll die Raupe zur Nahrung dienen. Die Stiche müssen an bestimmten Punkten im Nervensystem der Raupe erfolgen, so daß diese unbeweglich ist, aber nicht stirbt, sonst ginge mit ihr das auf ihr liegende Ei der Sandwespe in Verwesung über. Fast noch erstaunlicher ist, daß die ausschlüpfende Larve die gelähmte, aber lebende Raupe so verzehrt, daß ihr Lebensnerv erhalten bleibt und die Frischerhaltung der Nahrung gewährleistet ist. Ein doppeltes Instinktwissen entscheidet die Erhaltung der Art der Sandwespe: Diese muß von der ersten Generation an wissen, wie ihr Stachel die Raupe ■treffen muß, desgleichen müssen die Larven von der ersten Generation an wissen, wie sie fressen müssen, daß kein Faulen eintritt Portmann erwähnt, daß die Studien über die Taktik, mit der diese Wespen ihre Beutetiere lähmen, bei den Biologen aller Richtungen hohe Beachtung gefunden haben als erstaunliches Beispiel der Präzision angeborenen Verhaltens. -Die daraufhin angelegten intensiven Untersuchungen zeigten, daß wohl die Taktik der Wespen in der Beutewahl wie im Gebaren streng artgemäß ist, daß aber die Variationen des Verfahrens doch viel beträchtlicher sind, als Fabre annahm, auch daß der Wespenstich sicher oft die Ganglien des Opfers nicht erreicht und die Lähmung der Beute dann auf der Ausbreitung des Giftstoffes beruht. Trotzdem sei, sagt Portmann, das ganze Werk Fabres „ein einziges Dokument der Lenkung dieser Tierleben durch ererbte Instinkte — eines der größten Zeugnisse vom Nichtmenschlichen.“ Fabre erblickt eine Ordnung von solcher Größe, daß er einem Fragenden antwortete:
„Ich glaube nicht an Gott — ich sehe ihn.“
Fabre erlebte und erforschte, sagt Portmann, die Lebensgeschichte einzelner Insektentypen und Gliederfüßler als Beispiele der Vollkommenheit, in der eine Tierart „durch ererbte, im Keim angelegte Lebensform in eine enge, aber wohlgeordnete Weltbeziehung gestellt ist“. 46TfvTwS! in* Oi i Ts/s . JcwMrfewsjj.
Durch Evolution mußten seit der ersten Bewegung im Weltstoff die Spiralnebel, Sonnensysteme und Milchstraßen entstanden sein. Wie es zum Entstehen des Lebens, gar zu den vielfältigen höheren Farmen des pflanzlichen und tierischen Lebens kam, weiß die Evolutionstheorie nicht zu beantworten. Ebensowenig weiß sie über die Frage, wie und warum die großen Saurier plötzlich in der Erdentwicklung aufgetreten und wieder verschwunden sind. Erst dann erscheinen Säugetiere und Vögel. J.-H. Fabre findet arteigene Erbanlagen in seinen Insektentypen und Gliederfüßlern, die immer in ihnen wirksam sein mußten, damit ihre besondere Art erhalten bleiben konnte. Daher schien ihm die Annahme berechtigt, daß Lebensformen zwar in bestimmten Entwicklungsphasen der Erdgeschichte in Erscheinung treten, aber von Anfang an durch den Schöpfungsplan in den sich entwickelnden Weltstoff hineingelegt waren. In unserer Zeit, schreibt Adolf Portmann im Nachwort, wird die biologische Forschung immer stärker dominiert von der Überzeugung, die Anpassung der Organismen, das Zweckmäßige in dlhrem Verhalten sei allmählich geworden durch immer erneute Anpassung von bereits Bestehendem und durch Umweltfaktoren, welche unter diesen Varianten stete Auslese halten. Wir sind indessen, fährt er fort, der verborgenen Wirklichkeit wohl näher, wenn wir einsehen, daß der Organismus nach wie vor ein ungelöstes Problem für uns 'ist und daß unser Forschen jederzeit sehr verschiedener Blickrichtungen bedarf, um das jeweils Sagbare aus dem Geheimnis-grund ans Licht zu bringen. Daher habe die Entwicklungstheorie, aber ebenso die Denkart von Fabre ihre Berechtigung. Es sei auch vielleicht gut, sich zu erinnern, daß für keine Abstammungstheorie bisher die Möglichkeit besteht, das Entstehen einer bewußt erlebten Innenwelt zu deuten, gar das Denken zu erklären So verweise uns die kleine Welt der „Souvenirs“ von Fabre „auch auf verborgene Gründe und tiefe Geheimnisse unseres eigenen Daseins“.