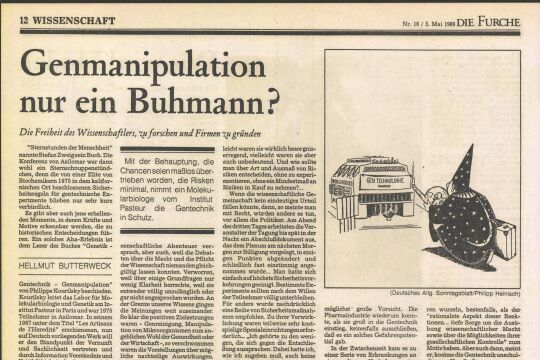Die Gentechnik eröffnet immer mehr Möglichkeiten, über Naturbedingungen zu entscheiden, die früher nicht zur Entscheidung standen, sondern als Schicksal hinzunehmen waren. Wenn diese Technologie die Natürlichkeit grund-sätzlich zur Disposition stellt und uns vermehrt in ein technisches Verhältnis sowohl zu unserem Körper wie auch zur außermenschlichen Natur setzt, damit alte normative Orientierungen auflöst, woran soll man sich dann noch halten? An welchen Kriterien soll man sich in immer schwieriger werdenden Entscheidungssituationen noch orientieren können? Das ist eine Frage, die heute immer mehr Menschen umtreibt, und so ist es durchaus verständlich, dass angesichts des immer größer werdenden Bedarfs an ethischer Orientierung gerne auf einen alten religiösen Topos zurückgegriffen wird, um mit seiner Hilfe, so die Hoffnung, dem modernen moralischen Relativismus oder Pluralismus vielleicht entgehen zu können, nämlich auf den der "Schöpfung". [...]
Mit ihm distanziert man sich von einem Naturverständnis, demzufolge Natur lediglich eine wertneutrale Ressource ist, die sich, je nach Interessenlage der Menschen, beliebig ausbeuten lässt. Dadurch wandelt sich der Schöpfungsbegriff zu einem Oppositionsbegriff. Ob dieses alte beziehungsweise neue Leitbild "Schöpfung" allerdings das herzugeben vermag, was viele sich von ihm erhoffen, bleibt offen. Bei diesem Leitbild handelt es sich vielleicht um einen kräftigen Symbolbegriff, der den Verpflichtungscharakter eines allgemeinen Natur- und Umweltschutzes zu unterstreichen vermag, jedoch nicht um einen operativen normativen Maßstab, der uns auf Fragen nach den Grenzen technischer Veränderungen der Natur eine Antwort zu geben vermöchte.
Profanisierte Welt Vielleicht kann hilfreich sein, in diesem Zusammenhang kurz an die Schöpfungstexte der Genesis zu erinnern. Im Kern enthalten nämlich die biblischen Schöpfungsaussagen keinerlei Absage an Kultur und Technik. Sie widersprechen zunächst einem Verständnis von Welt und Natur, demzufolge Natur Trägerin göttlicher Qualitäten sein soll. Der Schöpfungsmythos von Genesis 1 und 2 impliziert somit eine vollständige Ent-Theologisierung der Natur. [...] Als Folge dieser schöpfungstheologischen Profanisierung von Welt und Natur, heißt es in Genesis 1, 28: "Seid fruchtbar und mehret Euch und füllet die Erde und macht sie Euch untertan, die Fische im Meer und die Vögel im Himmel". Mit diesem Satz und einer breiten theologischen Auslegungsgeschichte kann man davon ausgehen, dass in diesen biblischen Schöpfungsaussagen Gott den Menschen zu seinem Mitarbeiter an der Schöpfung bestimmt hat. Denn dieser Mensch ist von Anfang an mehr als ein bloßes Naturwesen. Es gehört geradezu zu seiner Natur, in den vorgegeben Naturzusammenhang einzugreifen und das bedeutet, Kultur zu stiften und in deren Folge auch Technik auszubilden. [...]
Auch wenn heute sich die Sehnsucht nach einem harmonischen Einklang mit der Natur als Korrektur eines in Vergangenheit und Gegenwart noch immer unverantwortlichen Umgangs mit den natürlichen Lebensgrundlagen artikuliert, hieße es einem romantisch ungeklärten Schöpfungsverständnis zu folgen, wollte man allein der von menschlicher Gestaltung unberührten Natur das Prädikat der Schöpfung zuschreiben. Dass wir heute in einem für antikes und biblisches Denken unvorstellbarem Ausmaß gleichsam die Grammatik der Schöpfung bis in den Bereich der Moleküle hinein entziffern können, muss so gesehen durchaus noch kein problematischer Vorgang sein. Ethische Probleme brechen erst mit der Frage auf, was der Mensch denn mit diesem Erkenntniszuwachs anfängt. Wird es ihm gelingen, innerhalb dessen, was heute schon technisch machbar ist und auch künftig machbar sein wird, zwischen sinnvollem und sinnlosem verantwortlich zu unterscheiden? Ob zur Klärung dieser Frage allerdings ein Rückgriff auf den Schöpfungsbegriff ethisch weiterhilft, scheint mir fraglich, und zwar allein schon deshalb, weil wir - wie wir gesehen haben - im Kontext des biblischen Verständnisses von Schöpfung, Kultur und folglich auch Wissenschaft und Technik bis hin zur Gentechnik selbst Teil dieser Schöpfungsauffassung sind. Somit vermag das Leitbild "Schöpfung" keine Antwort auf die Frage zu geben, welche Formen gentechnischer Eingriffe in die Natur denn moralisch zulässig sein sollen und welche nicht.
Moralischer Konsens Die angesichts der vielfältigen Herausforderungen durch die modernen Biowissenschaften (Biologie und Medizin) immer wieder gestellte Frage, ob wir denn alles machen dürfen, was wir machen können, ist letztlich eine rein rhetorische Frage. Denn die Antwort kann immer nur lauten: Nein! Das Problem jedoch liegt darin, dass der moralische Konsens in der Gesellschaft weitreichende Einschränkungen der Technik im Allgemeinen und der Gentechnik im Besonderen nicht in dem Maße zu geben vermag, wie viele sich dies wünschen. Dieser Konsens enthält nämlich Grundwerte und Minimalbedingungen menschlichen Zusammenlebens, wie sie unter anderem in unserer Verfassung repräsentiert sind. Dazu gehört vor allem der Schutz der Würde, der Rechte und der Selbstbestimmung des Menschen. Was darüber hinausgeht, fällt häufig in einen Pluralismus von moralischen Überzeugungen und hat kaum eine Chance auf gesellschaftlichen Konsens. Dies wird besonders deutlich am Beispiel einer Ethik der Gentechnik. Von ihr wird vielfach erwartet, sie werde moralische Schranken gegen die rasant um sich greifende Technisierung der lebendigen Natur in der Gentechnik und der Fortpflanzungsmedizin errichten. Was jedoch aus dem bioethischen Diskurs über all die brisanten offenen Konfliktfragen am Ende herauskommt, kann immer nur eine Ethik auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner sein. [...] Die Gentechnik gibt uns im Prinzip Möglichkeiten an die Hand, uns der lebendigen Natur genau so zu bemächtigen, wie in früheren Zeiten sich Physik und Chemie der Materie bemächtigt haben. Mit gentechnischen Verfahren können heute Artgrenzen überschritten und Gene ausgetauscht werden. Strukturen und Prozesse des Lebens, die uns als Resultat einer langen Evolution vorgegeben waren, werden mehr und mehr Objekt technischer Fantasien. Zwar ist vieles an diesen Perspektiven zur Zeit selbst noch Fantasie, aber die Entwicklung verläuft mit einer enormen Dynamik mit der Folge, dass alles, was heute an Pflanzen und Tieren erprobt wird, morgen im Prinzip auch am Menschen machbar sein wird - wie zum Beispiel die ersten Klonversuche beim Schaf "Dolly".
Gentechnik, genetische Diagnostik, Fortpflanzungsmedizin et cetera konfrontieren uns mit einer Reihe von Fragen, deren Bedeutung im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Beantwortbarkeit steht: Das heißt, sie lassen sich leicht stellen, aber nur schwer bearbeiten. Ist etwa eine Ethik der individuellen Wertungen, die der rasanten Technikentwicklung grundsätzlich förderlich ist, noch vertretbar? Wie soll sich angesichts der technischen Möglichkeiten der Medizin unser Verhältnis zu Krankheit und Tod entwickeln? Diese Fragen berühren letztlich den Sinn unseres Daseins und Handelns wie übrigens auch die Grundlagen unseres Denkens sowie unsere moralischen Intuitionen. Solche Fragen mögen radikal erscheinen, die Antworten darauf werden jedoch weit weniger radikal ausfallen können. Denn angesichts der technischen Entwicklung wird man sich von der Vorstellung verabschieden müssen, die menschliche Natur sei an sich so etwas wie ein fester Grund, der dem technischen Zugriff grundsätzlich entzogen bleibt. Nein, auch diese Natur unterliegt genauso wie die natürliche Umwelt einer Evolution, an der der Mensch selbst Anteil hat.
Tabu des Natürlichen Diese Einsicht ist in der Tat unbequem, denn sie entlarvt geglaubte moralische Sicherheiten letztendlich als Illusion. Gleichwohl erhebt sich moralischer Widerstand, und zwar vor allem dann, wenn der Mensch selbst in den Fokus gentechnischer Eingriffe gerät. Dann werden neue Tabus gefordert. Auch hier berufen sich Kritiker gerne auf die Schöpfung und kritisieren die Wissenschafter mit dem Hinweis, sie würden mit ihrer Technik Gott spielen. Aus der moralischen Norm der Unantastbarkeit der menschlichen Würde wird dann, gleichsam im Gegenzug zur Technisierung, direkt die Unantastbarkeit der menschlichen Natur gefolgert. Bei näherem Hinsehen jedoch hat das Tabu der Natürlichkeit eine offene Flanke. Denn es gibt in Wirklichkeit kein moralisches Verbot für technische Eingriffe in die menschliche Natur, die sich medizinisch legitimieren lassen. Um sich das plausibel zu machen, genügt ein kurzer Blick in die Geschichte der Medizin.
Von den Anfängen der Entdeckung von Krankheitserregern durch Pas-teur, den ersten Impfungen, den Eingriffen ins Herz und ins Gehirn bis hin zur modernen Fortpflanzungsmedizin und Gentherapie: Immer wieder gab es Debatten darüber, ob hier nicht Grenzen überschritten seien, jenseits derer man auch medizinisch indizierte Maßnahmen moralisch nicht mehr rechtfertigen könne. Keine dieser Debatten hat es jedoch vermocht, die biomedizinische Technikentwicklung aufzuhalten. Daraus schließen wir, dass ethische Vorbehalte auch gegen neue technische Optionen dann versagen müssen, wenn es darum geht, menschliches Leben zu erhalten und Krankheiten zu behandeln. Die Wiederherstellung von Gesundheit scheint nämlich nahezu jeden technischen Eingriff zu rechtfertigen. Dies hängt damit zusammen, dass im Rahmen der Werteordnung liberaler Gesellschaften medizinische Zwecke von unbestreitbarer Legitimität sind.
Recht auf Gesundheit Daher überrascht es nicht, dass die Gentechnik gerade dort die höchste gesellschaftliche Akzeptanz genießt, wo die moralischen Schranken am höchsten sind, nämlich bei ihrer Anwendung auf den Menschen. Hier wird zwar häufig der Vorwurf des Totschlagsarguments geltend gemacht. Aber das überzeugt nicht. Denn es ist kein politischer Trick der Gentechnikbefürworter, das individuelle Recht auf Gesundheit gegen jegliche Einschränkungen gentechnischer Optionen auszuspielen. Vielmehr handelt es sich hier um das schlichte Gebot der Abwägung. Und diesem Gebot zufolge gerät jede moralische Position ins Abseits, die ein undifferenziertes Verbot verteidigen möchte. Im Übrigen muss man sich klar machen, dass gegenüber der Beliebigkeit und Willkür technischen Handelns die in unserer Kultur vorherrschende Krankheitsdefinition ein durchaus geeignetes Regulativ ist. Dieses Krankheitskonzept enthält in sich moralische Schranken und professionelle Normen, die sowohl das technische Verfügen über den Menschen als auch das Tätigkeitsfeld des Arztes begrenzen. Diesem Konzept zufolge ist daher eine Anwendung der Gentechnologie in der Medizin nur dort gerechtfertigt, wo Krankheit vorliegt und behandelt werden kann. [...]
Gerade was die molekularen Diagnosemöglichkeiten betrifft, hat die Humangenomforschung in den letzten Jahren äußerst beeindruckende Fortschritte gemacht und in vielen Fällen auch neue Strategien der Prävention hervorgebracht. So lassen sich unter anderem: * Krankheiten prognostizieren, die erst zu einem späten Zeitpunkt des Lebens eines Menschen ausbrechen werden; * besondere genetisch bedingte Anfälligkeiten eines Menschen für Umweltgifte identifizieren; * genetische Trägermerkmale feststellen, die nicht bei den Betroffenen, wohl aber unter gewissen Umständen bei den Nachkommen zu schweren Leiden führen können; * durch Früherkennung von Genmutationen in einzelnen Fällen präventive Maßnahmen ergreifen, um so den Ausbruch einer Krankheit zu verhindern (erbliche Disposition für Dickdarm- und Brustkrebs et cetera); * durch humangenetische Beratung Eltern auf die Risiken der Fortpflanzung aufmerksam machen, um auf diese Weise die Zeugung behinderter Kinder zu vermeiden; * in pränataler Diagnose eine Reihe genetisch bedingter Schädigungen des Fötus feststellen und die Geburt von später behinderten Kindern durch Abtreibung vermeiden.
Alle diese Möglichkeiten haben ohne Zweifel ihren unverkennbaren Nutzen, aber ebenso ihre Gefahren und moralischen Problemdimensionen. Droht uns angesichts dieser Entwicklung eine hemmungslose genetische Ausforschung von Menschen? Oder könnten auf diesem Wege genetische Merkmale auch zu einem Kriterium sozialer Diskriminierung werden - etwa am Arbeitsplatz? Werden Kostendruck im Gesundheitswesen und Wunschkindmentalität der Eltern eugenische Selektion in großem Maßstab begünstigen? Mit diesen Problemperspektiven werden fundamentale Wertpositionen unserer Gesellschaft tangiert und man muss sich fragen, ob dem Recht die Aufgabe zukommt, Grenzen der Anwendung solcher und weiterer gentechnischer Optionen im Gesundheitsbereich zu bestimmen. Eine der angesprochenen moralischen Problemdimension der Erweiterung unseres genetischen Wissens bezieht sich beispielsweise auf die Praxis der pränatalen Diagnostik. Denn die Möglichkeit eines molekulargenetischen Tests noch vor der Geburt wird von den betroffenen Frauen zumeist höchst ambivalent erlebt: Zum einen werden solche Tests in Anspruch genommen, um Klarheit über Vermutungen und Befürchtung im Blick auf mögliche Krankheiten beim noch nicht Geborenen zu gewinnen. Gleichzeitig wird diese Abklärung aber auch gefürchtet, weil sie im Falle des Vorliegens eines medizinisch positiven Befundes eine Entscheidung über die Fortsetzung der Schwangerschaft oder einen Schwangerschaftsabbruch nach sich zieht.
Gefahr der Selektion Mit dem weiteren Zuwachs an genetischem Wissen wird dieser Konflikt sich noch verschärfen, da immer mehr Krankheiten und Entwicklungsstörungen auf diese Weise identifiziert werden können. Der moralische Kern dieser Problemlage besteht darin, dass Diagnosen mit nachfolgender Abtreibung im Grund mit dem Heilauftrag der Medizin und dem Ethos des ärztlichen Handelns nichts, wohl aber viel mit Selektion zu tun haben. Denn in allen Fällen, in denen ein Schwangerschaftsabbruch ins Auge gefasst wird, geht es nicht darum, dem von einer Krankheit betroffenen Menschen therapeutisch beizustehen, sondern darum, seine Geburt zu verhindern, - ein Vorgehen, das als individuelle Entscheidung einer betroffenen Mutter zwar verständlich ist, als gesundheitspolitisches Programm jedoch niemals hingenommen werden dürfte. Angesichts der in vielen Fällen noch fehlenden Therapieangebote im vorgeburtlichen Bereich sind daher in solch schweren Konfliktlagen qualifizierte Beratungsgespräche vor und nach dem Test unerlässlich. Dabei muss über das Ziel, die Risiken sowie über die Sicherheit des Testes, aber auch über das zu testende Merkmal und über die vorhandenen Handlungsoptionen im Falle des Vorliegens einer Krankheit gesprochen und möglichst nicht-direktiv aufgeklärt werden.
Nun eröffnen Erkenntnisse aus der Humangenomforschung im weiteren auch die Möglichkeit, genetische Untersuchungen im Hinblick auf Krankheiten vorzunehmen, die klinisch noch nicht auffällig geworden sind. Eine Reihe von Erbkrankheiten manifestieren sich nämlich erst im fortgeschrittenen Alter. Menschen, die sich durch ihre Familiengeschichte zum Beispiel belastet wissen, haben schon heute die Möglichkeit, mittels eines genetischen Tests ein vielleicht nur vermutetes Risiko entweder zu erhärten, zu reduzieren oder gar auszuschließen. Dabei sind aber nicht nur Risikopersonen angesprochen. Zieht man nämlich neben den Erbfaktoren im engeren Sinne auch andere genetische Ursachen für die Entstehung von Krankheiten in Betracht, dann wird prädikative Genetik umgehend zum Thema für beinah alle Menschen. Denn bei Herz- und Kreislauferkrankungen, Krebs, Allergien, Diabetes, endogenen Depressionen und Schizophrenie - bei all diesen Krankheiten sind genetische Faktoren mit im Spiel, ein Umstand, der uns daran erinnern sollte, dass jeder von uns mehrere krankmachende Gene in sich trägt. Macht es Sinn, unter allen Umständen solch persönliche Risiken zu kennen? Hier ergibt sich die Frage, ob man als Individuum nicht auch das Recht haben sollte, auf das Wissen über seine eigenen Gene verzichten zu können. Zwar kann es unter bestimmten Voraussetzungen durchaus Sinn machen, sein Leben im Wissen um seine eigene genetische Konstitution zu planen, aber dies ist nicht jedermanns Sache. Man kann es vorziehen, die Risiken, die in einem stecken und vielleicht unabwendbare schwere Krankheiten nicht im Voraus schon zu wissen. [...] Trifft ein Mensch eine solche Wahl, dann wird man diese dem Kern seines Persönlichkeitsrechtes zurechnen müssen, den es zu respektieren gilt. [...] Im Zusammenhang mit der Option prädiktiver Testverfahren muss im weiteren beachtet werden, dass genetische Merkmale, die als erbmäßige Erkrankungsrisiken in Frage kommen, im Rahmen präventiver Medizin noch zwei relevante Besonderheiten aufweisen: Der prädiktive Wert solcher Merkmale erstreckt sich nämlich über große Bereiche der Lebenszeit der getesteten Person und sie ermöglichen gleichzeitig nicht nur Aussagen über die Testperson selbst, sondern auch über dessen Angehörige - eine Problemkonstellation, die vor allem Fragen der Sicherung des Daten- und Persönlichkeitsschutzes aufwirft.
Kontrolle ist nötig Eine nicht minder bedeutsame Frage im Kontext prädiktiver Medizin ist die nach der medizinischen Relevanz testbar gewordener Merkmale. Da im Grunde alle Aspekte am Menschen medizinische Bedeutung haben können, stellt die prädiktive Medizin nicht nur die Unterscheidung zwischen "gesund" und "krank" zur Disposition (getestet werden ja immer nur Gesunde), sondern ebenso die Unterscheidung zwischen medizinischen und nicht medizinischen Merkmalen, insofern ja alle Merkmale einen genetischen und damit diagnostisch relevanten Hintergrund haben. Da gerade dieser Umstand einem Wildwuchs einer unnötigen und ethisch und sozialpolitisch höchst bedenklichen Testpraxis förderlich sein könnte, müssen Kontrollinstitutionen geschaffen werden, um solch unerwünschten Fehlentwicklung rechtzeitig vorzubeugen.
Bei all dem Faszinierenden dieser Entwicklung sollten wir uns eine gewisse Bescheidenheit im Blick auf dieses Erkenntnispotential bewahren. Denn trotz des enorm gewachsenen Wissens über die molekularen und genetischen Grundlagen vieler Krankheiten sind wir weit davon entfernt, das komplexe Wechselspiel zwischen den Genen und der Umwelt vollständig zu durchschauen. Entsprechend zeichnen sich schon heute in vielen Bereichen der Genetik die Umrisse eines wesentlich komplexeren Bildes der Krankheitsentstehung ab. Lineare Beziehungen zwischen einem vereinzelten "Fehler" in einem Gen und einem Krankheitsbild sind selbst bei den sogenannten monogenen Krankheiten eher die Ausnahme. Die Mehrheit der Erkrankungen erweist sich vielmehr als Resultat eines komplexen Zusammenspiels mehrerer Gene mit sogenannten epigenetischen Faktoren und Umwelteinflüssen.
Gene sind nicht alles Angesichts solcher Einsichten wird daher der häufig vorgebrachte Einwand gegen die Gentechnik, sie fördere, insbesondere im Rahmen der Genomforschung, ein reduktionistisches Menschenbild, durch die Genomforschung selbst widerlegt. Diese vermittelt uns nämlich auch ein Wissen darüber, dass die genetische Information, ohne die Leben letztendlich nicht möglich ist, bei weitem nicht unser Dasein vollumfänglich vorherbestimmt. Zwar starten wir mit einer bestimmten genetischen Konstitution, die uns von unseren Eltern übermittelt wird, in unser Leben. Was aber am Ende aus uns wird, ist jeweils unsere eigene Geschichte. Bildhaft gesprochen: Unsere genetische Konstitution ist vergleichbar einem gut konstruierten Piano. Ob darauf ein Klavierkonzert von Mozart oder der Fröhliche Landmann von Robert Schuhmann geklimpert wird, ist die freie Wahl des Pianisten und nicht durch die Konstitution des Klaviers festgelegt.
Doch gibt es Menschen, bei denen diese genetische Konstitution an einigen Stellen fehlkonstruiert ist. Und genau für solche Fälle kann uns der Zuwachs an molekulargenetischem Wissen Möglichkeiten eröffnen, diesen betroffenen Menschen durch neue Therapiekonzepte zu einem leichteren Leben zu verhelfen. In Anknüpfung an die Schöpfungsmetapher könnte man etwas pointiert formulieren, dass wer angesichts einer schweren Krankheiten nicht versuchte, korrigierend in die "Schöpfung" der Natur des Menschen einzugreifen, die Verpflichtung zur Nächstenliebe nicht wirklich begriffen hat. Krankheit muss nicht länger als blindes Schicksal hingenommen werden. [...]
Angesichts vieler noch ungelöster medizinischer Probleme in der Krebsdiagnose und -behandlung, in der Immunologie und Virologie, aber auch bei vielen Formen psychiatrischer Erkrankungen, werden wir weiterforschen müssen. Wir werden unter Einsatz gentechnischer Methoden versuchen, die kausalen Hintergründe von Erbkrankheiten besser zu verstehen, damit den Betroffenen in Zukunft entsprechende Behandlungskonzepte angeboten werden können. Dazu muss auch die molekulare Grundlagenforschung weiter vorangetrieben werden. Dies gebietet schon die Ethik des ärztlichen Handels. Aber trotz einer noch so starken ideellen und materiellen Förderung gentechnischer Forschung im Gesundheitsbereich dürfen wir uns im Umgang mit Krankheit und Leid nicht nur an technischen Lösungen orientieren. Daneben ist ebenso wichtig, uns nicht einzubilden, wir bräuchten nur viel Geld in die Forschung zu investieren und schon hätten wir Krankheit, Leiden und Tod gleichsam "im Griff". Nein: So wie wir unsere technischen Möglichkeiten optimieren müssen, sollten wir auch unsere humanen Ressourcen aktivieren und uns fragen, ob es im Umgang mit Krankheit nicht auch andere als nur technische Möglichkeiten gibt, so wichtig diese im Einzelfall auch sein mögen. Aber dies ist keine Perspektive der Wissenschaft, sondern eine, die uns alle angeht.
Die Humanität einer Gesellschaft bemisst sich nämlich nicht nur an ihrem Vermögen, Krankheit und Leid technisch zu beherrschen, sondern auch daran, ob es dieser Gesellschaft gelingt, Menschen mit unheilbaren und chronischen Krankheiten und Leiden in unser Gemeinwesen zu integrieren und sie, unabhängig vom Grad ihrer körperlichen und/oder geistigen Behinderung, in ihrer Menschenwürde zu achten. Wenn wir nämlich erkennen, dass technische Machtbesessenheit durchaus auch ein Ausdruck menschlicher Armut sein kann, dann lassen sich auch Bedingungen schaffen, unter denen die Gentechnik in einem humanen Sinne eingesetzt werden kann. Viel gefährlicher als die Gentechnik als solche ist der Glaube an ihre Allmacht.
Zum Thema "Der Mensch und sein Genom. Wohin führt der Eingriff in das Erbgut?" veranstaltet die Katholische Akademie in Bayern vom 12. bis 17 Februar für Studierende und Universitätsassistenten aller Fachgebiete ein Seminar in München. Für alle weiteren Interessenten findet zum gleichen Thema vom 8. bis 13. Oktober 2001 eine Philosophische Woche statt. Anmeldungen und Informationen unter 0049/89/38 10 20.
Zur Person: Molekularbiologe, Theologe und Philosoph "Wertekonflikte werden durch Mehrheitsbeschlüsse gelöst, nicht durch Wahrheitsentscheide. Es gibt keine Wahrheit in der Moral." Nach Hans-Peter Schreibers Überzeugung ist vielmehr gesellschaftlicher Diskurs und Konsens vonnöten, um die Grenzen des gentechnisch Erlaubten zu ziehen. Eine Herausforderung, der sich der 64-jährige promovierte evangelische Theologe und Philosoph vielerorts stellt: Über 20 Jahre war Schreiber als Gemeinde- und Studentenpfarrer in Basel tätig und absolvierte währenddessen ein Teilstudium der Molekularbiologie und Genetik am Biozentrum der Universität Basel. Von 1986 bis 1992 war er Privatdozent für praktische Ethik und Philosophie an der Universität Basel und wurde dort 1992 zum außerordentlichen Professor ernannt. Seit damals ist Schreiber Leiter der Stelle für Ethik und Technologiefolgenabschätzung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich. Er ist zudem Vorsitzender der Ethikkommission der ETH Zürich und des wissenschaftlichen Beirates des Deutschen Human-Genom-Projektes.