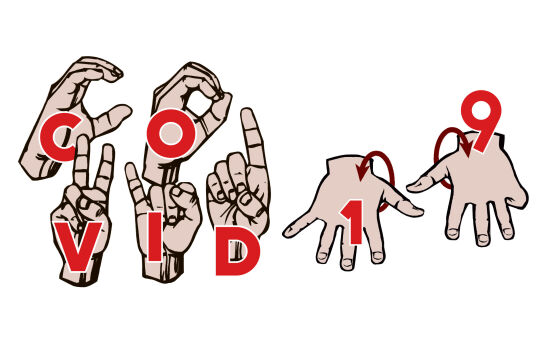Pflegen in der Krise
DISKURS
Pflegen in Pandemie-Zeiten: Wenn die Angst mitarbeitet
Timea Bektas hat früh geahnt, in welcher Lebensgefahr ihre 36 Heimbewohnerinnen und -bewohner und ihr Team schweben. Am Höhepunkt der Corona-Welle erwischt es die Wiener Krankenpflegerin selbst. Diagnose: Covid-19-positiv.
Timea Bektas hat früh geahnt, in welcher Lebensgefahr ihre 36 Heimbewohnerinnen und -bewohner und ihr Team schweben. Am Höhepunkt der Corona-Welle erwischt es die Wiener Krankenpflegerin selbst. Diagnose: Covid-19-positiv.
„Ich bin irgendwie nie fertig und gerade voll hungrig“, sagt Timea Bektas, als sie sich auf einer Parkbank im Garten des Wiener Pflegewohnheims niederlässt. Es ist zehn Uhr vormittags, ein Frühstück hat die 41-Jährige noch nicht gehabt. Zum Verschnaufen ist heute wieder einmal wenig Zeit: Dienstübergabe. Visiten. Dazwischen viele Telefonate und Gespräche mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Bewohnern. Ein ganz normaler Arbeitstag für die Wohnbereichsleiterin und diplomierte Krankenpflegerin. Nur eben mit Mund-Nasen-Schutz, Handschuhen und einem sehr großen Babyelefanten-Abstand. Als jedoch im März das Coronavirus Österreich erreicht, herrscht für Bektas und ihr 25-köpfiges Pflegeteam Alarmstimmung.
„Eine schwere Entscheidung“
Die gebürtige Ungarin, die seit 17 Jahren mit ihrem Mann und Sohn in Wien lebt, reagiert an dem historischen „Lockdown“-Wochenende Mitte März blitzschnell. „Corona macht keinen Bogen um Österreich, das wussten wir.“ Sie bringt ihren achtjährigen Sohn zu ihren Eltern nach Ungarn und fährt noch am selben Tag zurück nach Wien. „Ich wusste ja nicht, wie die Krankheit sich verhält. Es war dennoch eine schwere Entscheidung.“ Falls sie selbst infiziert werden würde, sollte ihr Sohn zumindest gut umsorgt sein. Erst acht Wochen später sah sie ihren Achtjährigen wieder. Der Impuls, den Sohn in Sicherheit zu bringen und vorzusorgen, ist Bektas leise Vorahnung auf das, was folgen sollte. In den darauffolgenden Wochen explodieren Bektas‘ Arbeitszeiten. Sie arbeitet sieben Tage die Woche, zwölf bis 14 Stunden pro Tag, vermeidet alle physischen, sozialen Kontakte und hält sich penibel an alle Hygiene-Maßnahmen. Bektas schickt sogar ihren Mann in das Wohnzimmer auf die Couch.
„Ich habe alles getan, damit ich niemanden anstecke. Ich habe immer Maske und Schutzkleidung getragen und bin mit dem Auto in die Arbeit gefahren.“ Schlagartig kommt in ihrem Pflegewohnheim das Besuchsverbot für Angehörige, das viele davon sehr verärgert. Bektas bekommt einige wütende Stimmen am Telefon zu hören. Dann brechen die ehrenamtlichen Helfer auflagenbedingt weg, Fußpfleger und Frisöre bleiben aus. Auch die Ärzte visitieren nur mehr digital über Tablet und Videoschaltung. Zu ihrem eigenen Schutz müssen die Bewohnerinnen und Bewohner bis auf Ausnahmen im Zimmer bleiben. „Über das Frühstück am Bett haben sich manche aber auch gefreut“, erzählt Bektas mit einem Lächeln im Gesicht. Nur vereinzelt werden mit einigen wenigen aus Therapienotwendigkeit physiologische Übungen gemacht.
„Schlecht sehende und hörende Bewohner haben uns in Schutzkleidung und Masken oft gar nicht erkannt. Oft mussten wir die Masken, aus der Distanz, kurz abnehmen, um zu zeigen: ‚Ich bin es wirklich‘“, erzählt Bektas. Das Fehlen der sozialen Kontakte und ein Lagerkoller seien in der Zeit deutlich zu spüren gewesen. „Es hat sich alles drastisch verändert. Von einem Tag auf den anderen. Wir haben alle höllisch aufgepasst.“ Engagiert versorgt sie mit ihrem Team Angehörige und Bewohner mit Fotos und bietet über eigens angeschaffte Tablets Videotelefonie als Besuchsersatz an. Sogar von Terrassen wird Familienmitgliedern zugewunken.
„Bewohner hatten viele Fragen“
Bektas will ihren Mitarbeitern Halt geben. Auch für die Bewohner da sein. „Die waren alle unsicher und hatten viele Fragen, auf die ich natürlich auch nicht immer eine Antwort wusste. Dazu kommt, dass viele hier dement sind.“ Gefühlt haben sich die Hygienevorschriften alle drei Tage geändert. Mitarbeiter, Angehörige und Bewohner mussten laufend neu informiert und geschult werden. Eine Mammut-Aufgabe für die Pfleger und Pflegerinnen. Für viele Bewohner ist die Coronakrise eine unwirkliche Situation, wie aus einem schlechten Film, erzählt Bektas. „Sie haben kaum glauben können, dass es so etwas gibt – und wie schlimm die Pandemie weltweit ist“, erzählt Bektas.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!