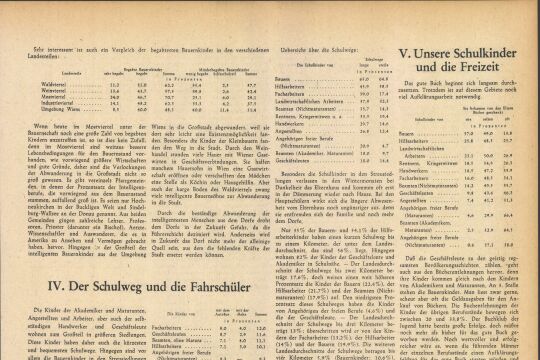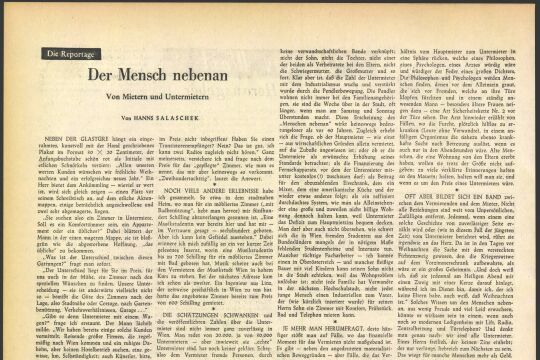Die Stagnation darf nicht zur Resignation führen
Das Mautner-Markhof-Spital hat Anfang März 1977 als einziges Kinderspital in ganz Wien eine sechsstündige Besuchszeit eingeführt. Um ein „Spitalstrauma“ des Kindes zu verhindern einerseits, und um mehr Patienten zu gewinnen anderseits, hat man sich entschlossen, den Eltern täglich von 12 bis 18 Uhr Gelegenheit zu geben, ihr Kind zu besuchen, sich mit ihm zu beschäftigen, sich über sein Befinden zu informieren. Um nun zu erfahren, wie dieser Versuch von den Eltern aufgenommen wurde, startete man im Oktober eine Befragungsaktion, die Ende Dezember 1977 abgeschlossen war. Und kam dabei zum verblüffenden Ergebnis: Nur etwa ein Viertel der Befragten zeigte sich mit der sechsstündigen Besuchszeit zufrieden, ein weiteres Viertel wünschte eine noch längere Besuchszeit und etwa die Hälfte fand sechs Stunden zu lang.
Das Mautner-Markhof-Spital hat Anfang März 1977 als einziges Kinderspital in ganz Wien eine sechsstündige Besuchszeit eingeführt. Um ein „Spitalstrauma“ des Kindes zu verhindern einerseits, und um mehr Patienten zu gewinnen anderseits, hat man sich entschlossen, den Eltern täglich von 12 bis 18 Uhr Gelegenheit zu geben, ihr Kind zu besuchen, sich mit ihm zu beschäftigen, sich über sein Befinden zu informieren. Um nun zu erfahren, wie dieser Versuch von den Eltern aufgenommen wurde, startete man im Oktober eine Befragungsaktion, die Ende Dezember 1977 abgeschlossen war. Und kam dabei zum verblüffenden Ergebnis: Nur etwa ein Viertel der Befragten zeigte sich mit der sechsstündigen Besuchszeit zufrieden, ein weiteres Viertel wünschte eine noch längere Besuchszeit und etwa die Hälfte fand sechs Stunden zu lang.
Also ist die „Aktion Kind im Krankenhaus“, die vor eineinhalb Jahren mit viel Optimismus gestartet worden war (die FURCHE berichtete darüber), nach anfänglichen Erfolgen an einem toten Punkt angelangt?
„Wir haben“, sagt Doz. Dr. Walter Stögmann, selbst Vater von drei Kindern und eigentlicher Initiator dieser Neuerungen am Mautner-Spital, „das Ganze zu abrupt durchgeführt. Der Ubergang war zu plötzlich, die Bevölkerung zuwenig darauf vorbereitet.“ Er berichtet von ständigen Reibereien zwischen Eltern und Personal, die schließlich dazu geführt hätten, daß viele Eltern ihre Kinder vorzeitig aus dem Spital herausnahmen, um es in ein anderes, mit vielleicht nur einstündiger Besuchszeit, zu geben. „Denn dort“, erklärt Stögmann, „hatten sie gar keine Gelegenheit, sich zu beschweren.“ Das Mautner-Spital hat auf jeden Fall seine Pionierleistung mit einem Verlust an Patienten bezahlt Fazit: Die Besuchszeit wird wahrscheinlich wieder verkürzt werden.
Hier zeigt sich wieder sehr deutlich, woran es in unserem Lande vor allem fehlt: an der nötigen Aufgeschlossenheit von allen Seiten und der Fähigkeit, sich neuen Bedürfnissen anzupassen. Was in anderen westeuropäischen Ländern wie Skandinavien oder England schon längst zur Selbstverständlichkeit gehört, eine durchlaufende Besuchszeit an den Kinderspitälern, scheint hier vor beinahe unüberwindlichen Hindernissen zu stehen.
Nachdem die Bemühungen durch das „Aktionskomitee Kind im Krankenhaus“ (Obfrau Dr. Krista Schüssel), die anfanglichen Widerstände des Spitalspersonals abzubauen, erste Früchte zu tragen beginnen (so werden in einigen Schwesternschulen die Schülerinnen bereits darauf vorbereitet), scheint es nun auch an den Eltern zu liegen, daß es zu diesem Rückschlag in einer an sich sehr positiven Entwicklung gekommen ist. Obwohl entsprechendes, Informationsmaterial an sie verteilt wurde, das in kurzer Form auf die Bedürfnisse des Spitals hinweist und die Eltern um Rücksichtnahme bittet, sei davon (so meinen zumindest Ärzte und Personal) wenig zu spüren. „Die Eltern betrachten das alles als Selbstverständlichkeit und das Spital als ihren Besitz. Sie nehmen keine Rücksicht auf das Personal und auf die Gegebenheiten des Hauses“, ärgert sich Doz. Stögmann. Er beschwert sich weiter über die Forderung nach zusätzlichen Dienstleistungen der Schwestern, deren Zahl nachmittags ohnedies dezimiert ist So müsse Fieber gemessen werden zu einer Zeit, an der normalerweise kein Fieber gemessen wird. Oder: Eltern wollen während der Visite, wenn bereits pubertierende Kinder nackt untersucht werden müssen, nicht den Raum verlassen. Oder: Dem Besucher fehle es am. nötigen Hygienebewußtsein. „Da kommt ein Schlosser oder Maurer und setzt sich mit seinem schmutzigen Arbeitsanzug aufs Bett.“ All dies beträfe vor allem die Unterschichten. Da jedoch etwa zwei Drittel der Patienten, um die es hier geht, dazu gehören (Klassepatienten durften
schon immer unbeschränkt besucht werden), ist das Ergebnis entsprechend.
Dieser Ansicht ist auch Krista Schüssel: „Die Mittelschicht-Eltern konnte man gut ansprechen. Aber das große Problem ist: Wie kommt man an die Unterschicht-Eltern heran?“
Eine weitere Schwierigkeit liegt in der Beschaffenheit der Krankenzimmer. Im Mautner-Spital stehen in einem Zimmer durchschnittlich sechs bis 14 Betten. Bei den täglichen Besuchszeiten ist, obwohl nur maximal zwei Personen pro Kind kommen sollen, das Zimmer gesteckt voll, und damit die Ruhe der kleinen Patienten nicht mehr gewährleistet. „Da ist uns“, entsetzt sich Doz. Stögmann, „folgendes passiert: Die Leute kamen daher mit der Thermosflasche und der Torte und hielten in der Mitte des großen Zimmers ihre Kaffeerunden, statt sich mit ihrem Kind zu beschäftigen.“
Ganz anders sieht Dr. Schüssel das Problem: „Da sieht man, wie gänzlich verschieden das Denken der Ärzteschaft von jenem der Unterschichten ist. Endlich haben sich die Leute wohl gefühlt und nicht mehr gefürchtet vorm Krankenhaus. Das ist ein Erfolg, den eine Aktion haben kann.“ Auch das Argument, daß die Eltern gar nicht mit ihren Kindern spielen, weiß sie zu entkräften: „Jeder, der Kinder hat, weiß, daß man sich nicht dauernd mit ihnen beschäftigen kann. Aber allein die Anwesenheit vertrauter Personen, ihre Stimme, ist für ein krankes Kind in einer völlig fremden Umgebung eine große Beruhigung.“
Man sieht also, worum es hier vor allem geht: um das Aufeinanderprallen zweier, bislang sorgfältig voneinander getrennter und einander innerlich völlig fremder Welten. Was im Krankenhaus mit dem Patienten geschieht war für seine Angehörigen bislang weitgehend tabu (was den großen Vorteil hatte, daß keinerlei Einmischungen zu befürchten waren). Er wird aus seiner Familie genommen und einem anonymen Betrieb übergeben, wobei es ihm selbst meist ziemlich unklar ist, was nun eigentlich mit ihm passiert. Durch die langen Besuchszeiten bekommen Eltern nun einen besseren Einblick in die Gepflogenheiten des Spitals, sie beginnen mehr zu kritisieren - zu Recht oder zu Unrecht, auf jeden Fall fühlt sich das Spitalspersonal irritiert und reagiert entsprechend. Das Ergebnis sind die erwähnten Unstimmigkeiten und Reibereien.
Ein weiteres Argument von Ärzteschaft und Personal: Die Eltern fühlen sich verpflichtet, die täglichen Besuchszeiten voll auszuschöpfen, weil sich Kinder, die an den Nebenbetten Besuch sehen und selbst keinen bekommen, bitter beklagen. Doz. Stögmann sieht daher in einer Änderung der Räumlichkeiten eine Voraussetzung für die Einführung einer verlängerten Besuchszeit. Kleinere Zimmer, Besucherräume, ein Kindergarten, wie er im St.-Anna-Kinderspital vom Verein „Kind im Krankenhaus“ eingerichtet wurde, eventuell ein kleines Caf6 oder ein Erfrischungsraum, wie er in den Kinderkliniken in der USA seit langem üblich ist. Es wäre an der Zeit,
sich auch hier einmal über solche und ähnliche Dinge Gedanken zu machen. Vor allem, da ja so viel von der „Humanisierung der Spitäler“ gesprochen wird. Aber das, so meint Stögmann, wird sicherlich noch dauern. Inzwischen findet er es vernünftiger, eine wenn auch tägliche Besuchszeit auf ein bis zwei Stunden herunterzuschrauben: „Der psychologische Effekt ist meiner Ansicht nach derselbe.“
Was sagt das Kind dazu, um das es hier ja eigentlich geht? Es wird, wie üblich, wenig gefragt. Fast scheint es, daß seine Bedürfnisse bei diesem allgemeinen Gerangel in Vergessenheit geraten sind. „Kinder, vor allem Kleinkinder, können bereits durch einen ein- bis dreitägigen Spitalsaufenthalt traumat^siert werden“, sagt die Kinderpsychologin Dr. Schüssel. Die erschütternden Briefe von Müttern, deren Kinder einen Krankenhausaufenthalt hinter sich haben, geben ihr recht. Sie schildern total desorientierte und psychisch gestörte Kinder, die zum Teil ihre Mutter gar nicht wiedererkannt oder sich an die Schwester als Ersatzmutter geklammert haben. Daß Methoden wie eine nur einmalige Besuchszeit pro Woche inzwischen an den meisten Kinderspitälern in Wien abgeschafft wurden, ist den Aktivitäten des Komitees zu verdanken. Nach der Enquete von Gesundheitsstadtrat Stacher im Wiener Rathaus Ende 1976 gibt es an fast allen Kinderspitälern
zumindest einstündige Besuchszeiten täglich.
Aber das, meint Krista Schüssel, sei zuwenig. Vor allem bei Kleinkindern, die noch kein Zeitgefühl besitzen, und denen ein „die Mutti kommt morgen wieder“ daher gar nichts bedeutet, ist der Abschied jedesmal eine kleine Ka-
tastrophe. Trotzdem sei dieser Zustand einer völligen Besuchssperre bei weitem vorzuziehen. „Solange ein Kind noch weinen kann, solange ist es noch nicht wirklich geschädigt.“
Aber der Idealzustand ist damit natürlich keinesfalls erreicht. Dieser lautet vielmehr nach wie vor: eine durchgehende Besuchszeit von 8 Uhr früh bis 7 Uhr abends. Dann fühlen sich die Eltern nicht verpflichtet die ganze Zeit über bei ihrem Kind zu sein, denn das kann niemand. Außerdem können sie sich ihre Zeit einteilen, dazu steht ihnen der ganze Tag zur Verfügung. Und die Kinder stört es nicht, wenn bei ihnen einmal kein Besuch ist, beim Nachbarn aber schon, weil man ihnen
die Unmöglichkeit eines ganztägigen Besuches besser begreiflich machen kann.
Aber für die Durchführung solcher Vorstellungen sind nicht nur bauliche Veränderungen notwendig, sondern vor allem und in erster Linie ein Umdenken, das Verständnis und Mitarbeit von allen fordert. Wenn nur einige wenige die Initiative ergreifen, ist das zuwenig. Daß ein so schöner Versuch wie jener am Mautner-Spital scheitern mußte, ist ein trauriger Beweis für ein unzureichendes Einfühlungsvermögen auf beiden Seiten. Er könnte trotzdem einen Lernprozeß bewirken: wie es anders zu machen ist. m