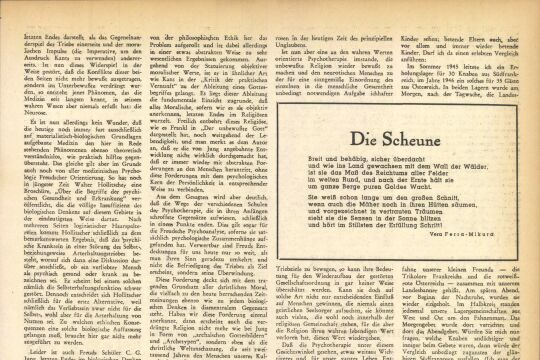Das Virus und wir
DISKURS
Coronakrise: Das Protokoll eines Pflegeheimbewohners
Die Corona-Pandemie ist für Friedrich Schadauer (95) eine von vielen Krisen, die er zu bewältigen hatte. Wie blickt ein Pflegeheimbewohner auf die gegenwärtige Lage? Lesen Sie sein Protokoll.
Die Corona-Pandemie ist für Friedrich Schadauer (95) eine von vielen Krisen, die er zu bewältigen hatte. Wie blickt ein Pflegeheimbewohner auf die gegenwärtige Lage? Lesen Sie sein Protokoll.
Die Corona-Pandemie erinnert mich ein wenig an die Zeit meiner Kriegsgefangenschaft. Damals war es ein Stacheldrahtzaun, der uns einsperrte. Heute ist es ein Virus. In Wahrheit kann man diese Situationen aber nicht vergleichen. Wer im Arrest sitzt, ist zwar unfrei, darf jedoch sehr wahrscheinlich mit dem Leben rechnen. Das ist bei einer schlimmen Krankheit nicht unbedingt der Fall.
Was ich immer wieder höre und lese: Auch junge Menschen vergleichen die Corona-Pandemie mit den Geschehnissen von damals. Ob mich das kränkt oder verärgert? Nein. Vermutlich suchen sie nach einer Möglichkeit, die aktuelle Situation einzuordnen. Tragik bringt jedenfalls beides mit: Krieg und Pandemie. In meinen fast 96 Jahren habe ich auch andere schwere Zeiten erlebt – und alle habe ich durchgestanden. Aber fangen wir von vorne an:
Lebensfremdes „Handy-Kasterl“
Geboren am 9. April 1925 in Waidhofen an der Thaya, einer Stadtgemeinde im nördlichen Waldviertel, wuchs ich als Einzelkind sehr behütet auf – obwohl die wirtschaftliche Situation für meinen Vater, einen Schlossermeister, nicht besonders rosig war. Ich war ein neugieriger, interessierter Bub und ein guter Schüler und besuchte ab 1936 das Gymnasium. Zwei Jahre später geschah meine erste persönliche Katastrophe: Mein Vater starb an Krebs. 1943, kurz vor dem Abschluss der siebten Klasse, berief mich schließlich das Militär ein. Obwohl ich die Schule nicht beenden konnte, erhielt ich mit dem Zeugnis auch die Reifeklausel der Maturanten. Dieses Dokument ist ein Heiligtum für mich. Ich besitze es noch heute. Im August 1943 zog ich in den Krieg und war bis 1945 Soldat der deutschen Wehrmacht. 1944 bereitete man uns auf den Einsatz an der Ostfront vor. Wir sollten die Oder gegen die Russen verteidigen, was damals gar nicht mehr möglich war.
In diesem Alter – ich war gerade einmal 18 Jahre alt – kann man das Wort Krieg und seine Bedeutung nicht begreifen. Ich weiß jedoch eines: Ihn zu führen, kann nicht der Sinn des Lebens sein. Und ich wünsche jedem jungen Menschen, dass er niemals einen Krieg miterleben muss. Ende April des Jahres 1945 kam ich, wie anfangs erwähnt, in russische Kriegsgefangenschaft. Und ich hatte Glück: Die Russen brachten mich nicht Richtung Osten, sondern in ein schlesisches Lager, aus dem sie uns Österreicher bereits im darauffolgenden September entließen. Im November 1945 kam ich endlich nach Hause. Das war ein Gefühl! Ich erinnere mich mit großer Dankbarkeit an den Moment zurück, als ich meine Mutter wieder in die Arme schließen konnte. Als sie sah, dass ich keine Kriegsverwundung hatte, war sie plötzlich zehn Jahre jünger. So feierten wir Weihnachten, meine Mutter, mein Großvater und ich. Wir saßen unter dem Christbaum und freuten uns, dass wir wieder beisammen sein konnten.
Das Glück währte nicht lang: 1947 starb meine Mutter – ebenfalls an Krebs. Mit einem Mal war ich Vollwaise und stand mit meinem 92-jährigen Großvater allein da. Zu dieser Zeit war ich mental doch ein bisschen angeschlagen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!