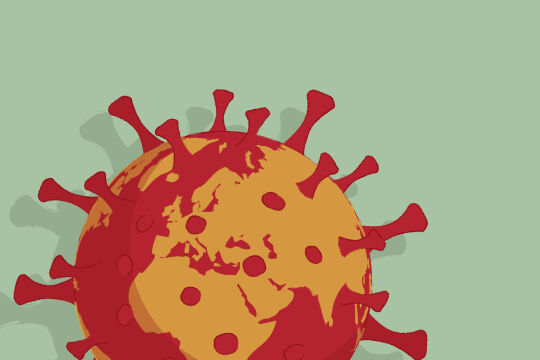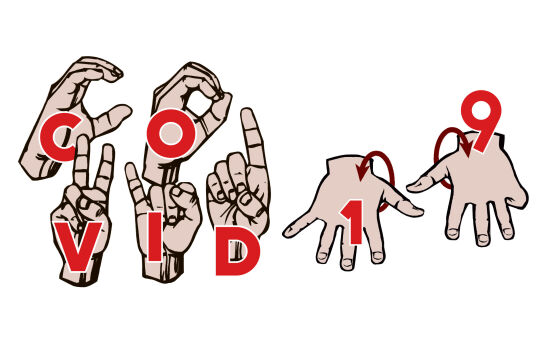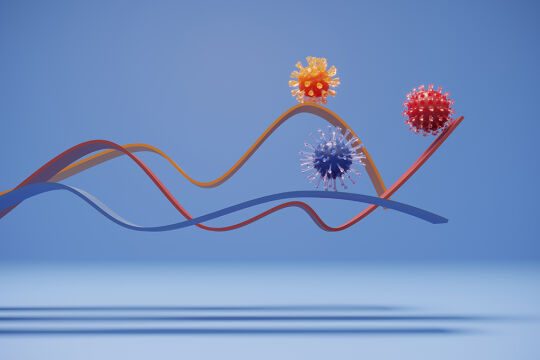Corona und Sterbekultur: Retten wir zu Tode?
Die Frage „Wie sind die Aussichten auf Heilung?“ muss bei Behandlungen immer gestellt werden - und sie hat nichts mit „Triage“ zu tun. Ein Gastkommentar von Maria Katharina Moser.
Die Frage „Wie sind die Aussichten auf Heilung?“ muss bei Behandlungen immer gestellt werden - und sie hat nichts mit „Triage“ zu tun. Ein Gastkommentar von Maria Katharina Moser.
„Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden“, heißt es in Psalm 90. Ich bete diesen Vers dieser Tage sehr bewusst. Denn mir scheint, dass wir in Corona-Zeiten viele Fragen nicht bedenken, vor welche uns die letzte große Herausforderung im Leben, das Sterben, stellt.
„Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit wurden Sterbende so hygienisch aus der Sicht der Lebenden hinter die Kulissen des gesellschaftlichen Lebens fortgeschafft“, schrieb der Soziologe Norbert Elias in seinem erstmals 1979 veröffentlichten Essay „Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen“. In jenen Tagen arbeitete die Hospizbewegung bereits daran, Sterbende und Trauernde nicht der Einsamkeit zu überlassen und das Sterben in den Lebenszusammenhang zu integrieren. Corona konfrontiert uns neu mit der Frage nach Sterben und Tod. Der Tod begegnet uns jeden Tag. Als statistische Entwicklung. Seit Wochen erfahren wir zu Beginn jeder „Zeit im Bild“ die aktuelle Zahl der mit dem Coronavirus Verstorbenen. Diese Zahl ist der Indikator für den Erfolg unserer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung: Leben retten. Der Tod erscheint als Fatum, das bekämpft werden muss. Koste es, was es wolle. Was einmal mehr fortgeschafft wird hinter die Kulisse des gesellschaftlichen Lebens, ist das Sterben. Und mit ihm Fragen, die vor Corona bedacht wurden. Fragen, die in der öffentlichen, politischen und medialen Debatte zu bedenken uns auch in Zeiten von Corona klug machen würde.
Nötige Stimmen aus der Palliativmedizin
Da ist die Frage nach den Kapazitäten des Gesundheitssystems. Täglich hören wir, wie viele an Covid-19 erkrankte Menschen auf der Intensivstation sind und wie viele freie Intensivbetten es noch gibt. Wie aber schaut es aus mit einem palliativen Pandemie-Plan? Haben wir ausreichend Kapazitäten, um sicherzustellen, dass alle Patienten eine optimale Palliativversorgung bekommen? Neben Virologinnen und Epidemiologen, Infektiologen und Intensivmedizinerinnen auch Stimmen aus der Palliativmedizin und Hospizbewegung zu hören wäre wichtig für ein ganzheitlicheres und wohl informiertes Bild – und auch, um den Horrorgeschichten über qualvolles Ersticken am Krankenhausgang oder Euthanasie in Pflegeheimen aus Italien und dem Elsass, die im Netz herumschwirren, den Stachel zu ziehen.
Der ,Erfolg‘ im Umgang mit der Corona-Krise bemisst sich auch daran, welche Sterbekultur wir pflegen.
Der starre Blick auf die Intensivbetten führt in der öffentlichen Wahrnehmung zu dem Bild: Jede Person, die an Covid-19 erkrankt, muss ein Intensivbett und künstliche Beatmung bekommen. Jede. Nicht: jede, die dies braucht. Wer tatsächlich eine intensivmedizinische Intervention braucht, hängt – ganz unabhängig von der Corona-Krise – davon ab, ob die Behandlung medizinisch sinnvoll und von der Patientin gewollt ist. Die Corona-Krise ist wie eine Lupe, unter der sich grundsätzliche Fragen deutlicher zeigen, wenn wir denn hinschauen. Immer und ganz besonders dann, wenn multimorbide Menschen erkranken, muss gefragt werden (und das hat nichts mit Triage zu tun): Wie steht es mit den Aussichten auf Heilung? Liegt eine Indikation für eine lebensverlängernde Behandlungsmaßnahme vor – oder würde eine solche dem Patienten mehr schaden als nutzen, und ist folglich von kurativer auf palliative Therapie umzustellen? Die Festlegung des Therapieziels ist eine Gratwandung zwischen Untertherapierung und Übertherapierung.
Die ethische Reflexion hat gezeigt, dass hierzulande die Gefahr höher ist, in Richtung Übertherapierung abzugleiten als in Richtung Untertherapierung. Die zweite Gefahr ist die einer Intensivbehandlung ohne Klärung des Patientenwillens – ebenfalls ein „altes“ Problem, das nun einmal mehr deutlich wird: Wenn medizinische Notfälle eintreten, besteht häufig großer Handlungsdruck, der medizinische Interventionen mit dem Ziel der Lebenserhaltung quasi automatisch ablaufen lässt. In vielen Pflegeeinrichtungen von Trägern, die (wie auch die Diakonie) Mitglieder im Dachverband Hospiz sind, wurde daher das Instrument des „Vorsorgedialogs“ eingeführt. Beizeiten wird mit den Bewohnern und Bewohnerinnen über ihre Vorstellungen und Wünsche für die Sterbephase gesprochen. Auch darüber, welche Behandlungen noch gemacht werden sollen und welche nicht. Solche Gespräche und verbindliche Festlegungen zu Therapieeskalation bzw. Therapielimitation braucht es auch bei der Aufnahme von Covid-19-Patienten in stationäre Behandlung, wie die deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin in ihren Handlungsempfehlungen festhält.
Das Sterben vor, nach und mit Corona
Es gilt – wie der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Johann Hinrich Claussen, formuliert hat – zu fragen, „ob wir nicht in die Gefahr geraten, Menschen zu Tode zu retten, deren Lebensende absehbar ist“. Ja, Covid-19 führt bei schwerer Komorbidität in vielen Fällen zum Tod. So wie vor Corona gestorben wurde und nach Corona gestorben werden wird, wird auch mit Corona gestorben.
Das gilt es in den Blick zu nehmen. Nicht weil wir vor dem Virus kapitulieren, sondern weil sich der „Erfolg“ im Umgang mit der Corona-Krise auch daran bemisst, welche Sterbekultur wir pflegen. Die Sterbephase bewusst gestalten. In Würde und Intimität. In Beziehung. Gemäß dem Leitsatz der Hospizbewegung „Low tech and high touch“. Schmerzen, Angst, Atemnot durch gute palliative Versorgung lindern. Raum schaffen für die Verarbeitung des eigenen Todes und der Lebensgeschichte. Begleitet von Angehörigen, Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Raum und ausreichend Zeit, um sich zu verabschieden. Wichtige Momente einer guten Sterbekultur. Wie können wir auch unter Corona-Bedingungen, die geprägt sind von Distanzgeboten und Besuchsverboten, darauf achten? Es ist jetzt, wo über Schritte in Richtung Lockerung und Normalisierung nachgedacht wird, hoch an der Zeit, diese Fragen zu stellen. Zum Wohle von Covid-19-Patienten und aller anderen, die in diesen Tagen sterben oder geliebte Menschen an den Tod verlieren.
Die Autorin ist Direktorin der Diakonie Österreich und evangelische Pfarrerin.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!