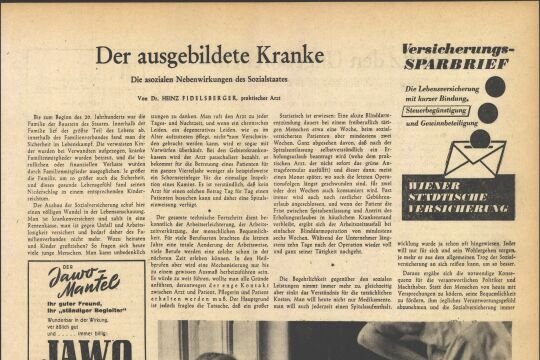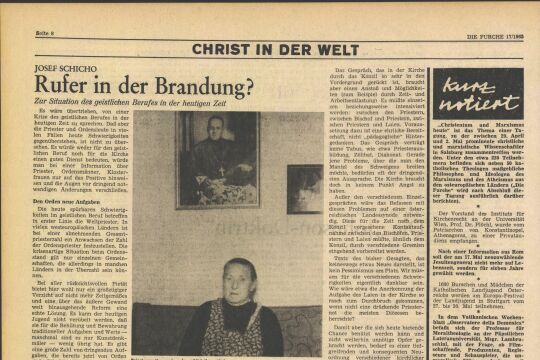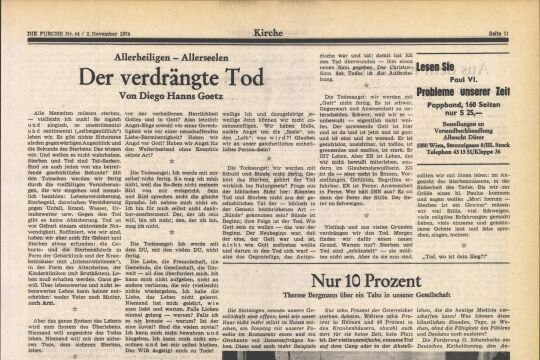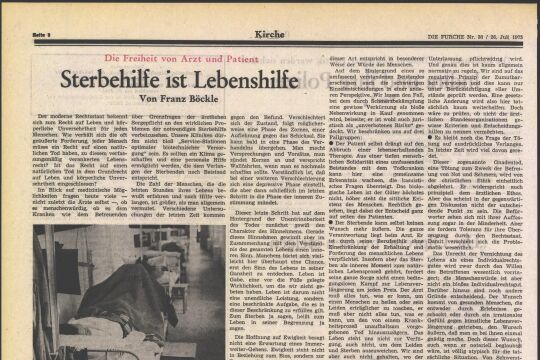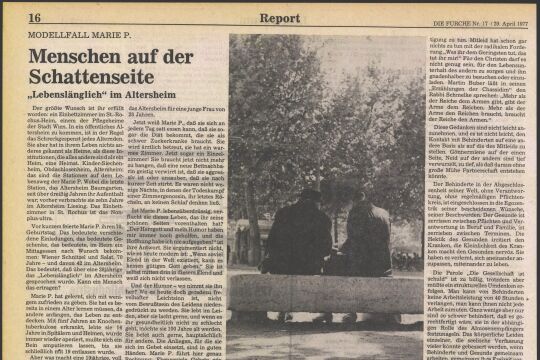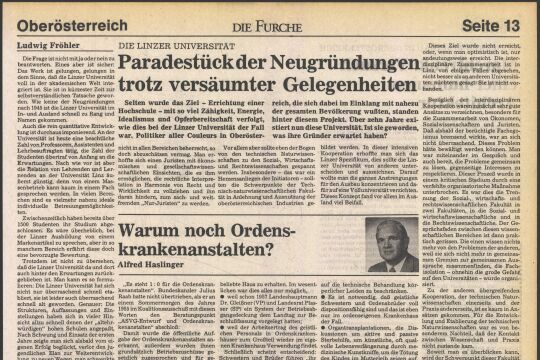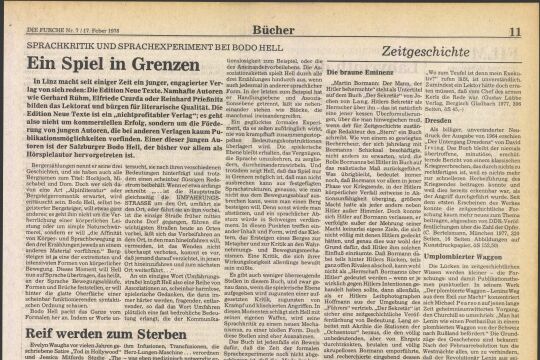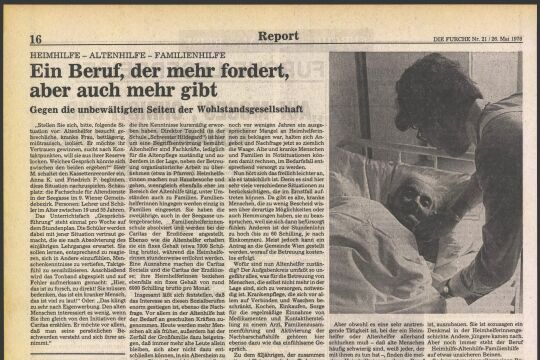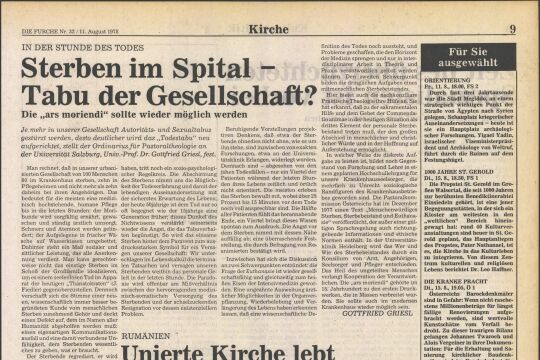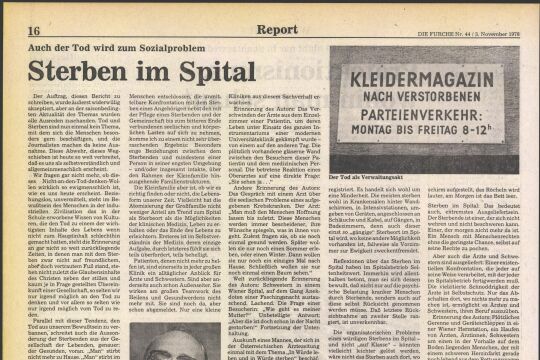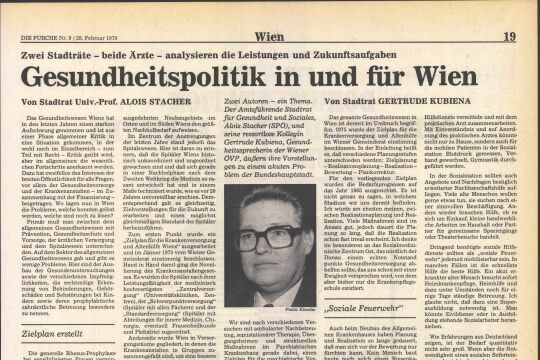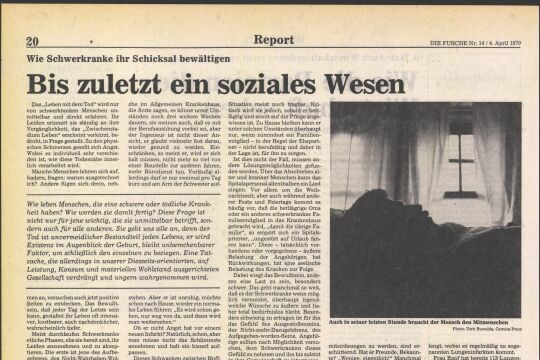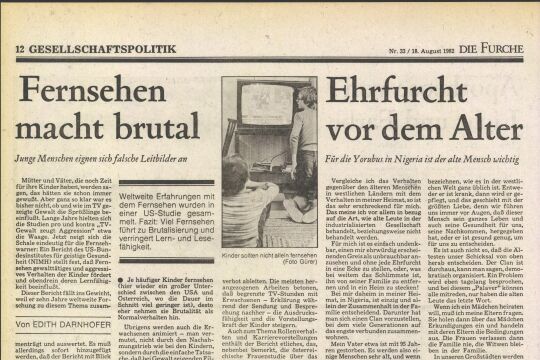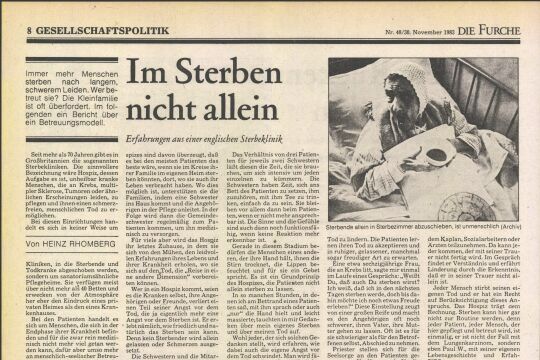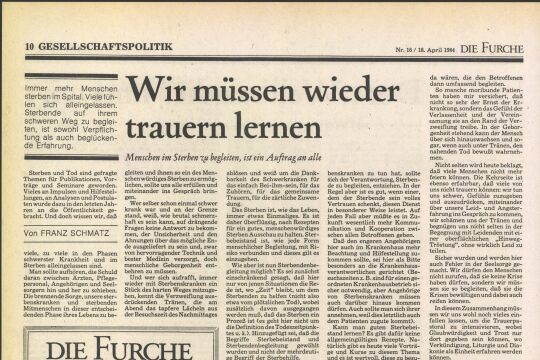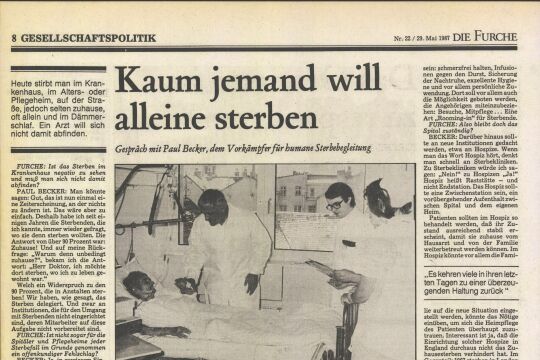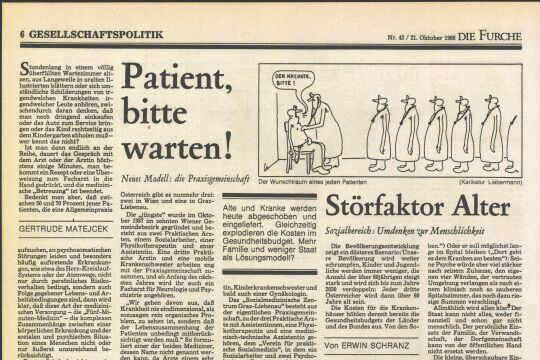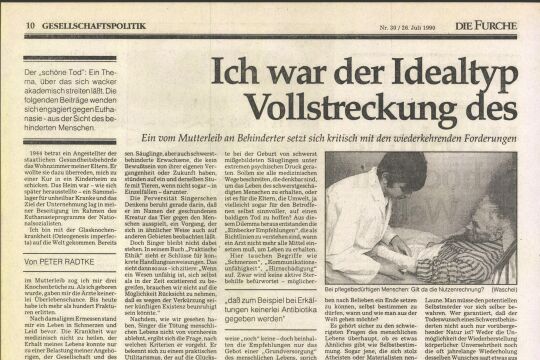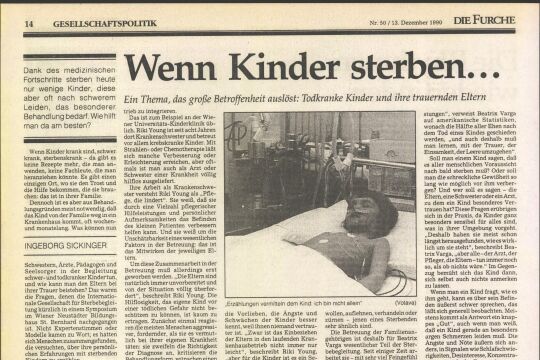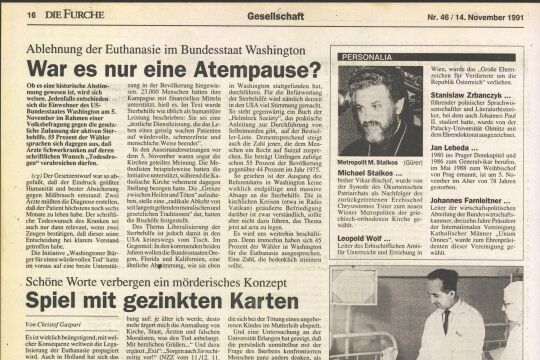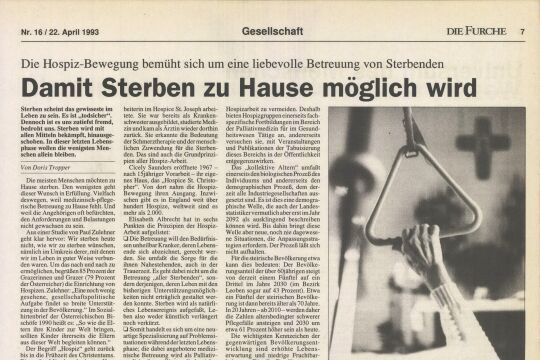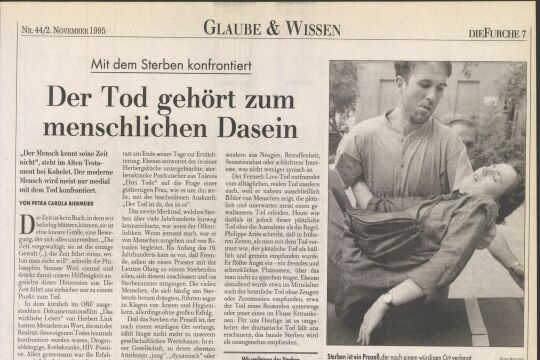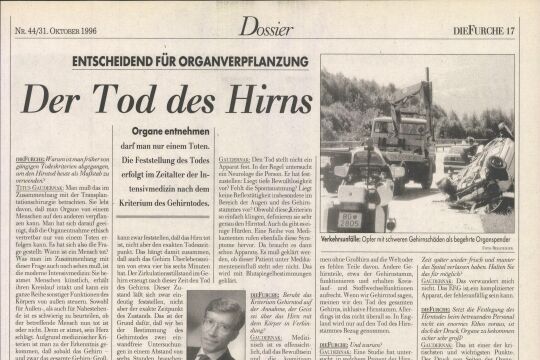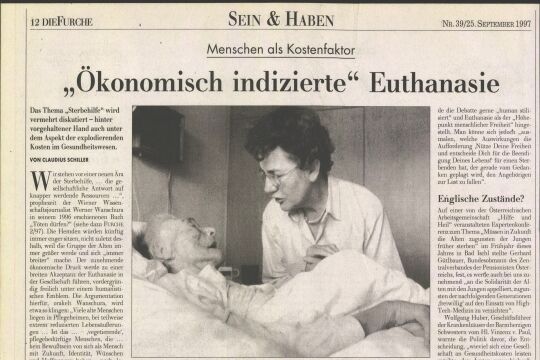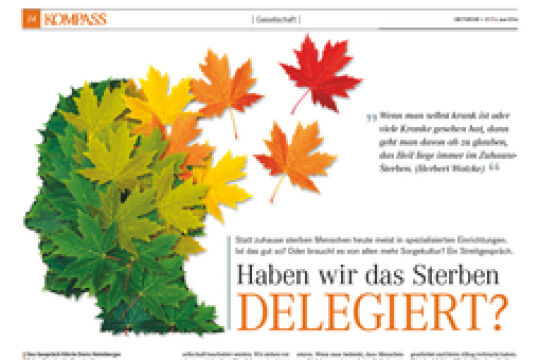Gutes Sterben
DISKURS
Sterbewelten zwischen Wunsch und Realität
Welche Vorstellungen haben schwerkranke, hochbetagte Menschen oder Angehörige Verstorbener vom „guten Sterben“? Ein Forschungsprojekt sucht nach Antworten.
Welche Vorstellungen haben schwerkranke, hochbetagte Menschen oder Angehörige Verstorbener vom „guten Sterben“? Ein Forschungsprojekt sucht nach Antworten.
Sie kennen sicher diese Zahl: 80 Prozent der Menschen wollen zu Hause sterben. Dieser Prozentsatz prägt die Debatte, er wird gern in Zeitungsartikeln zitiert, und er war 2015 auch in der parlamentarischen Enquete "Würde am Ende des Lebens" von Bedeutung, bei der vor allem der Ausbau der Palliativversorgung im Mittelpunkt stand.
Die Frage nach den präferierten und faktischen Sterbeorten (49 Prozent der Menschen in Österreich sterben heute im Krankenhaus, 26 Prozent zu Hause und 19 Prozent im Heim, Anm.) hat auch -quantitative - Forschungsprojekte beschäftigt. Doch solche Befragungen mit vorgegebenen Antwortkategorien kranken an zwei Problemen: Erstens weiß man nicht, was Menschen unter "zu Hause" verstehen; und zweitens sind jene, die in quantitativen Studien befragt werden, in der Regel noch nicht unmittelbar mit dem Sterben konfrontiert.
29 qualitative Interviews
Wie aber würden jene Betroffenen, die schon am Ende ihres Lebens stehen oder ihrerseits sterbende Menschen begleitet haben, die Frage nach dem "guten Sterben" beantworten? Was bedeutet "gutes Sterben" konkret, wo und unter welchen Rahmenbedingungen ist es möglich, wodurch ist es bestimmt und was kann dazu beitragen? Diese Perspektiven sind empirisch bislang überraschend unterbelichtet geblieben.
Im Rahmen des Projektes "Sterbewelten in Österreich" - gefördert vom Jubiläumsfonds der Nationalbank, geleitet vom Institut für Palliative Care und Organisationsethik der Universität Klagenfurt und durchgeführt in Kooperation mit dem Institut für Höhere Studien, dem Institut für Ethik und Recht in der Medizin der Uni Wien und der Katholischen Privatuniversität Linz -wollen wir diese wichtigen Facetten beleuchten.
Seit Jänner dieses Jahres haben wir 29 qualitative Forschungsinterviews mit Menschen in Tirol, Kärnten und Wien geführt, die konkret vom Thema Sterben betroffen sind -sei es, weil sie fortgeschritten und unheilbar krank sind, sei es, weil sie hochbetagt sind oder weil sie einen Angehörigen beim Sterben begleitet haben. Dabei wurde auch auf unterschiedliche Versorgungskontexte geachtet -vom Alten-und Pflegeheim bis zur häuslichen Versorgung, vom Hospiz bis zur Palliativstation oder ambulanten Palliativversorgung. Bis Juni 2018 werden die Befragungen endgültig ausgewertet sein, doch schon jetzt gibt es erste Zwischenergebnisse.
Das erste Ergebnis betrifft die Frage, warum Betroffene überhaupt über das Sterben reden möchten. Wir selbst standen schließlich vor der Herausforderung, Gesprächspartnerinnen und -partner zu finden, die sich diesem existenziellen Thema stellen wollen. Das eigene Sterben lässt schließlich niemanden kalt. Wir haben sogenannte "Türöffnerinnen" gebeten, uns zu helfen - professionell Betreuende in Organisationen, die Angehörige in ihrer Trauer oder Menschen am Lebensende begleiten.
Manche der Gefragten haben das Gespräch mit uns abgelehnt, viel öfter aber waren wir willkommen. Es gab dabei vor allem drei Motive, mit uns zu sprechen: Das Bedürfnis nach Reflexion; das Bedürfnis, ein Vermächtnis zu hinterlassen, Zeugnis abzulegen; und das Bedürfnis, zur Forschung beizutragen. In fast jedem Interview gab es aber "eine große Erzählung", einen Grund, warum das Gespräch geführt wird, - zum Beispiel "Ich bin eine Vorzeigegläubige" oder "Dieses Netzwerk [die Familie] ist wunderbar".
"Wie" ist wichtiger als "Wo"
Die zentrale Präferenz eines konkreten Sterbeortes hat sich in unseren Interviews hingegen nicht bestätigt. Eine Interviewpartnerin hat uns etwa gesagt, dass das Pflegeheim, in dem sie seit Jahren lebt, ihr erstes wirkliches Zuhause sei. Es gab freilich Ausnahmen: Ein unheilbar kranker Gesprächspartner meinte, "die Klinik ist nicht gut für Sterbende", weil es keine Zeit für Gespräche gäbe; und eine andere hochbetagte und alleine lebende Gesprächspartnerin wünschte sich, im Hospiz zu sterben.
Viel wichtiger als der konkrete Versorgungsort ist den Betroffenen die Frage der Sorgenetzwerke, also die Beziehungen, die sie leben, die Menschen, die sich um sie sorgen und ihre Begleitung übernehmen. Unter anderem gibt es Erzählungen von der Versöhnung mit der Familie, von der Schwägerin, mit der der Interviewte bisher nicht so viel Kontakt hatte und die jetzt, kurz vor dem Lebensende, zur zentralen Bezugsperson wird, oder vom eigentlich nicht so gut bekannten Nachbarn, der überraschender Weise der erste ist, mit dem eine Befragte im ersten Schock darüber sprechen kann, dass der Ehemann gerade von seiner unheilbaren Krankheit erfahren hat.
Dieser Nachbar ist dann auch da und tröstet, als der Mann gestorben ist. Oder der Pfarrer, der sich bereit erklärt, das Begräbnis zu halten, obwohl der Interviewpartner aus der Kirche ausgetreten ist. Oder die Arbeitskollegen, die einer Angehörigen nach dem tragischen Tod des Ehemanns einen normalen Alltag ermöglichen. Auch die Einsamen unter den Befragten -und wir hatten den Eindruck, dass bei einigen erhebliche Einsamkeit im Spiel war -sprechen von der Bedeutung der sozialen Beziehungen.
Alltag am Lebensende
Obwohl die Konfrontation mit dem Sterben in der wissenschaftlichen Literatur als eine "außeralltägliche" Situation beschrieben wird, haben wir von vielen Interviewpartnern gehört, dass es darum geht, mit und trotz der Omnipräsenz des Sterbens so etwas wie "Alltag" zu schaffen. Und dass es auch tatsächlich einen solchen Alltag gibt -mit Wäschewaschen, Kuchen backen und Spazieren gehen.
Es gibt auch unterschiedliche Strategien, sich selbst nach dem Tod eines Angehörigen einen erträglichen Alltag zu ermöglichen: einfach weiterarbeiten und am nächsten Tag wieder in den Dienst gehen, nachdem der Mann zu Hause gestorben ist; oder sich selbst zu einem Genuss verhelfen, indem man sich ins Auto schleppt und an einen schönen Ort fährt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!