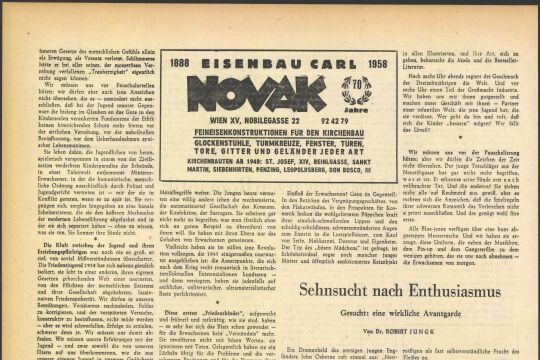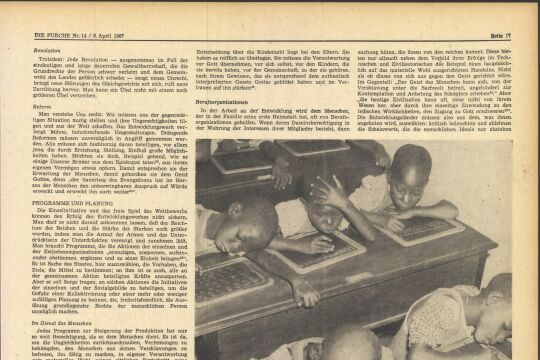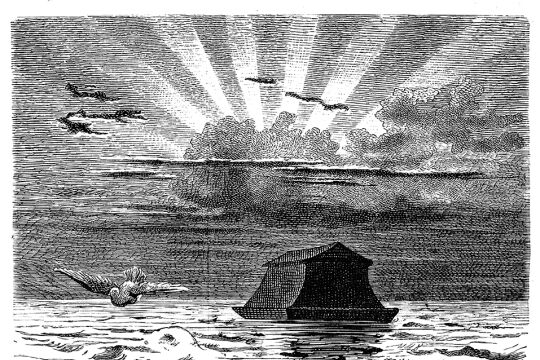Lebendigkeit
DISKURS
Replik auf Marianne Gronemeyer: Was heißt hier "Leben"?
Es sei falsch, in der Corona-Pandemie die Lebendigkeit der Todesbekämpfung zu opfern, schrieb Marianne Gronemeyer vergangene Woche. Verharmlost sie das Virus? Eine Replik.
Es sei falsch, in der Corona-Pandemie die Lebendigkeit der Todesbekämpfung zu opfern, schrieb Marianne Gronemeyer vergangene Woche. Verharmlost sie das Virus? Eine Replik.
Welche gesellschaftlichen Tabus lassen sich erkennen, wenn Marianne Gronemeyer in ihrer Kritik am Umgang mit der Corona-Pandemie die Ablehnung ihrer Position einen Absatz lang selbst vorwegnimmt? Sie nennt sie beim Namen: das unersättliche technogene Sicherheitsbedürfnis, die Spirale der Aufrüstung gegen den zum Skandal erklärten Tod, das Streben nach Beherrschbarkeit von Leben und Tod.
Gleichwohl beschleicht einen ein gewisses Unbehagen. Verharmlost Gronemeyer hier die Gefahren der Pandemie? Spielt sie den Verschwörungsmythen der Corona-Leugner und Impfgegner in die Hand? Wie klingen ihre Worte in den Ohren von jemandem, der durch das Virus einen lieben Menschen verloren hat? Und ist ihre Vision einer „convivialen Tischgemeinschaft“ nicht schlicht und ergreifend naiv? Niemand kann wollen, dass man angesichts der Bedrohung menschlichen Lebens durch Krankheit und Tod wissenschaftliche Forschung und politische Maßnahmen einstellt. Es gibt gute Gründe, verwundert den Kopf zu schütteln.
Man kann in der Kritik Gronemeyers aber auch Fragen hören, die wir uns tatsächlich stellen sollten – denn diese Krise wird nicht die letzte sein. Das Anthropozän hält in den kommenden Jahrzehnten weitere bereit: nicht zuletzt die Klimakatastrophe wird neben den ökologischen auch viele sozioökonomische und politische Probleme mit sich bringen.
Werteforschung und religionssoziologische Studien belegen, dass der Schutz persönlicher Sicherheit zu einem der höchsten Werte mutiert ist. Dies verbindet sich mit der Erosion jeglichen Bezugs zu Transzendenz. In Österreich sind drei Viertel der Bevölkerung davon überzeugt, dass der Sinn des Lebens in sich selbst liegt und sich dieser durch die Naturgesetze erklären lässt. Der Glaube an ein Leben nach dem Tod, der Glaube an Gott oder eine gute Zukunft sinken. Dieser Immanentismus führt dazu, dass das „Leben als letzte Gelegenheit“ betrachtet wird, wie es Gronemeyer bereits 1993 beschrieben hat. Der Tod wird zum absoluten, nahezu divinisierten Feind, dessen Herrschaft bekämpft werden muss. Welchen Preis sind wir in diesem Kampf zu bezahlen bereit? Die weltweite Armut war laut UNO bereits im Frühjahr 2020 auf das Niveau von 2010 gestiegen. Wer wird die Schulden bezahlen? Wie wird das Wirtschaftssystem „nach der Impfung“ auf die zu erwartenden Verteilungskämpfe reagieren? Welche psychischen und sozialen Schäden nehmen wir bei einer Krisenbekämpfung in Kauf? Wird hier nicht die Zukunft der nächsten Generation massiv gefährdet?
Das Leben der Flüchtlinge lässt uns kalt
Fragen lässt sich auch, welches Verständnis von „Leben“ dem Kampf gegen die Pandemie zugrunde liegt. Der Philosoph Giorgio Agamben kritisierte, dass in unseren Gesellschaften nur mehr der Schutz des nackten, biologischen Lebens im Zentrum stehe. Welchen gesellschaftlichen Wert hat demgegenüber das „conviviale Leben“, das Gronemeyer ins Spiel bringt? Ist es nicht schon länger zur Privatsache erklärt und fristet in den wenigen freien Nischen einer ökonomisierten Gesellschaft sein für viele mühsames Dasein? Und hat die Rettung des Lebens tatsächlich Vorrang vor allem anderen? Wessen Leben? Das Leben ertrunkener Menschen im Mittelmeer lässt uns vergleichsweise kalt. Auch die politischen Maßnahmen zielen ja vor allem darauf ab, die Pandemie zu entschleunigen, um nicht zu viele Kranke und Tote auf einmal zählen zu müssen. Ginge es wirklich um das Leben jedes einzelnen, würden wir nicht nur Statistiken sehen, sondern als Gesellschaft auch die täglich an Corona Verstorbenen betrauern.
Gronemeyers Kritik basiert auf einer christlichen Anthropologie, die dem Schutz menschlichen Zusammenlebens höheren Wert einräumt als dem wissenschaftlichen und technischen Fortschritt. Ihr Rückgriff auf biblische Bilder der Verheißung einer Tischgemeinschaft belegt dies. Genauso könnte man den christlichen Glauben als naiv bezeichnen. Problematisch an ihren Überlegungen aber ist die dualistische Schwarz-Weiß-Malerei. Das „Böse“ liegt allein bei der technogenen Logik, alles Gute bei der convivialen Lebensweise. Aber auch Ivan Illich hat seine Kritik am Verhältnis des Menschen zu seinen „Werkzeugen“ (i.e. Technik) nicht so extrem gemalt. Wie auch für den christlichen Glauben hat Technik eine Dienstfunktion. Zerstörerisch wird ihr Gebrauch, wenn sie statt der Förderung des Zusammenlebens der individuellen oder politischen Machtanreicherung dient und das menschliche Handeln beherrscht.
Aus dieser Sicht aber müsste dann gefragt werden, ob das Handeln in westlichen Gesellschaften nicht tatsächlich primär von technischen, wissenschaftlichen und ökonomischen Vorgaben zuungunsten der Convivialität bestimmt ist. In den Blick kommen müssten auch alle Initiativen, die schon längst um Convivialität ringen. Gronemeyers Gedanken wecken – wie der christliche Glaube – gefährliche Fragen. Legt die Pandemie nicht doch offen, wie sehr wir uns in eine szientistische und technokratische Dynamik verrannt haben? Gilt uns conviviales Leben nur mehr als naive Fantasie? Und muss das ihr innewohnende politisch-kritische Potential deshalb müde und abgeklärt, zynisch und empört abgewehrt werden?
Die Autorin ist Leiterin des Instituts für Praktische Theologie der Katholisch-Theologischen Fakultät d. Universität Wien.
Lesen Sie hier die Replik von Franz Tutzer auf den Beitrag von Regina Polak.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!