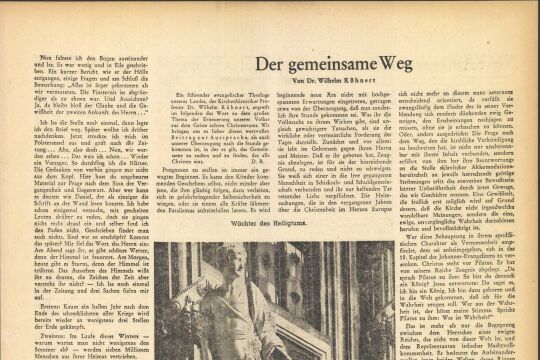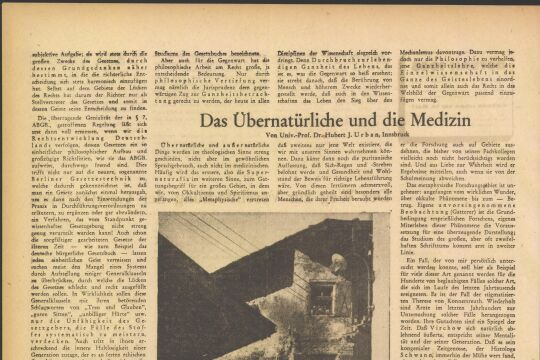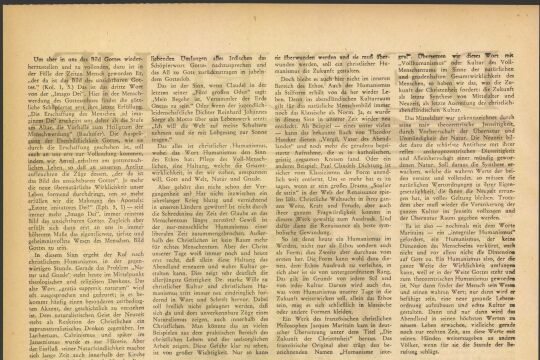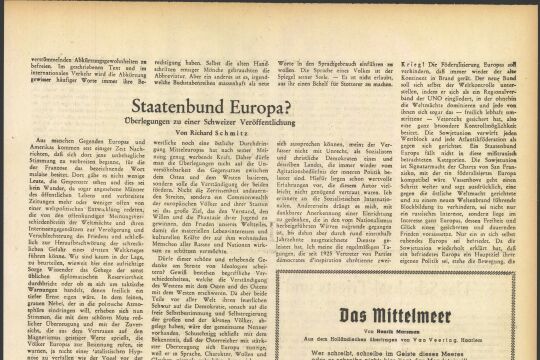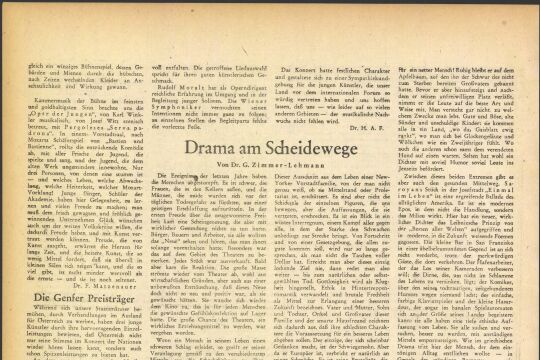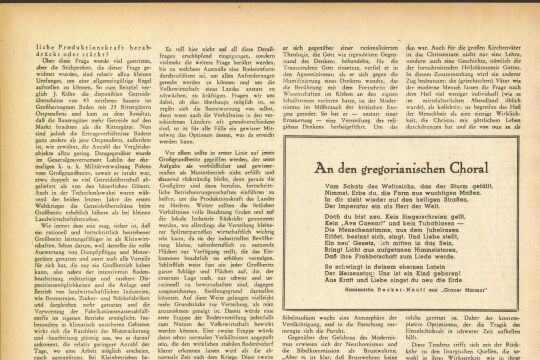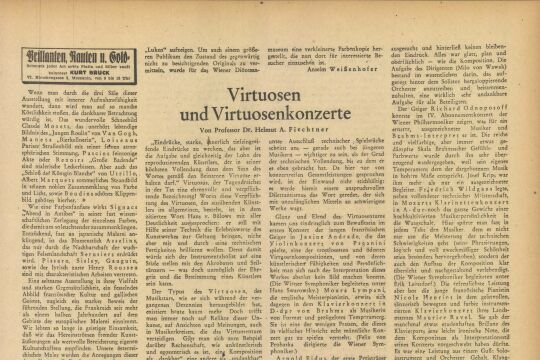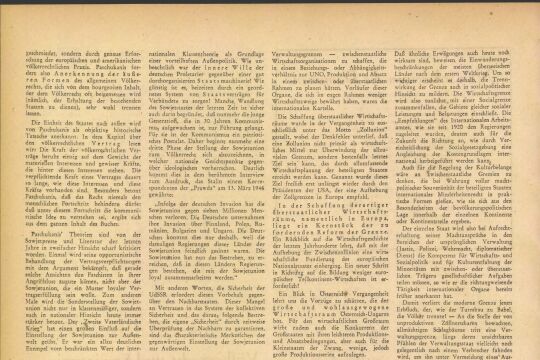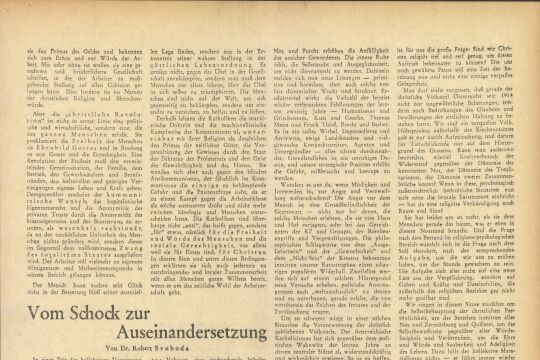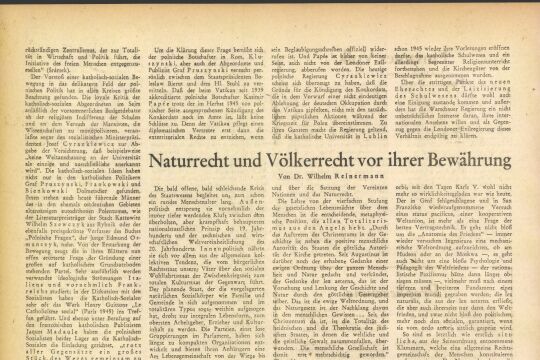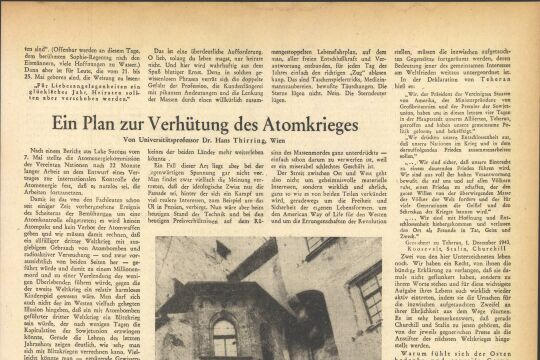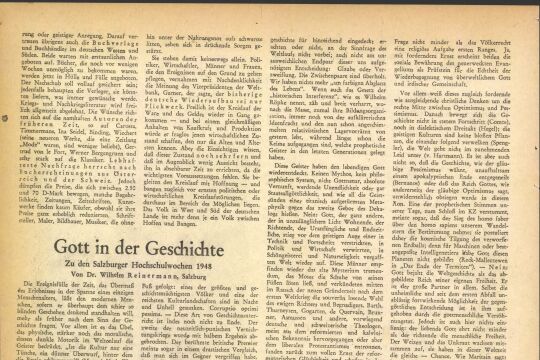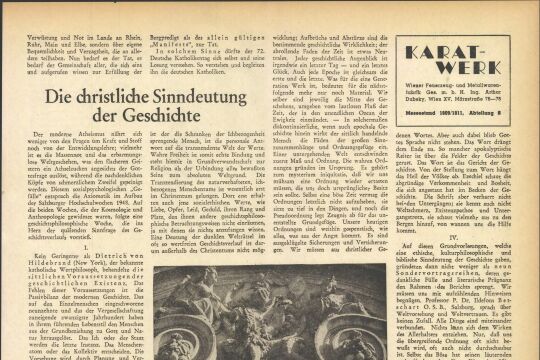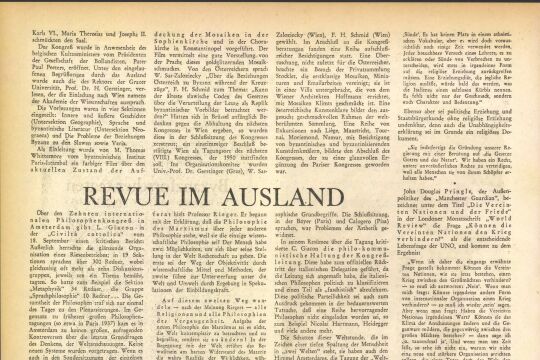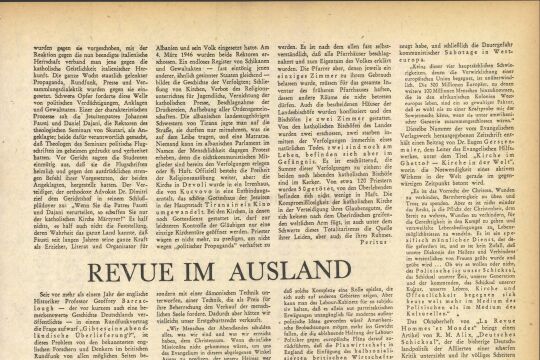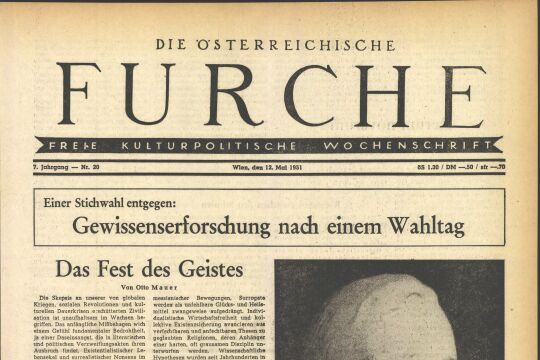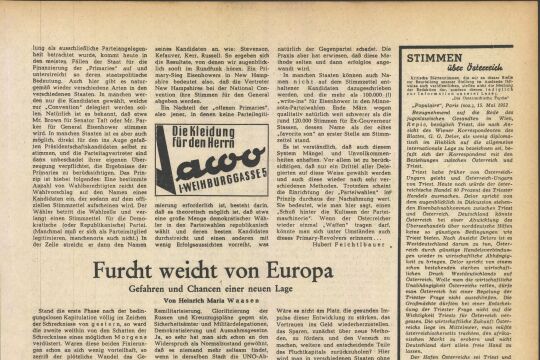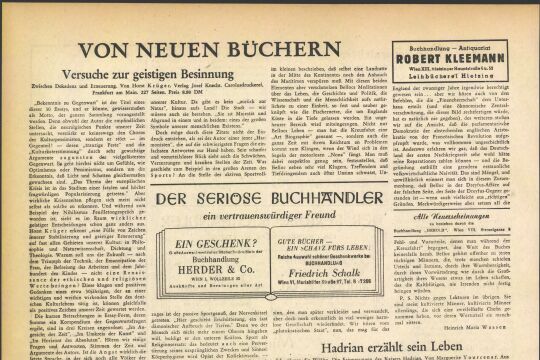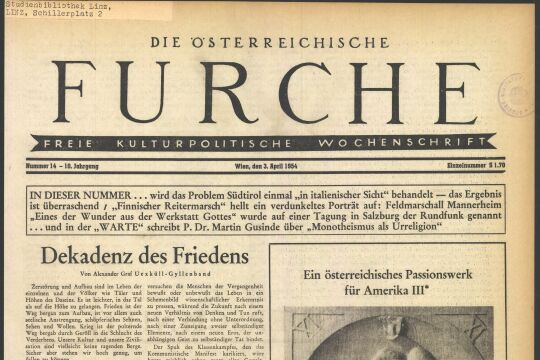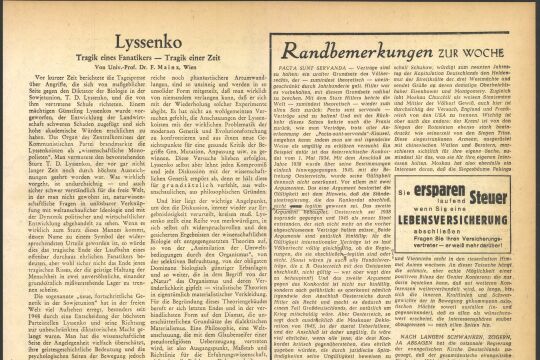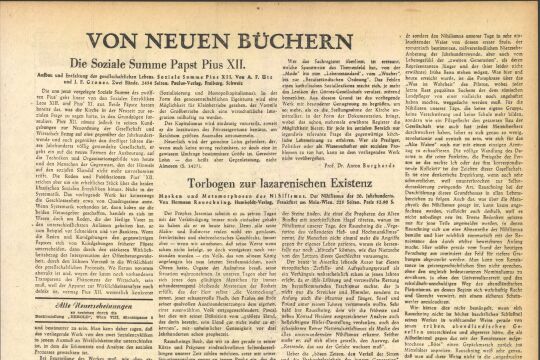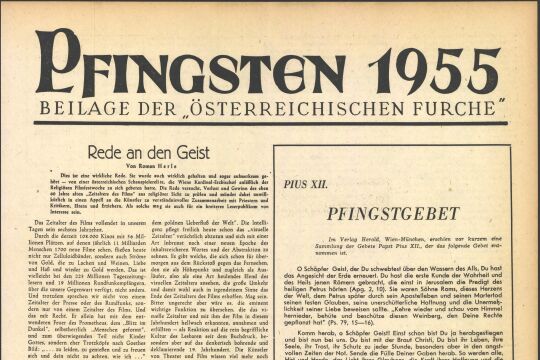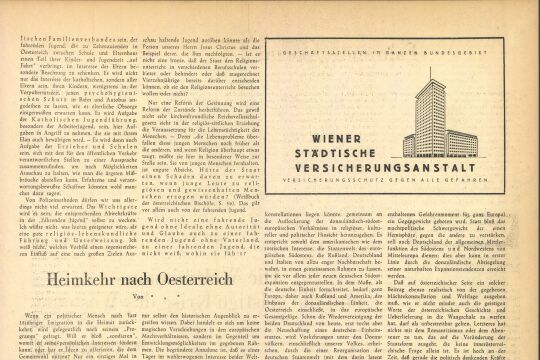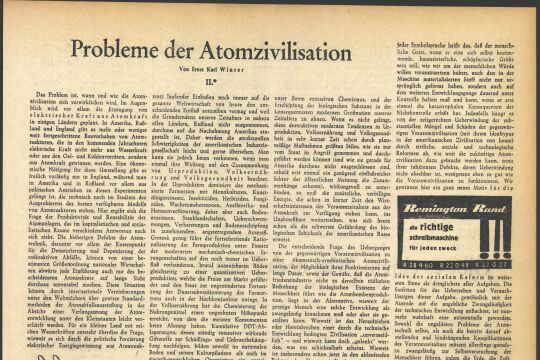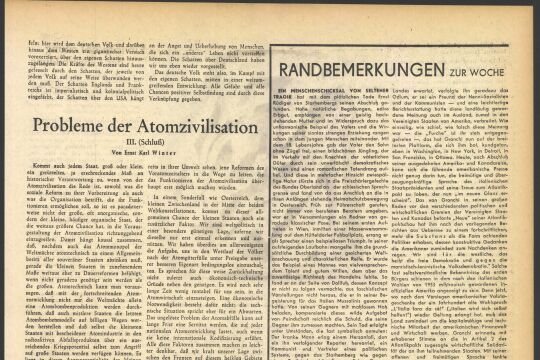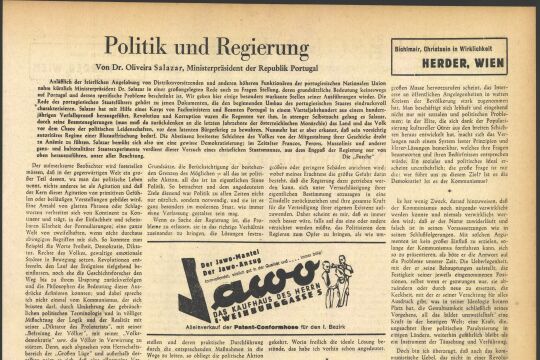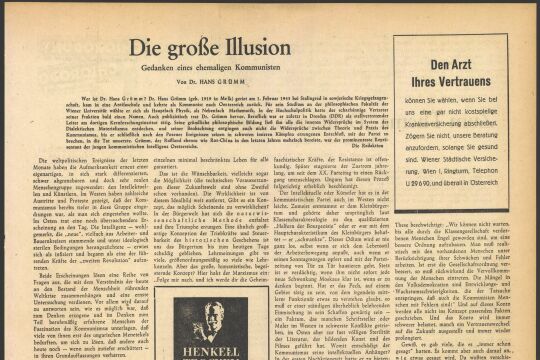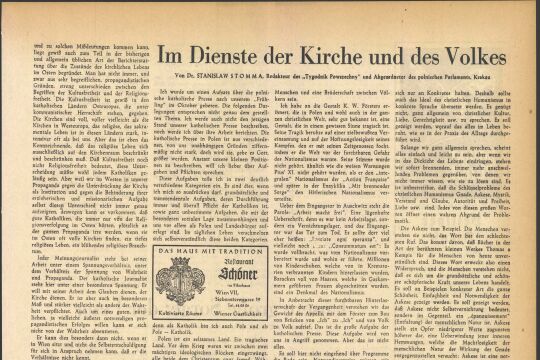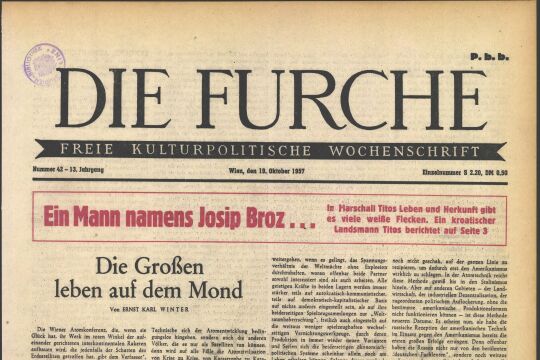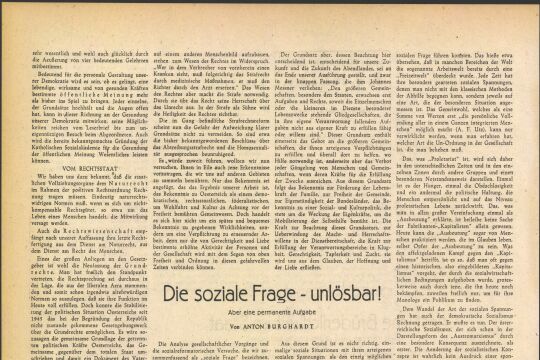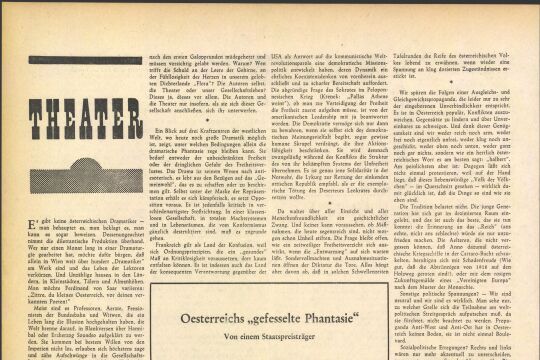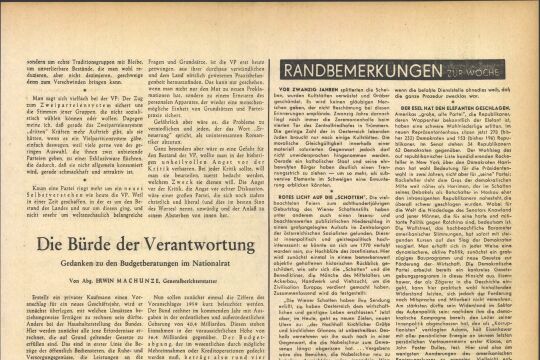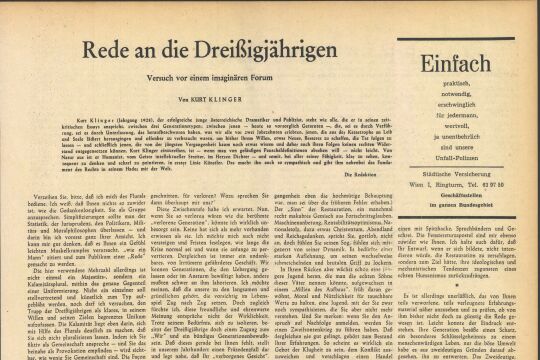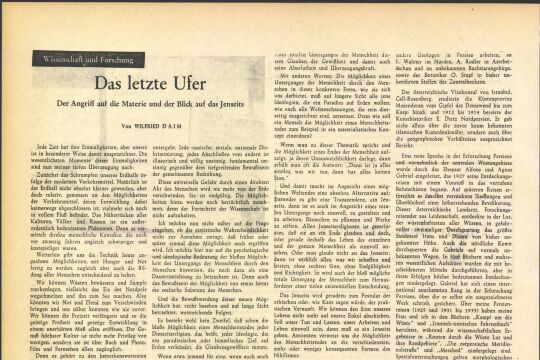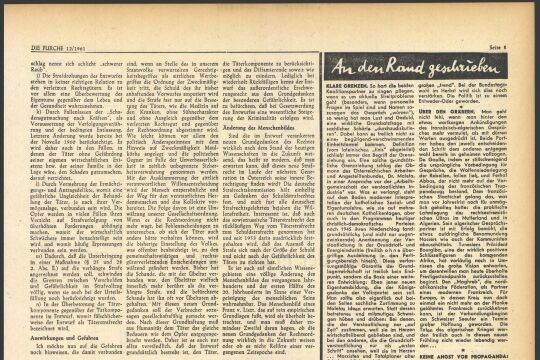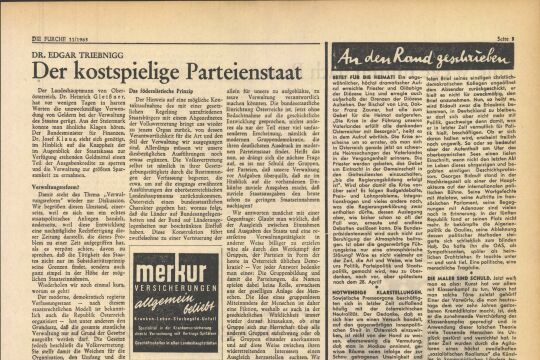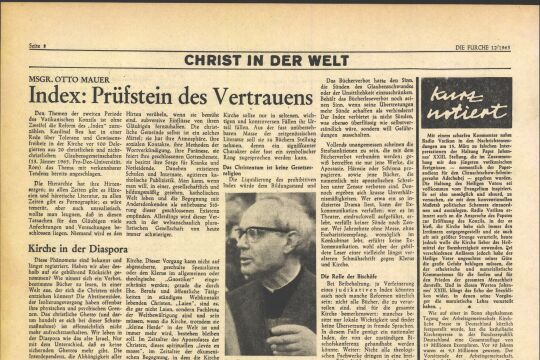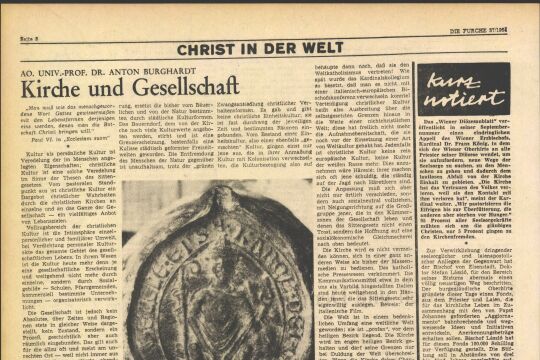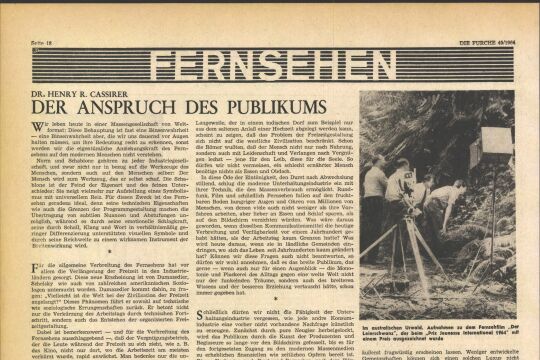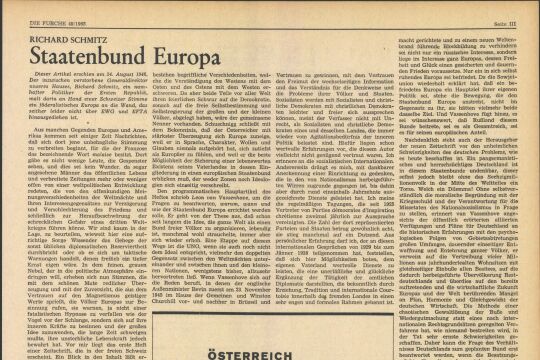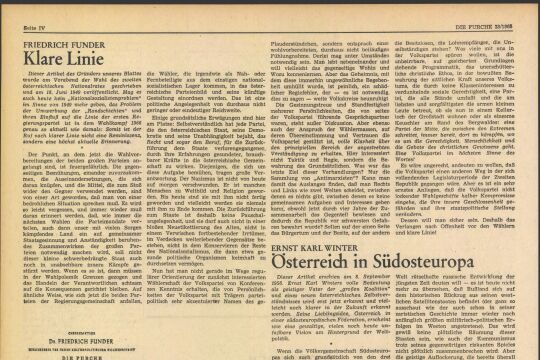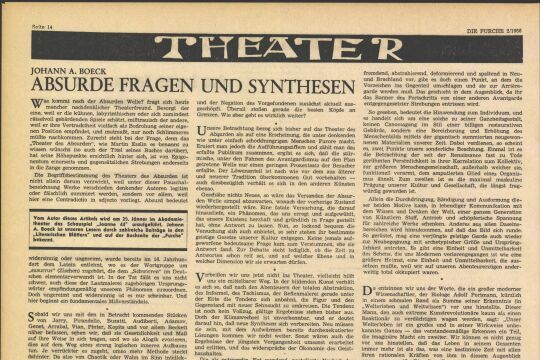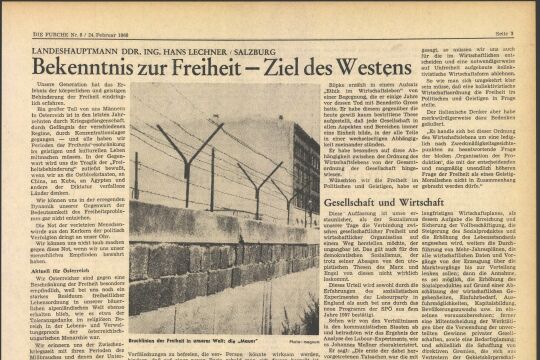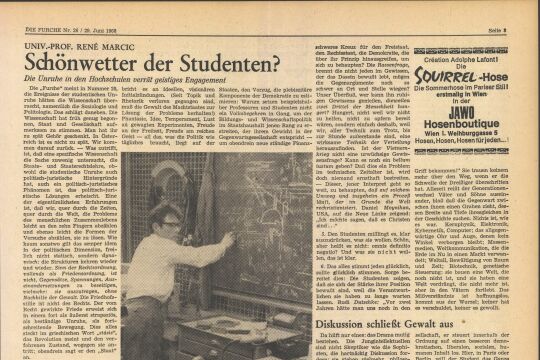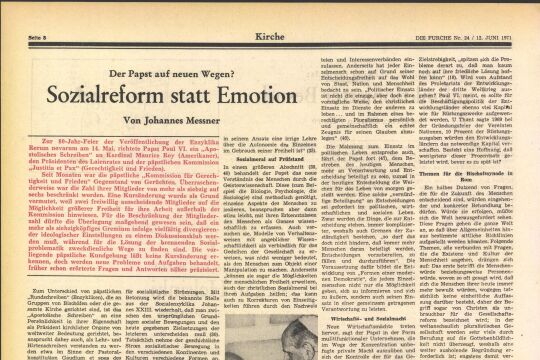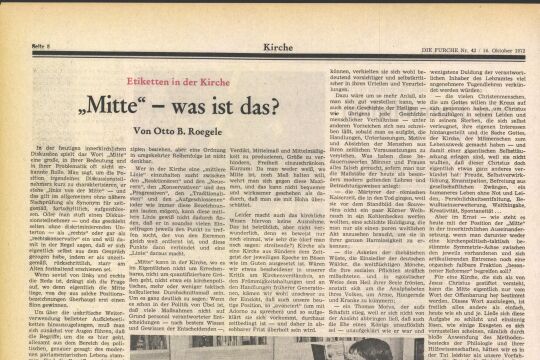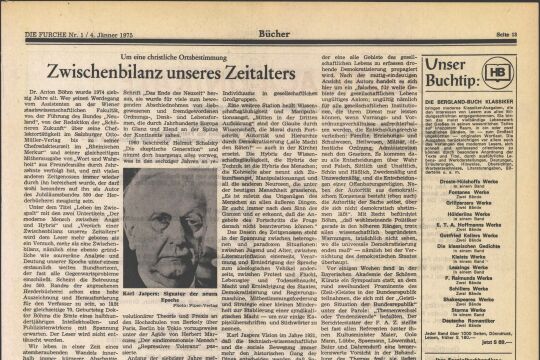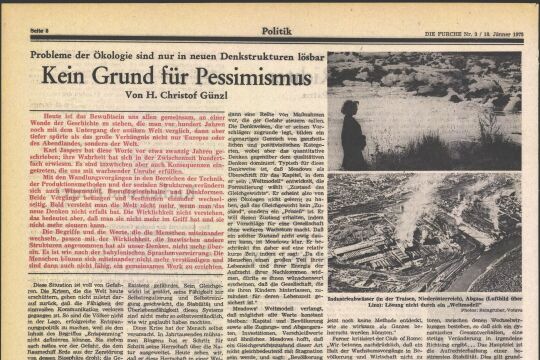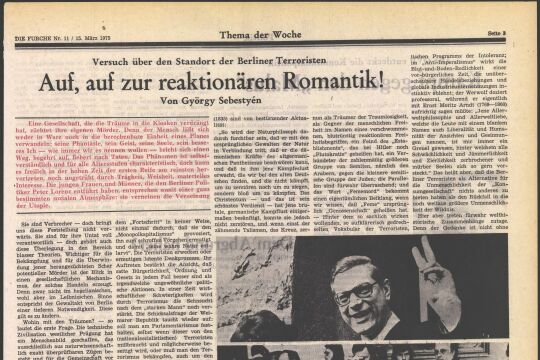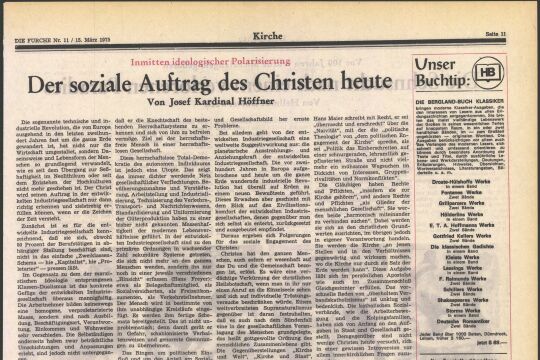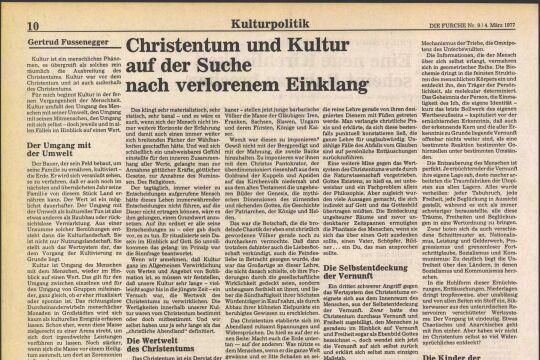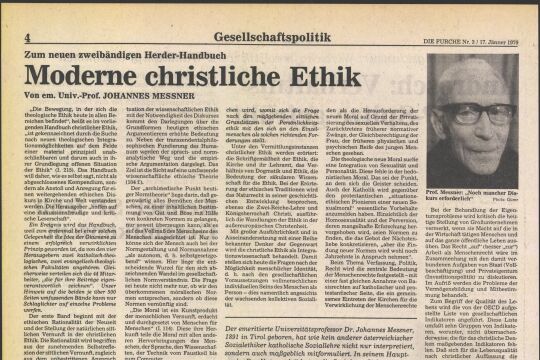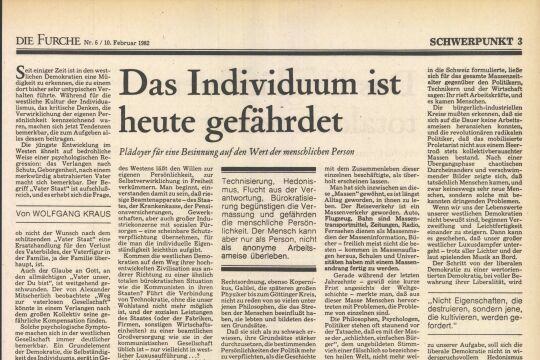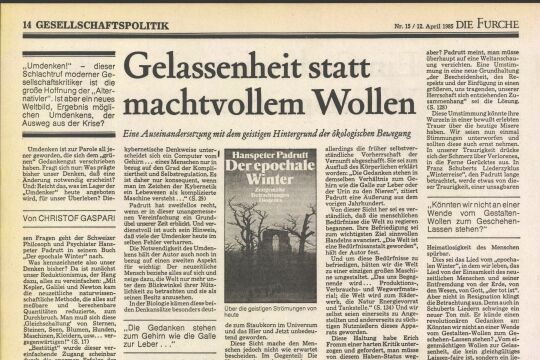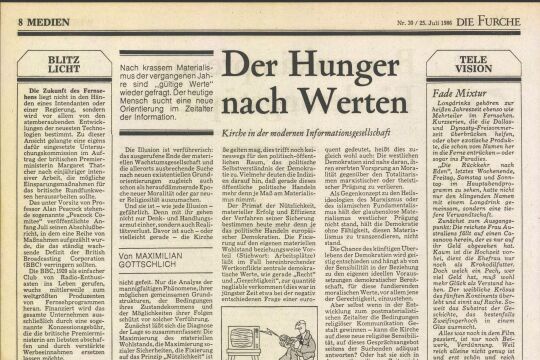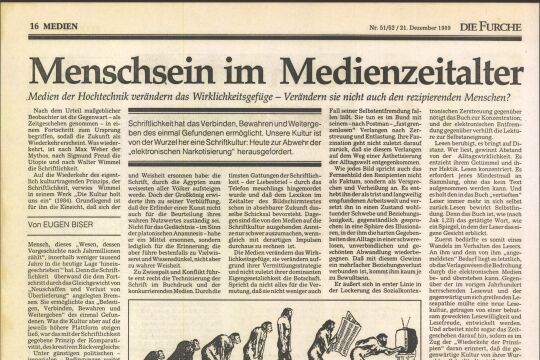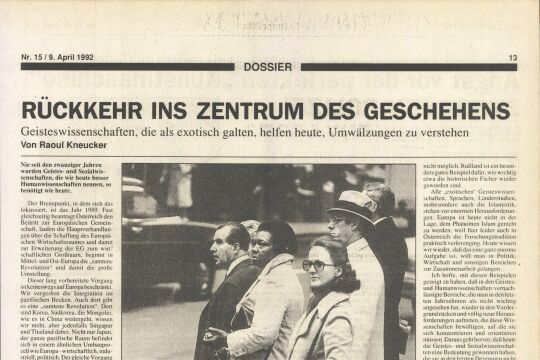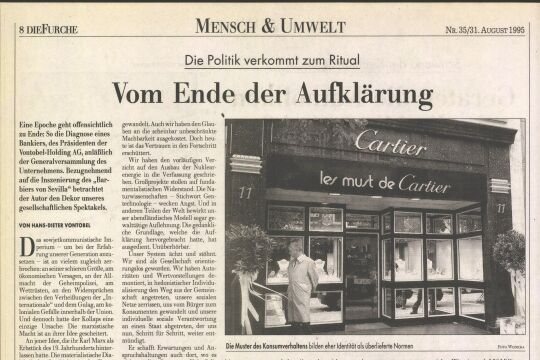Das Virus und wir
DISKURS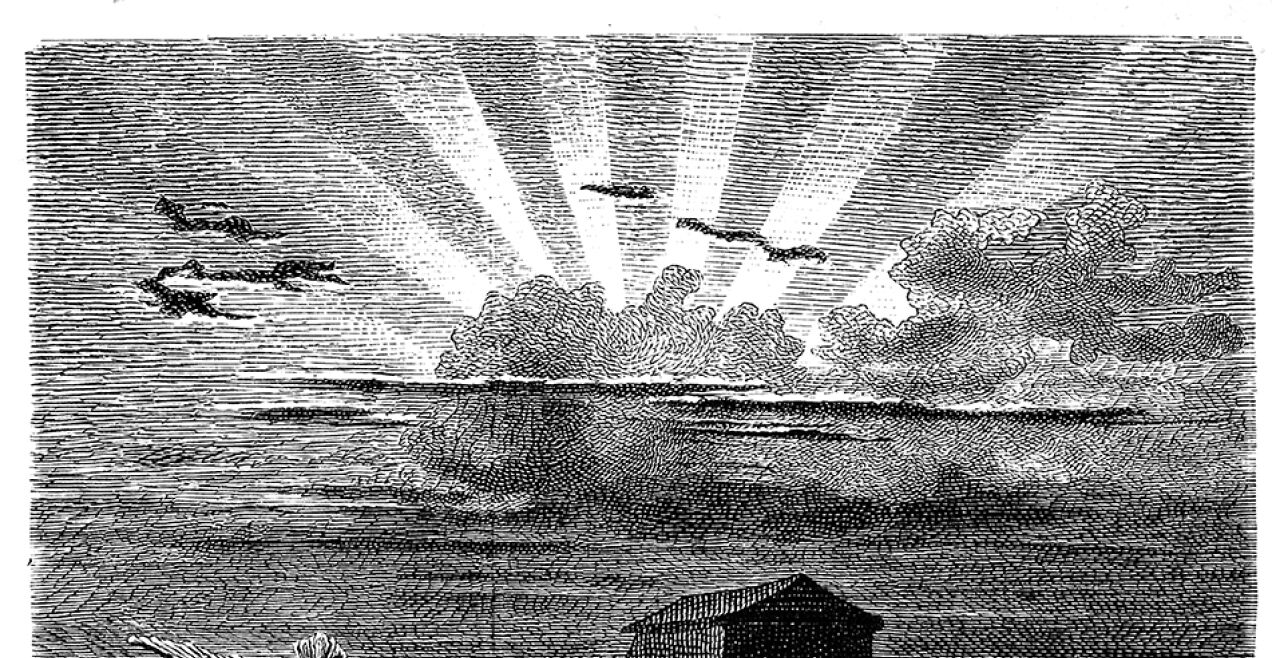
Corona: Was macht "Sinn"?
Religiöse Fragmente in religionsferner Zeit. Eine Kulturkrise zwischen Überforderung und Erwartung: Reflexionen in der Pandemie-Lage.
Religiöse Fragmente in religionsferner Zeit. Eine Kulturkrise zwischen Überforderung und Erwartung: Reflexionen in der Pandemie-Lage.
Die neuzeitliche Kultur unterliegt erstmals ihrer eigenen Selbstverliebtheit. Die „Norm“ der Machbarkeit, des Wachstums und der vermeintlich aufgeklärten Pluralität geht verloren. Sie fällt auseinander und bedarf einer soziohistorischen, philosophischen und theologischen Dekonstruktion. Was macht „Sinn“? In welchen Dimensionen wird Deutung möglich? Die Sinnsuche selbst bleibt fragmentarisch, der dekonstruierte Sinn zerfällt in sehr fragile Bestandteile.
Aus der Not heraus werden Werte und „Sinn“ vorgegeben. Doch: Die Pandemie Covid-19 schickt den Globus auf eine unbekannte Entdeckungsreise, die einer verzweifelten Irrfahrt gleicht. Wo das Ziel auch liegen mag: die aktuellen Herausforderungen in Politik, Wirtschaft, Gesundheit, Ethik und Bildung üben unerwarteten, aber auch unberechenbaren Druck auf die weltweite Sozietät aus.
Fakt ist: Wir befinden uns seit Wochen in einem noch ungeübten Prozess des Wandels. Als Auslöser des gewaltigen Ein- und Umbruchs sind weder bewusstes Zutun noch eine unbeeinflussbare Naturkatastrophe auszumachen. Die aktive Ursachenforschung, wer was wann zu spät erkannt hat, fehlt daher großteils. Meist prägen Schuldzuweisungen das inszenierte Theater. Nun ist zwar eine Bühne von Wuhan bis zum – bereits zur Legende gewordenen – Après-Ski in Ischgl bereitet. Sie führt auch in Intensivstationen und Pflegeheime, doch ohne Sündenbockmechanismus. Das gegenwärtige Weltschauspiel läuft unbeirrt weiter. Es wirkt auf Seele und Geist, individuell und kollektiv. Das Virus ist heimtückisch, hält uns in Bann und deckt die List vergangener Mythen auf. Unbestimmbar, aber gnadenlos.
Kulturexegese als Narrativ
Welche große Erzählung über das erste Halbjahr 2020 entstehen wird, ist schwer zu prognostizieren. Doch lässt sich schon jetzt fragen: Schlägt die Kultur zurück? Wird sie der weltweiten Infektion und aller Bedrohung der Systeme von Gesundheit und Wirtschaft trotzen? Kann sie mit ihrer „Leitkultur“ die Oberhand behalten? Die Zeit ist knapp bemessen und wird von vermeintlichen Klärungsversuchen, wissenschaftlicher Deutungshoheit und letztlich von trügerischer Sicherheit überlagert. Aus der Krise angemessene Schlüsse zu ziehen hieße, bereits verstanden zu haben, was sich erst im Prozess befindet. In allen gesellschaftlichen Bereichen werden Entscheidungen getroffen, deren Voraussetzungen fragwürdig sind. Selbst aufrechte Demokratien entdecken in einmütigen Sondergesetzen die Qualität, geheime Momente unbestrittener Macht an sich zu reißen. Die „Staatsräson“ zwingt sie geradezu, Strukturen einer möglichst „gesicherten Zukunft“ zu gewährleisten – oft mit Kontrolle und Sanktion, auch die aufgeklärte Bevölkerung gerät in Angst und Panik. Der frühe und klare „Shutdown“ mache ein „Hochfahren“ aller früheren Energien frei, so heißt es bisweilen mit gedämpfter Euphorie. Wird es aber der Covid-19-Generation gelingen, sich von diesem Mythos zu befreien und zeitgemäße Metaphern entwickeln?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!