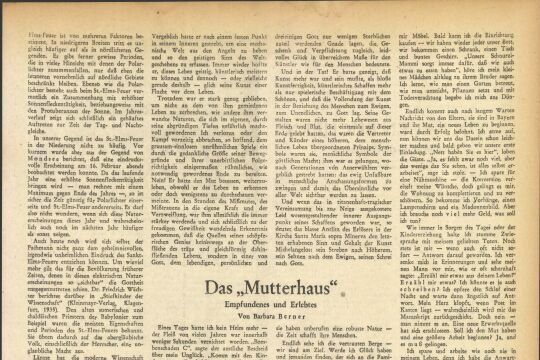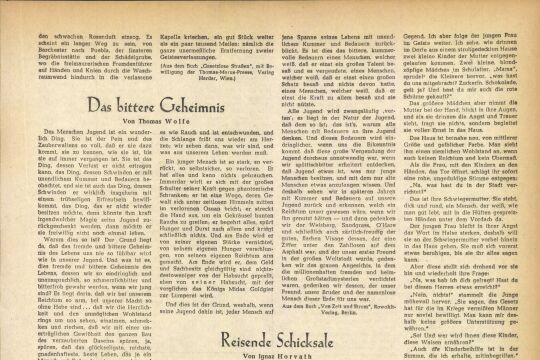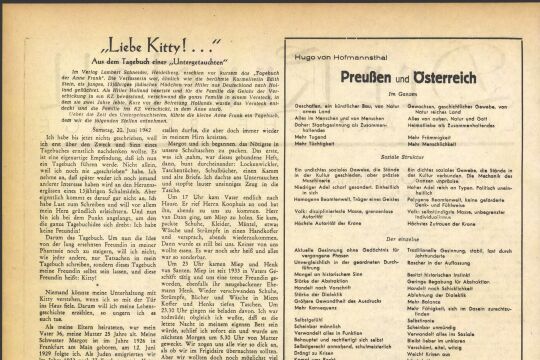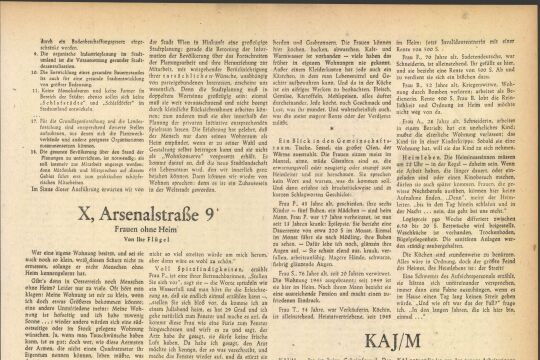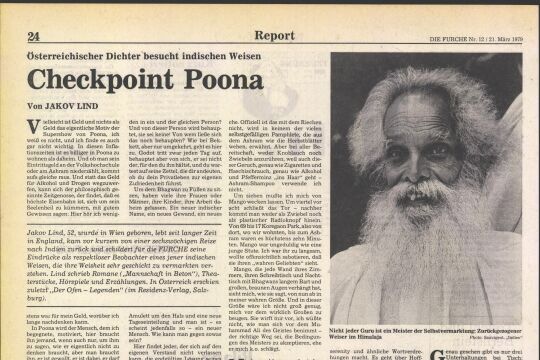Die, die fehlen
Zehntausende 24-Stunden-Betreuerinnen aus Rumänien und der Slowakei kommen nach Österreich, um hier zu arbeiten. Das wirkt sich jedoch auf ihre Heimatländer aus – und ihren persönlichen Alltag. Ein Buchauszug.
Zehntausende 24-Stunden-Betreuerinnen aus Rumänien und der Slowakei kommen nach Österreich, um hier zu arbeiten. Das wirkt sich jedoch auf ihre Heimatländer aus – und ihren persönlichen Alltag. Ein Buchauszug.
Marinas* Mann dreht draußen am Grill die Schweinekoteletts um. Durch die offene Tür zieht der Geruch von Holzkohle und Fett in die Küche. Die neunjährige Tochter klettert die steile Holzstiege herunter. Mit einer Hand hält sie sich am alten Geländer fest, mit der anderen reibt sie sich die müden Augen. Marina holt lose Tomaten und eine Plastikbox voll Schafskäse aus dem Kühlschrank und legt sie auf die Polyester-Tischdecke. Kaum sitzt sie wieder am Stuhl, klettert die Kleine auf ihren Scho? und lässt ihren Kopf auf die Brust der Mutter fallen. Was sich anfühlt wie ein gewöhnlicher Abend, ist für Marinas Familie eine kostbare Seltenheit. Marina ist Rumänin und die pendelnde Hauptversorgerin ihrer Familie. 24 Stunden am Tag, drei Wochen am Stück verbringt sie komplett isoliert bei einer fremden Familie, kümmert sich um alte Menschen, die sich nicht mehr selbst um sich kümmern können. Und die niemand anderen haben, der das übernimmt. Dass sie dafür ihre Tochter zurücklassen musste, fiel Marina nicht schwer. Es war eine pragmatische Entscheidung: Marina verdient in Österreich mehr als der Mann am Bau in Ungarn. Weg zu sein jedoch, das fällt ihr auch nach drei Jahren noch schwer.
Marina sitzt mit Blick zum Fenster auf einem Holzsessel, um sie herum sind die Wände bespickt mit Zeichnungen ihrer Tochter: Pferde malt sie gern, hier und dort auch einen Schmetterling oder ein Powerpuff Girl. Obwohl Marina mehr verdient als die meisten Frauen in ihrer Heimatstadt, sind die Wände noch kahl, Mörtel quillt zwischen den unverputzten Ziegeln hervor. Seit Jahren renoviert die Familie das Haus. Marina erzählt eine Geschichte. Genauso wie Tanja*, eine Frau, die in der Slowakei ihre kranke Schwester allein lässt, um in Österreich Geld zu verdienen. Geschichten wie diese gibt es Tausende, wenn nicht millionenfach. Sie alle sind individuell, doch sie alle folgen einer Erzählung: Der von der Arbeitsmigration, die den weniger privilegierten Teil der Europäischen Union längst zerfleddert. Scharenweise verlassen Menschen Länder wie Rumänien oder die Slowakei – Länder, die ihnen schlicht nichts mehr bieten.
Vater und Mutter in einer Figur
Marinas und Tanjas Geschichten erzählen aber auch vom Verlassen und Verlassenwerden und von den Konsequenzen, die es für eine Familie hat, wenn die Frau fehlt. Was heißt es für eine Mutter, die, wie Marina, jeden Monat aufs Neue ihre Tochter verlässt und für eine Frau wie Tanja, die sich unter Gewissensbissen von ihrer Schwester losreißen muss? Und: Warum stellen wir uns diese Frage nicht, wenn es um all die Väter oder Brüder geht, die nach Ungarn auf den Bau oder nach Deutschland ins Ingenieursbüro gehen? Erst war Marinas Mann weg. Fünf Jahre lang, ab 2012, verbrachte er die meisten seiner Tage auf einer Baustelle in Ungarn. Dann war Marina Vater und Mutter in einer Figur. Sie war es, die ihrer Tochter Essen gemacht und mit ihr gezeichnet hat. Sie war es, die ihr, als sie vier Jahre alt war, erklärt hat, was der Tod ist, und die ihr zwei Jahre später heimlich in den Kindergarten gefolgt ist, als das Kind beschloss, den halbstündigen Weg von nun an alleine zu gehen.
Marina war es aber auch, die Holz gehackt hat, damit sie das Badezimmer heizen kann und das Haus im rumänischen Gheorgheni in Schuss gebracht hat, nachdem sie und ihr Mann sich 2012 endlich leisten konnten, es zu kaufen. Ihre Tochter greift nach einer geschälten Knoblauchzehe und reibt sie auf das gegrillte Weißbrot. „Sie weiß, warum ich im Ausland arbeiten muss. Die Jobs hier sind schlecht bezahlt“, sagt Marina, während sie mit ihren Fingern die beigen und roten Kästchen auf der Tischdecke nachzeichnet. Hinter ihr markieren an den Seiten eines niedrigen Torbogens Striche, wie schnell die Tochter gewachsen ist in den Jahren ohne ihre Mama.
„Ich höre nicht um vier auf zu arbeiten. Ich arbeite in einem Beruf, in dem das Leben eines Menschen von mir abhängt. “
Marina selbst wuchs in einer kleinen Wohnung auf. Als sie acht oder neun Jahre alt war, gingen ihre Eltern nach Ungarn – beide. Sie blieb mit dem Bruder zurück. „Ohne Eltern aufzuwachsen ist schwierig“, sagt sie und legt die Hände flach auf den Tisch. Darum muss einer der beiden dableiben, auch das entschieden Marina und ihr Mann pragmatisch.
Zehn Autostunden oder fast 24 Stunden mit dem Zug braucht Marina, um zur Arbeit zu kommen. Seit 2016 kennt sie diesen Weg, er führte sie schon zu vielen alten und kranken Menschen. In manchen Nächten, so sagt sie, liegt sie irgendwo in Öster reich wach und weint, während sie hofft, dass die fremde Frau im Zimmer nebenan nicht aufwacht. In ganz Rumänien leben offiziell 18.000 Kinder ohne Eltern und 63.000 Kinder mit nur einem Elternteil, weil der andere im Ausland ist. Die Eltern melden sich bei den Behörden und geben eine Kontaktperson an, die sich um die Kinder kümmert.
Sozialarbeiter prüfen dann, ob die elternlosen Kinder gut versorgt sind. 3700 Kinder wurden den Eltern weggenommen. Manche, die auf der Suche nach besserem Einkommen in den Westen abwandern, sagen das den Behörden nicht – aus Angst, dass man ihnen die Kinder nimmt. Es sind vor allem die Frauen, die das Land verlassen: Fast 1,7 Millionen Rumäninnen im erwerbsfähigen Alter halten sich in einem anderen EU-Staat auf – 700.000 mehr als noch vor zehn Jahren. Doch die Männer ziehen nach: Aktuell sind fast 1,5 Millionen von ihnen im Ausland – doppelt so viele wie 2009. Marinas Mann ist ein großer Mann. Wenn er hinter ihr und der Tochter vorbei durch den Türbogen in die Küche geht, muss er sich ducken. Und er arbeitet am liebsten mit den Händen: Den Griller hat er aus dem alten Boiler im Bad gebaut, mittlerweile heizen sie es mit Solarenergie. Im Garten steht eine sorgfältig gearbeitete Hollywoodschaukel aus dunkel lasiertem Holz, darüber ein Dach, daneben ein Ring, in dem die Tochter schaukeln kann – auch die hat er gebaut, während Marina im Ausland war.
Nachdem er in Ungarn Beton gemischt und Dächer gedeckt hat, wurde er Hausmann. In seinem neuen Job in Gheorgheni darf er eine Stunde später in die Arbeit kommen. So kann er am Morgen seine Tochter für die Schule fertig machen, ihr ein Jausenbrot herrichten. Auch bügeln hat er gelernt, Marina ist wichtig, dass Kleidung gebügelt ist. Nur zum Kochen kommt manchmal seine Mutter vorbei. Ein Luxus, den Marina damals, als sie den Haushalt schupfte, nicht hatte. Marina weiß, dass es nicht egal ist, ob Mann oder Frau ins Ausland gehen. Im Mütterverein in Gheorgheni lassen sie die anderen Mütter das spüren. Manchmal wird sie dort nur schief angeschaut. Manchmal sagen sie ihr direkt ins Gesicht, dass sie eine schlechte Mutter sei. Was sie ihnen entgegnet? „Tauschen wir doch einmal. Ich höre nicht um vier auf zu arbeiten. Ich arbeite in einem Beruf, in dem das Leben eines Menschen von mir abhängt.“ Respekt oder Wertschätzung, sagt sie, bekommt sie dafür nur von wenigen. Das ist eben das Rollenverständnis, sagt sie: „Solche Vorwürfe habe ich bei Männern noch nie gehört.“ Ihre freundliche Miene wird kühler, „das Kind hat ja auch einen Papa, nicht nur eine Mama.“ Zu Zeiten des Realsozialismus stellte sich für Rumäninnen, die arbeiten wollten, sogar mussten, die Frage der Kinderbetreuung nicht. Staatliche Kindergärten und Horte regelten das Familien- und Arbeitsleben. Mit dem Umbruch wurden sie durch Private verdrängt, die sich angesichts der Gehälter in Rumänien – der Mindestlohn liegt bei knapp 450 Euro – niemand mehr leisten kann. Jetzt übernehmen oft Männer, die zurückbleiben, die Betreuung. Noch öfter aber bleiben diese Aufgaben an Müttern, Tanten, Cousinen hängen.
Arbeiten mit schlechtem Gewissen
In den beschaulichen, österreichischen Gemeinden, in denen in Summe über 60.000 24-Stunden-Betreuerinnen arbeiten, sieht man die Geschichte hinter den Frauen nicht. Man sieht nicht die Ablehnung, die sie oft zu Hause erfahren. Nicht die Rollenbilder, die umgeworfen oder verstärkt werden – gezwungenermaßen. Und auch nicht das daraus resultierende schlechte Gewissen, das auf ihnen lastet, wenn sie täglich fremde alte Menschen waschen, ihnen die Windeln wechseln und für sie kochen, während ihre Fürsorge zu Hause fehlt. An diesem heißen Sommernachmittag sitzt Tanja im Schatten eines Innenhofs. Zwischen den Einfamilienhäusern eines niederösterreichischen Dorfes zerzaust eine leichte Brise ihre rot gefärbten Stirnfransen, das Augen-Make-up ist längst von den Schweißperlen verwischt. Ihre Oberarme sehen aus, als würde sie täglich ins Fitnessstudio gehen, nicht wie die einer 61-Jährigen. Mit den säuberlich manikürten Nägeln und den schmalen Fingern klopft sie im Takt auf den Gartentisch, wenn sie von ihren täglichen Routinen erzählt. Eine Frau machte ihr das Leben in Österreich schwer, „sie war faul. Ein fauler Teufel“, sagt Tanja. Während sie sich abmühte, lachte die Frau hämisch, verschmierte Dreck, manchmal ihren eigenen Stuhl. Tanja betreute sie sechs Jahre lang.
Die anderen Betreuerinnen, die sich um die Frau kümmerten, während Tanja in der Slowakei war, kamen und gingen. 21 verschiedene Kolleginnen erlebte sie. Das türkise Tanktop mit den pinken Punkten, das Tanja trägt, markiert den Start ihrer Geschichte als Arbeiterin. Sie hat es selbst gemacht, 22 Jahre lang hat sie in der Stofffabrik gearbeitet. Sie hat gut verdient, kannte sich mit den deutschen Maschinen aus, die ihr Mann reparierte. Als nach der Wende die Textilbranche in der Slowakei zusammenbrach, schraubte sie am Fließband für eine japanische Elektronikfirma Fernseher zusammen. Immer die gleiche Schraube, immer die gleiche Bewegung. Als sich nach 14 Jahren Routine das Handgelenk entzündete, hörte sie auf. Auch in der Slowakei sind vor allem Frauen die, die gehen: 172.600 Slowakinnen im erwerbsfähigen Alter sind im Ausland und 129.000 Männer. An einem Donnerstag wird Tanja auf der Straße gefragt, ob sie Betreuerin werden will. Am Samstag kauft sie sich einen Koffer, am Sonntag sitzt sie im Zug nach Klagenfurt.
„Nur einmal bin ich in meinem Leben zu spät gekommen“, sagt sie. Damals, als 14-Jährige, ist ihr der Bus vor der Nase weggefahren, sie brach in Tränen aus. Tanja ist immer pünktlich. Nur Routine macht ein Leben, das sich seit jeher um andere dreht, planbar. Hier in Niederösterreich, wo es nach frisch gechlorten Swimmingpools und frisch gemähtem Rasen riecht, betreut sie die dritte Frau in ihrem Berufsleben. Sie weckt sie, sie strickt mit ihr – zumindest ein paar Reihen am Tag, mehr macht die Hand nicht mit – und sie sorgt dafür, dass jeden Tag um Punkt zwölf das Essen fertig ist. Tanja versteht sich als Psychologin und Spionin in einem. Nicht nur in ihrem Beruf, wenn sie demenzkranken alten Damen hinterherläuft und herausfindet, mit welchen Wörtern sie sie beruhigen kann, wenn sie in einer anderen Zeit feststecken. Auch zu Hause in der Slowakei, wo sie die andere Hälfte ihrer Lebenszeit damit verbringt, ihre kranke Schwester zu pflegen, zu beruhigen und durch ein Loch, dass sie in die Badezimmerwand gebohrt hat, zu kontrollieren, ob sie sich auch wirklich wäscht.
Als Tanja noch ein Kind war, so erzählt sie, ist die Mutter auf der Treppe gestolpert, als sie schwanger war. Tanja schlägt sich mit der flachen Hand in den Bauch. Das muss der Grund sein, warum ihre Schwester heute krank ist, glauben die Geschwister. Sieben sind sie, fünf Schwestern und zwei Brüder. „Bei uns sagt man: Bei so vielen Kindern muss eines beschädigt sein. Es ist wie mit den Tieren“, erklärt Tanja. Wenn Tanja in der Slowakei ist, weiß sie schon am Morgen, wie der Tag aussehen wird. Wenn es neun Uhr ist, und die Schwester ist noch nicht aufgestanden, geht Tanja nach oben. An manchen Tagen hat die Schwester sich verbarrikadiert, dann wird es ein schwieriger Tag. Dann schreit sie, oft Stunden, und manchmal nur, weil ein Schuh nicht da steht, wo er stehen soll.
„ Meine Tochter weiß, warum ich im Ausland arbeiten muss. Die Jobs hier sind schlecht bezahlt. “
Das türkise Tanktop mit den pinken Punkten, das Tanja trägt, markiert den Start ihrer Geschichte als Arbeiterin. Sie hat es selbst gemacht, 22 Jahre lang hat siein der Stofffabrik gearbeitet. Sie hat gut verdient, kannte sich mit den deutschen Maschinen aus, die ihr Mann reparierte. Als nach der Wende die Textilbranche in der Slowakei zusammenbrach, schraubte sie am Fließband für eine japanische Elektronikfirma Fernseher zusammen. Immer die gleiche Schraube, immer die gleiche Bewegung. Als sich nach 14 Jahren Routine das Handgelenk entzündete, hörte sie auf. Auch in der Slowakei sind vor allem Frauen die, die gehen: 172.600 Slowakinnen im erwerbsfähigen Alter sind im Ausland und 129.000 Männer. An einem Donnerstag wird Tanja auf der Straße gefragt, ob sie Betreuerin werden will. Am Samstag kauft sie sich einen Koffer, am Sonntag sitzt sie im Zug nach Klagenfurt.„Nur einmal bin ich in meinem Leben zu spät gekommen“, sagt sie.
Damals, als 14-Jährige, ist ihr der Bus vor der Nase weggefahren, sie brach in Tränen aus. Tanja ist immer pünktlich. Nur Routine macht ein Leben, das sich seit jeher um andere dreht, planbar. Hier in Niederösterreich, wo es nach frisch gechlorten Swimmingpools und frisch gemähtem Rasen riecht, betreut sie die dritte Frau in ihrem Berufsleben. Sie weckt sie, sie strickt mit ihr – zumindest ein paar Reihen am Tag, mehr macht die Hand nicht mit – und sie sorgt dafür, dass jeden Tag um Punkt zwölf das Essen fertig ist. Tanja versteht sich als Psychologin und Spionin in einem. Nicht nur in ihrem Beruf, wenn sie demenzkranken alten Damen hinterherläuft und herausfindet, mit welchen Wörtern sie sie beruhigen kann, wenn sie in einer anderen Zeit feststecken. Auch zu Hause in der Slowakei, wo sie die andere Hälfte ihrer Lebenszeit damit verbringt, ihre kranke Schwester zu pflegen, zu beruhigen und durch ein Loch, dass sie in die Badezimmerwand gebohrt hat, zu kontrollieren, ob sie sich auch wirklich wäscht.
Als Tanja noch ein Kind war, so erzählt sie, ist die Mutter auf der Treppe gestolpert, als sie schwanger war. Tanja schlägt sich mit der flachen Hand in den Bauch. Das muss der Grund sein, warum ihre Schwester heute krank ist, glauben die Geschwister. Sieben sind sie, fünf Schwestern und zwei Brüder. „Bei uns sagt man: Bei so vielen Kindern muss eines beschädigt sein. Es ist wie mit den Tieren“, erklärt Tanja. Wenn Tanja in der Slowakei ist, weiß sie schon am Morgen, wie der Tag aussehen wird. Wenn es neun Uhr ist, und die Schwes ter ist noch nicht aufgestanden, geht Tanja nach oben. An manchen Tagen hat die Schwester sich verbarrikadiert, dann wird es ein schwieriger Tag. Dann schreit sie, oft Stunden, und manchmal nur, weil ein Schuh nicht da steht, wo er stehen soll.
An manchen Tagen aber hatsie Musik aufgedreht und tanzt. Dann geht Tanja nach unten und sagt den Geschwistern: „Heute ist ein guter Tag.“ Tanja hat als Älteste die Verantwortung für die Schwester, so hat der Vater es gelehrt. Wenn sie nach Österreich geht, übernimmt eine andere Schwester. Irgendjemand muss immer da sein, zu groß ist die Gefahr, dass sie sich verletzt. „Meine zwei Brüder leben in Holland, die hätten sich nicht um sie kümmern können“, sagt Tanja. Vielleicht, so glaubt sie, hat es aber auch damit zu tun, dass die beiden Männer sind. Tanja zuckt mit den Schultern, so ist die Norm, so sind die Regeln, auch das hat der Vater so gelehrt.
Für andere da sein
Tanja selbst hat eine Wohnung in der Slowakei, sie bekam sie, als ihr Mann noch lebte. Im dritten Stock ist die, nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Seit zehn Jahren ist Tanja Witwe, die gemeinsame Tochter längst nach England ausgewandert. Vier Tage im Monat verbringt sie in ihrer Wohnung: zwei bevor und zwei nachdem sie die Reise antritt. Um ihre Sachen zu packen, sagt sie den Geschwistern. Frauen wie Tanja und Marina kümmern sich um die Pflegebedürftigen in Öster reich und um die Angehörigen zu Hause. Dennoch und gerade deswegen haftet eine moralische Schuld an ihnen – weil sie als Frauen die unbezahlte Sorgearbeit abgeben, um im Westen mit ebendieser ihr Geld zu verdienen. Eine moralische Schuld, die Tanja in den vier Tagen in ihrer Wohnung ausblendet. An diesen zwei mal zwei Tagen hat die Frau, die schon ein ganzes Leben lang akkurat, pünktlich und für andere da ist, Zeit für sich. Was das bedeutet? „Dann lieg ich einfach nur am Sofa und schau fern.“
* Weil sowohl Marina als auch Tanja sehr persönliche Informationen preisgeben, sind ihre Vornamen erfunden.

Wen kümmert’s?
Von Elisa Tomaselli (Hg.)
ÖGB-Verlag 2019 172 S.,
TB., € 19,90